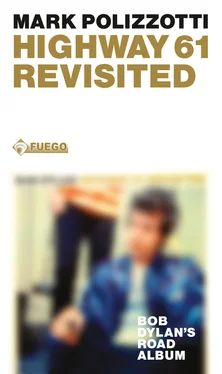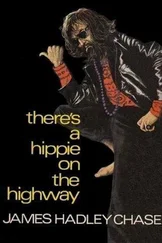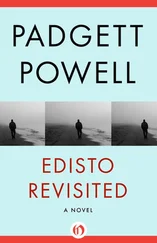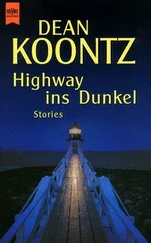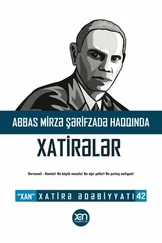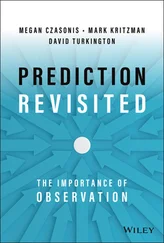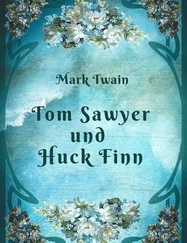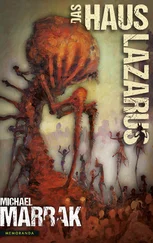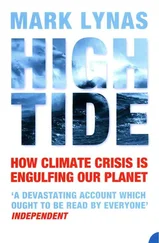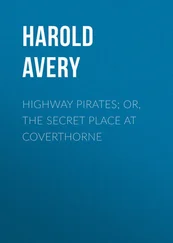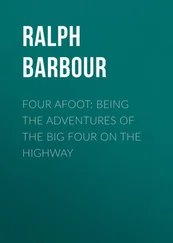Angeblich wurde Joan Baez 1965 von Dylan mit einer schnoddrigen Ansage verspottet: »Hey, Hey, Neuigkeiten verkaufen sich gut, stimmt’s? Ich wusste, dass die Leute mir diesen Scheiß abkaufen würden, stimmt’s?« Wir könnten das einfach als ätzende Übertreibung abtun, eine günstige Gelegenheit, Salz in die Wunden zu streuen. Weniger einfach ist der Verdacht abzutun, dass Dylans Protestlieder nicht nur aus einem echten Gefühl der Empörung heraus, sondern auch aus einer Art von Überheblichkeit heraus geschrieben wurden. Egal was man über »Blowin’ in the Wind« alles sagen könnte, es ist unbestreitbar eine Meisterleistung, in zehn Minuten ein Stück runterzuschreiben, das dann zur Hymne einer ganzen Generation wird, und die beste Bestätigung, die man sich als junger Songwriter nur wünschen kann.
Dylan deutete das in einem der damaligen Interviews auch an, als er mal weniger Zeit auf die Verdammung der Kriegstreiber verwendete als auf die Verspottung der formelhaften Komponisten der Tin Pan Alley *3: »Ich muss nicht so sein wie diese Kerle da oben am Broadway mit ihrem Geschreibe über ›Ich bin scharf auf Dich und Du bist scharf auf mich – ooka dooka dooka dee.‹« v9
Und in der Tat scheint er es selbst in seinen erzählerischsten Songs weniger darauf anzulegen, die darin geschilderten Ungerechtigkeiten anzuprangern, als darum, Gewissheiten und Institutionen zu untergraben – sie zu »nadeln«, wie er es nannte. Ein enger Freund hat darauf hingewiesen, dass Dylans Ansatz in diesen Liedern nicht journalistisch war, sondern »poetisch. Es war alles intuitiv, auf einer emotionalen Ebene.« v10Nur wenige scheinen das in den aufregenden Zeiten von Dylans frühen Erfolgen schon erkannt zu haben. Das würde zumindest erklären, warum sogar noch vor dem eindeutig nach innen gerichteten Blick des Highway 61 auch eher bekenntnishafte Lieder wie »One Too Many Mornings« und »It Ain’t Me, Babe« einen totalen Richtungswechsel darzustellen schienen. Einer der Gründe für die Verführungskraft von Dylans Widerstand ist allerdings die Tatsache, dass Dylan sich schon immer jeglicher Obrigkeit widersetzt hatte – den Herren, die »die Regeln aufstellen / für die Weisen und die Narren« *4ebenso wie jenen, die »Obrigkeiten gehorchen müssen / die sie überhaupt nicht respektieren«. *5Dylans Misstrauen gegenüber Machtstrukturen, jeglichen Machtstrukturen, seien sie nun gesellschaftlicher oder emotionaler Art, bricht in seinen Liedern – von »When the Ship Comes In« über »Subterranean Homesick Blues« zu »Most Likely You Go Your Way and I’ll Go Mine« – immer wieder durch, sei es implizit oder offenkundig. Macht schätzt den Status Quo. Und Dylan erinnert uns ständig daran, dass alle, die nicht gerade damit beschäftigt sind, geboren und dann wiedergeboren zu werden, schon im Sterben liegen.
Gleichzeitig liegt Dylans Verhältnis zu Autoritätspersonen eine gewissen Bösartigkeit, einer Art Pervertiertheit zugrunde, die sich sowohl in seinen Kompositionen als auch in der Auswahl seiner Projekte über die vergangenen fünfzig Jahre widerspiegelt, von seinem brüskierenden Auftritt 1965 in Newport bis zu seinem Arrangement mit Victoria’s Secret 2004 oder seiner Zusammenarbeit mit dem Choreographen Twyla Tharp, die für einiges Zähneknirschen unter seinen Anhängern gesorgt hat. Sie ist das verbindende Element in seiner berüchtigten Angewohnheit, Freunde und Mentoren erst zu umarmen und dann wegzustoßen, Teil der sagenhaften stilistischen Migrationen, die ihn vom Folk über Country zu Gospel und zurück geführt haben; sie zeigt sich in seinen manchmal brillianten, manchmal katastrophalen Wiederaufnahmen seines eigenen Materials und seiner häufig antagonistischen Beziehung zu seinem Publikum – dem gleichen Antagonismus, der im Coverfoto des Highway 61 aufblitzt. Emblematisch dafür ist sein Patentrezept zum Umgang mit widerspenstigen Fans: »Na ja, man (…) wird sie einfach schnell los. Stößt sie vor den Kopf oder sowas. Die schnallen das schon.« v11Ab dem Moment, in dem Dylan begann, sich einen Bühnennamen zu erarbeiten, begann er auch ein psychisches Tauziehen mit Presse und Öffentlichkeit, indem er sie einerseits wegstieß und andererseits alles tat, damit sie zurückkamen und um mehr bettelten.
Die meisten Menschen versuchen, ihr inneres Kind zu finden – oder, im Falle von zahlreichen Rockstars, ihr inneres Kleinkind. Dylan hingegen scheint seine frühe Karriere damit verbracht zu haben, seinen inneren Griesgram zu befreien. Unter dem kindlichen Äußeren steckt die Stimme und die Stimmung eines grantigen Alten, eines besorgten Mannes mit schweren Gedanken, der auf die Verrücktheiten seiner Generation schaut als wären es die Taten unreifer Jugendlicher, mit denen ihn nichts verbindet. Seine Ablehnung von Woodstock 1969 – und zwar sowohl des Festivals als auch der Hippies, die in seinen Hinterhof strömten, um daran teilzunehmen – ist allgemein bekannt und ein weiterer Beweis für etwas, was viele immer noch nicht anerkennen können: Dylan ist nicht etwa ein Produkt der Zeit und Kultur, die er mit gestaltet hat, sondern von der Zeit und Kultur, die ihn geformt hat – jener Zeit und Kultur, die sich in den düsteren, direkten Balladen auf Harry Smiths Anthology of American Folk Music von 1952 spiegelt, die selbst wiederum ein Abbild der farblos-flachen Wirklichkeit ist, die Dylan als Kind in den 40er Jahren in Minnesota erlebte. Greil Marcus und andere haben betont, wie eng Dylan mit seinem Land und seiner Zeit verbunden ist, wie tief seine Wurzeln in den dunklen, bitteren Untergrund dessen reichen, was Marcus als »das alte, unheimliche Amerika« bezeichnet. *6
Vorsicht beginnt natürlich zu Hause, und Dylans großes Misstrauen äußert sich nicht nur in seiner Beziehung zur Öffentlichkeit, sondern ebenso im privaten Bereich: Liebe und Bewunderung kommen bei ihm selten ohne ein gewisses Maß an Ressentiment und Tadel aus. Auf der Auskopplung von »Hero Blues« vom Freewheelin’- Album, das eine frühe Bearbeitung des »It Ain’t Me, Babe«-Themas ist, tadelt der Sänger »mein Mädchen hier« für ihren Wunsch, dass er rausgehen und kämpfen solle, »damit sie es allen ihren Freunden erzählen kann«. Unbeeindruckt kommt der (mögliche) Held des Songs zu dem Schluss: »Du brauchst eine andere Sorte Mann, du brauchst Napoleon Bone-ey-parte.« Der »Hero Blues«, komödiantisch vor einer unruhigen Bass-Figur gespielt, könnte die Eskalation des amerikanischen Engagements in Vietnam zurückweisen, wie Oliver Trager in Keys to the Rain meint; eine Auffassung, die dadurch untermauert scheint, dass Dylan den Song auf einem Konzert mit den Worten ankündigte, er sei »für all die Jungs, die Mädchen kennen, die wollen, dass sie los gehen und sich dazu bringen zu töten [sich töten zu lassen?]« v12
Aber ich denke, man kann daran auch den Missmut Dylans in seiner damalige Beziehung mit Suze Rotolo erkennen. Suze ist das Mädchen auf dem Cover von The Freewheelin’ Bob Dylan und die Inspiration für Lieder, die vom Erhabenen (»Don’t Think Twice, It’s All Right«) bis zum Bedauernswerten reichen (der wirklich fiesen »Ballad in Plain D«, der Geschichte ihrer Trennung). Zwar hält Dylan ihr zugute, dass sie in den frühen 60er Jahren sein politisches Bewusstsein geweckt und ihn ausgesandt habe, die Ungerechtigkeiten dieser Welt mit seinen Liedern anzuprangern – aber im beißenden Humor von »Hero Blues« schwingt die Ambivalenz darüber mit, in eine Richtung gezogen zu werden, von der er sich nicht sicher war, dass er sie überhaupt nehmen wollte – und ganz generell der Groll darüber, überhaupt in irgend eine Richtung gezogen zu werden.
Dylan bemerkte 1965 gegenüber Nora Ephron, dass »Folkmusik die einzige Musik [sei], in der nichts einfach sei. Es war niemals einfach. Die Musik ist wirklich seltsam, voller Legenden, Mythen, Bibel und Geistern.« v13Einfachheit ist nicht Dylans Königsdisziplin. Die Folktradition, aus der er stammt, ist nicht von der weichen, sentimentalen Sorte, die so gefällige Hits wie »I Gave My Love a Cherry« und »Walk Right In« hervorgebracht hat; es ist die dunklere, komplexere und moralisch vieldeutige Variante, die seit Jahrhunderten die menschliche Natur ganz ungeschminkt vermittelt. In einer ausgesprochen interessanten Bemerkung zog Dylan 1966 gegenüber Nat Henthoff eine scharfe Trennung zwischen der modischen »Folkszene« der Volksmusikfeste auf der einen und dem fruchtbaren Kompost der Musik des Volkes auf der anderen Seite:
Читать дальше