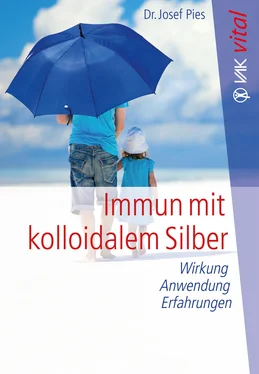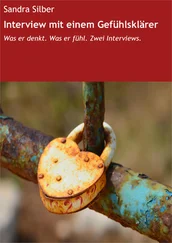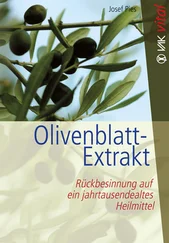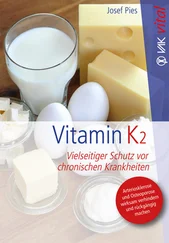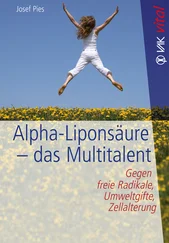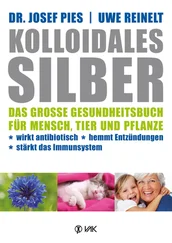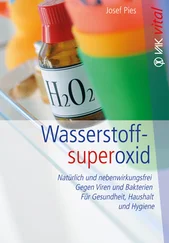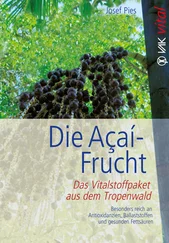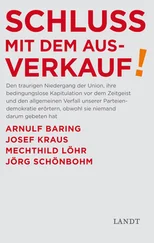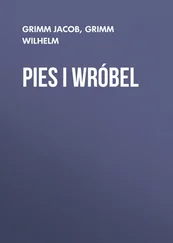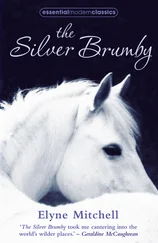Diese Methode fand schon vor einem halben Jahrhundert Berücksichtigung in einem Standardwerk der Chemie (Römpp 1966): „Man versucht, auch Wasser, Eis, Limonaden und Kunstlimonaden durch kleinste Mengen kolloidalen Silbers haltbar zu machen.“
1869 wies der Wissenschaftler Ravelin darauf hin, dass Silber bereits in sehr niedrigen Dosierungen seine antimikrobielle Wirksamkeit entfaltet (Ravelin 1869). Ein anderer Wissenschaftler, der Botaniker Carl Wilhelm von Nägeli (1817–1891), beschrieb diese Eigenschaft mit dem Wort „oligodynamisch“, was so viel bedeutet wie „mit wenig aktiv sein“ (Nägeli 1893). Er fand heraus, dass schon eine Konzentration von nur 0,0000001 Prozent Silberionen genügt, das entspricht 9,2 x 10 -9Mol (= 9,2 Nanomol oder etwa 1 Mikrogramm) Silber pro Liter, um die im Frischwasser vorkommende Alge Spirogyra abzutöten. Zum Abtöten von Sporen eines Schimmelpilzes (Aspergillus niger), so fand er heraus, genügen ebenfalls nur 0,00006 Prozent Silberionen, entsprechend 5,5 x 10 -6Mol (= 5,5 Mikromol) Silber. Nicht von ungefähr nutzen weltweit viele Krankenhäuser, Hotels und Fluggesellschaften Silberfilter und auch die NASA hat sich bei dem Bau des Spaceshuttle für ein Silbersystem zur Wasseraufbereitung entschieden, ebenso wie es die Russen bei der MIR-Station taten.

Basis für die Wasseraufbereitung mittels Silber ist die Silberung durch das so genannte Katadyn-Verfahren (aus katalytisch und oligodynamisch), das um 1928 entwickelt wurde (Krause 1928). Bei dieser Methode wird „Blähsilber“ auf einen Träger aufgebracht und dadurch eine sehr große metallische Oberfläche geschaffen (vgl. Welche Qualitätskriterien gelten für kolloidales Silber?). Über diese Fläche wird dann das Wasser gefiltert und Krankheitserreger werden abgetötet. Auch zur algiziden Aufbereitung von Brauch- und Badewasser zum Beispiel in Schwimmbädern, das heißt zum Abtöten von Algen, ist die Silberung geeignet.
Im frühen 19. Jahrhundert hatte kolloidales Silber seinen selbstverständlichen Stellenwert in der Medizin. Es zeichnet sich schließlich durch ein äußerst breites Wirkspektrum aus und ist so gut wie frei von Nebenwirkungen. An der damaligen großen Verbreitung hatte nicht zuletzt Alfred Broadhaed Searle (1877–1967) großen Anteil, der sich intensiv mit der Erforschung der Heilkraft von Kolloiden befasste, darunter auch Silber (1920). In dem Vorwort zu seinem Buch schreibt Sir Malcolm Morris sinngemäß: „Da alle Lebensprozesse in kolloidalen Systemen stattfinden, ist es offensichtlich, dass auch Arzneimittel in einem kolloidalen Zustand vorliegen sollten. Nur so können sie ihre volle Wirksamkeit entfalten.“ Demnach ist kolloidales Silber also ein ideales Arzneimittel. Searle vergleicht Kolloide mit Enzymen, die Prozesse anstoßen und beschleunigen, ohne dabei selbst verändert zu werden. Er weist darauf hin, dass man mit Metallkolloiden erstaunliche Resultate erzielen und Krankheitserreger schnell besiegen kann, ohne dem Patienten zu schaden.
Er thematisiert aber auch schon damals zwei heute noch wichtige Punkte, die den Einsatz von kolloidalem Silber so sehr erschweren. Er schreibt, „… dass die Anwendung von kolloidalen Solen bei Erkrankungen des menschlichen Körpers sehr ermutigend ist. Aber wie bei allen neuen Ideen gab es Rückschläge und Enttäuschungen, die in fast allen Fällen durch Ignoranz verursacht wurden. Neben anderen Gründen war die voreilige Belieferung mit unsachgemäß zubereiteten und instabilen Kolloiden eine der ernsthaftesten Problemquellen.“ Searle fasste in seinem Buch auch etliche wissenschaftliche Arbeiten anderer Autoren über kolloidales Silber zusammen.
Da kolloidales Silber aufgrund der früheren Herstellungsverfahren nicht gerade billig war, wurde dadurch die Verbreitung von Antibiotika begünstigt. Heute kann man kolloidales Silber mit einem Silbergenerator relativ günstig selbst herstellen.
Seit der Entdeckung des Penizillins im Jahre 1928 wurden Tausende verschiedener Antibiotika erforscht. In ihnen sah die moderne Medizin jahrzehntelang eine Wunderwaffe gegen jeglichen bakteriellen Keim. Während man sich also enthusiastisch dieser Neuentwicklung zuwandte, geriet kolloidales Silber nach und nach in Vergessenheit. Erst als man feststellen musste,dass sich in immer stärkerem Maße resistente Bakterienstämme entwickelten, denen auch mit modernsten Antibiotika nicht mehr beizukommen ist, besann man sich allmählich wieder auf die Vorteile kolloidalen Silbers. Je häufiger ein Antibiotikum verordnet wird, umso leichter können nämlich resistente Bakterienstämme entstehen.
Im frühen 19. Jahrhundert hatte kolloidales Silber seinen selbstverständlichen Stellenwert in der Medizin.
In den 1970er-Jahren erhielt die chirurgische Abteilung der Universitätsklinik in Washington ein Stipendium zur Erforschung verbesserter Versorgungsmethoden von Patienten mit Verbrennungen. Dabei fand man heraus, dass Silber enorme Vorteile gegenüber anderen Stoffen aufweist. Ebenfalls um diese Zeit begannen Wissenschaftler in New York mit Silber beschichtetes Gewebe zur Behandlung komplexer Knocheninfekte zu erforschen.
In der Chirurgie hat Silber seinen Stellenwert zum Beispiel beim Abklemmen von Hirngefäßen oder zum Verschließen von Schädeldachdefekten (Heidenhain-Plastik).
Auch in Deutschland war die besondere Wirkung von Silber lange bekannt. Schon 1881 empfahl beispielsweise der Leipziger Gynäkologe Carl Sigmund Franz Credé (1819–1892), der weit verbreiteten Bindehautentzündung bei Neugeborenen (so genannter Augentripper) durch Einträufeln von einprozentigem Silbernitrat vorzubeugen. Diese Komplikation wurde häufig durch eine Gonorrhöe der Mutter verursacht und konnte durch die neue Methode schlagartig beseitigt werden, weshalb diese so genannte „Credé-Prophylaxe“ bei Neugeborenen in Deutschland sogar bis 1992 gesetzlich vorgeschrieben war. Auch heute gibt es noch silbernitrathaltige Augentropfen als apothekenpflichtiges Arzneimittel, die bei dieser Indikation zugelassen sind. Credé hatte übrigens festgestellt, dass Silbernitrat noch in einer Verdünnung von 1:1000 innerhalb von fünf Minuten Staphylokokken, Streptokokken und Milzbranderreger abtötet.
Neben dem Silbernitrat verwendete man unter anderem Silberjodid und -chlorid zur Desinfektion, sowie Silberlaktat als adstringierendes (zusammenziehendes) und antiseptisches (keimtötendes) Agens. Silberoxid setzte man früher bei Cholera und Epilepsie ein. Von solchen Silberzubereitungen als Salz hat man inzwischen wegen des großen Nebenwirkungspotenzials jedoch weitgehend Abstand genommen.
In dem Buch The Body Electric (Becker und Seldan 1990) wird noch auf eine ganz andere Einsatzmöglichkeit von Silber aufmerksam gemacht. Schon 1812 setzte Dr. John Birch vom St. Thomas’ Hospital in London Elektroschocks zur Heilung eines nicht zusammenwachsenden Schienbeines ein. Becker und seine Kollegen griffen diese Methode um 1980 auf, verwendeten dafür aber Silberelektroden. Sie stellten fest, dass sich durch das Anlegen von Strom bereits ausdifferenzierte Gewebszellen (Fibroblasten, die das Gewebe bilden) wieder in ihren ursprünglichen Zustand (in undifferenzierte Zellen) zurückverwandeln lassen und keinen Gewebeverband bilden. Entfernte man das Silber aus der Nährlösung, bildeten sie sich wieder zu Fibroblasten um und verklumpten gewissermaßen zu neuem Gewebe. Ähnliche Reaktionen beobachteten sie auch bei Verwendung von versilbertem Nylon zur Wundbehandlung. Somit ist die wundheilende Wirkung von Silberionen offenbar darauf zurückzuführen, dass sie eine Gewebsneubildung anstoßen.
Читать дальше