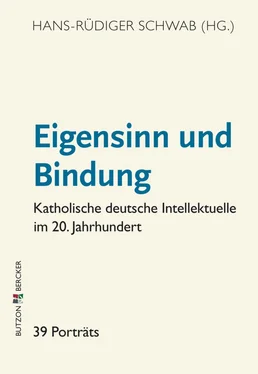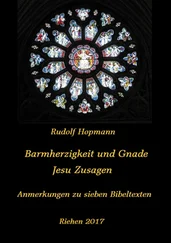Die Verteidigung der Prinzipien vernünftiger Selbstbestimmung des Individuums und einer unter dem Anspruch der Gerechtigkeit stehenden offenen Gesellschaft aber ist nicht blind den Widersprüchen und „Entgleisungen“ 25der westlichen Moderne gegenüber. In allgemeinen Manifestationen des Ungenügens erschöpft sich diese Haltung nicht. Vielmehr mobilisiert sie – um nur diese Aspekte aus einer üppig bestückten Agenda herauszugreifen – Widerstandspotenziale und entfaltet eine dissidente wie auf pragmatisches Handeln abzielende Kraft im Einspruch gegen die Totalkapitalisierung des Lebens mit ihren Verwerfungen. Für Religion grundsätzlich gilt, dass sie von einem „Jenseits des Funktionierens“ nicht zu trennen ist. 26
Somit erwiese sich katholische Intellektualität als ein komplexes Differenzierungsprogramm. Ihre Vertreter wären wesentlich Anwälte einer besonnenen Moderne. Sie trügen zur Entmythologisierung wahnhafter Anteile bei, in denen die Idee der Moderne jene zur Eigenkorrektur begabte Grundierung aufgibt, aus der Leszek Kolakowski listig ihren Vorrang abgeleitet hat: Niemals außer Acht lassen dürfe die Moderne folglich „ihre Fähigkeit, sich selbst in Frage zu stellen, aus ihrer Ausschließlichkeit herauszutreten“ 27.
Zum Schluss sei kurz noch ein höchst privater Traum vom Intellektuellen gestattet. Zumal im Falle seiner katholischen Herkunft sollte das eingangs erwähnte Zwitterwesen über Ironie verfügen – weil es demütig ist, und nicht überlegenheitsstolz (was zu religiösen Menschen ohnehin nie passt). Gerade bei dem katholischen Intellektuellen handelt es sich doch weit eher um einen Narren als um einen clerc (nach der klassischen Bezeichnung Julien Bendas). 28Mit der pathetischen Geste hält er sich zurück, und wenn er sie hin und wieder doch gebraucht, trübt dies nicht seinen Sinn für Selbstrelativierungen – keineswegs nur aus dem Bewusstsein eines Lebens im Paradox. Demütig aber ist dieser Intellektuelle, weil er immer mit der eigenen Fehlbarkeit rechnet, damit, dass die eigene Einlassung unvollständig oder irrtumsanfällig sein könnte.
(Selbst-)Ironie als Mittel gegen die Versuchung zur Rechthaberei wie gegen den Leidensdruck. Dafür hätte man freilich den ehrwürdigsten aller Ahnherren auf seiner Seite. Erasmus von Rotterdam, die überragende Leitfigur der neuzeitlichen Intellektuellen, als die Ralf Dahrendorf ihn unlängst gefeiert hat, ist ja zugleich der Prototyp ihrer katholischen Ausprägung – und dies, obwohl er der kirchlichen Tradition nie ganz geheuer war. Warum sollte man ihn nur dem Rekonstruktionsbedürfnis „des modernen liberalen Geistes“ überlassen? 29Ausgerechnet ihn, der für ein an der Vernunft, der Würde und Freiheit des Menschen orientiertes Humanitätsideal ebenso plädierte wie für dessen Unterfütterung durch christozentrische Frömmigkeit? Ihn, der „mehr Kritiker als Prophet“ sein wollte, doch daneben schreiben konnte, „was nur zum Lachen reizt“, und sich nicht allein in den knollennasigen Selbstkarikaturen am Rand seiner Briefe verspottete? Aus diesem augenzwinkernden Ernst müssen wir auch begreifen, was er 1526 in seinem „Hyperaspistes“ schrieb: „Von der katholischen Kirche bin ich nie abgefallen. (...) Man trägt die Übel leichter, die man gewohnt ist. Darum ertrage ich diese Kirche, bis ich eine bessere sehen werde, und sie ist wohl genötigt, auch mich zu ertragen, bis ich selbst besser geworden bin.“ 30So sollten der Intellektuelle und die Gemeinschaft seines Glaubens wechselseitig Geduld miteinander haben, auch wenn man sich nicht immer versteht.
„Anstößiges“, nichts Abschließendes
Tiefenschärfe wächst der Begriffsbildung von Intellektualität letztlich nicht durch Abstraktion zu, sondern nur vermöge ihrer jeweils individuellen Konkretisierungen. Darin besteht die Vermutung, die diesem Buch zugrunde liegt. In Porträts von Einzelnen versammelt es gleichsam Mosaiksteinchen, die zwar kein Ganzes ergeben mögen, aber in der Zusammenschau vielleicht doch manches deutlicher machen.
Der vorliegende Band handelt also von Menschen des Geistes und des Wortes, die ihrem (in wenigen Fällen auch nur temporären) religiösen Selbstverständnis entsprechend auf außergewöhnliche Weise in die Öffentlichkeit und in das katholische Bewusstsein hinein gewirkt haben. Es sind manchmal Vor-, manchmal Gegen-Denker, Leitfiguren und Außenseiter. Einige hätten wohl – oder haben tatsächlich – den Begriff des Intellektuellen für sich abgelehnt, weil sie ihn mit einer Normativität verbanden, die sie mit ihren eigenen Vorstellungen nicht in Einklang bringen konnten. Wie nun verstehen sich jene knapp vierzig Künstler, Wissenschaftler oder Publizisten, welche Themen greifen sie auf, welche Positionen beziehen sie? Eine Bestandsaufnahme wie die hier vorliegende gab es bisher noch nicht. Mit einem großen Panorama des Denkens und Streitens ermöglicht sie zugleich einen faszinierenden Gang durch die Geschichte des deutschen Katholizismus im „Jahrhundert der Intellektuellen“. 31
Von der Infragestellung und Durchbrechung milieumäßiger Enge bis hin zur Leuchtkraft neuer Formen einer kompakten Definition des Katholischen angesichts des wahrgenommenen Zustands der Moderne erstreckt sich der Bogen, der, in sich wiederum gebrochen, Wandlungen des Ausdrucks katholischer Intellektualität kenntlich macht.
Die Darstellung setzt ein auf dem Höhepunkt der das ganze 19. Jahrhundert hindurch mit wachsender Schärfe betriebenen Defensive gegenüber dem Geist einer von Aufklärung und Liberalität geprägten Zeit. Das selbst eingerichtete kulturelle Ghetto beginnt jedoch porös zu werden. Nach dem Zusammenbruch bisher gültiger Werte im Ersten Weltkrieg wächst dem Katholizismus im geistigen Spektrum der Weimarer Republik neue Attraktivität zu. Philosophische und literarische Strömungen zeugen davon, Neudeutungen christlicher Gehalte mit Hilfe von Denkformen der Phänomenologie, des Personalismus, der Wahrheit der Existenz. Was jedoch weithin bestehen bleibt, ist ein Misstrauen gegen die kantische „Revolution der Denkart“ 32und den modernen Historismus. Auch wenn vereinzelt zeitweilige Konvergenzen bestehen (oder man nicht zu den Verteidigern der Demokratie zählen mochte), sind es gerade katholische Intellektuelle, die aus ihrer Distanz zum Nationalsozialismus keinen Hehl machen. Teilweise mündet sie in die Inspiration und Unterstützung des Widerstands. Hoffnungen auf einen geistigen Wandel in der Nachkriegszeit werden vielfach enttäuscht. Mit der Unterstützung oder Gegnerschaft zu den Reformbestrebungen in den Jahrzehnten danach spätestens kommt es zur Ausdifferenzierung in zwei große – gewohnheitsmäßig verallgemeinernd als „progressiv“ und „konservativ“ bezeichnete – Strömungen, die seither fortbestehen, in sich jedoch alles andere als homogen sind. Aus dem Ende eines einheitlichen Milieus vermag katholisches Denken schließlich sehr unterschiedliche Schlussfolgerungen für das eigene Selbstbild zu ziehen.
So sähe vielleicht das Stenogramm der geistigen Topographie aus, die sich anhand der Beiträge entfaltet. Über die Zeiten hinweg Wiedererkennbares wird man in ihnen ebenso finden wie eher dem jeweiligen Anlass verhaftete Strömungen. Nicht selten erweist sich katholische Intellektualität als antizipatorisch. Beispielhaft sei nur auf die Rolle einer Annette Kolb bei der geistigen Überwindung des europäischen Bürgerkriegs verwiesen, oder auf das, was Joseph Bernhart über das Tier, was Carl Amery (dessen düster dringliches Spätwerk noch gar nicht bei uns angekommen ist) über unsere Verantwortlichkeit der Mitwelt gegenüber schrieben, als derlei noch nicht auf der Tagesordnung stand. Grundsätzlich ist vor allem ein Reichtum unverkennbar, der sich aus den diversen Variationen des Spannungsverhältnisses von Eigensinn und Bindung speist.
Читать дальше