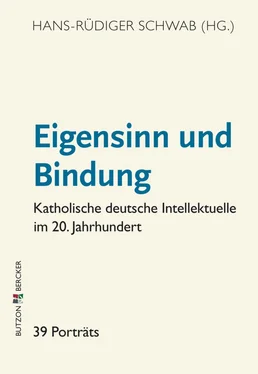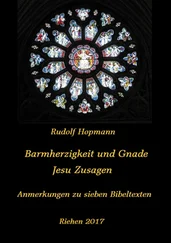Auch wenn es unterschiedliche Denkformen und Lehrtraditionen geben mag, unterschiedliche Stile und Ausformungen des kulturellen Gedächtnisses, teilweise auch der fortwirkenden Sozialisation, sollte man „eine vielleicht vorhandene Differenz“ sicher nicht „unangemessen fixieren und auf diese Weise zu einem Unterscheidungsmerkmal hochsteigern, das es in Wirklichkeit gar nicht ist“. 22So steht bei inhaltlichen Eigentümlichkeiten katholischer Intellektualität, die teilweise angeführt werden, 23am Ende, geht man den Spuren nur genau genug nach, oft ein interkonfessioneller Transfer. Dass es bis in die Gegenwart hinein fortbestehende Ressentiments gegenüber Protestanten auch bei katholischen Intellektuellen gibt, ist leider eine andere Sache.
Statt mehr oder weniger ergebnisarme Kultivierung historisch gewachsener Unterschiede zu betreiben, muss der katholische Intellektuelle seine Identität jedenfalls nicht konstruieren, indem er sich von anderen christlichen Bekenntnissen schroff abgrenzt. Es reicht, wenn er sich auf seine Traditionen – im Plural ausdrücklich! – beruft, und oft genug wird er die Entdeckung machen, dass das, was kontroverstheologisch überbetont wurde und wird, in schönster Nachbarschaft beieinander liegt. Ohnehin scheinen – wenigstens bei der jüngeren Generation – wirklich lebensprägende Differenzen längst nicht mehr zwischen Protestanten und Katholiken zu bestehen, sondern zwischen den christlich Ansprechbaren und den Gleichgültigen.
Katholisch-Sein als Heimat ohne vorschnelle Abgrenzung also. Religionen sind heute mit Recht vielen gerade deswegen suspekt, weil sie Mauern errichten, die Menschen voneinander trennen. Das katholische Prinzip ist demgegenüber das einer bisweilen paradoxen Koexistenz. Daher ist ihm implizit eine große Ökumene eingeschrieben, auf die gegen alle Erstarrungen und Verengungen in seinem Namen zu bestehen wäre.
Für eine besonnene Moderne
Dies alles ist natürlich nach innen gesprochen, mit Blick auf die Kirche, jenen der beiden Pole katholischer Intellektualität, der sich bei der Verteidigung des Eigensinns in der Bindung immer wieder als der konfliktträchtigere herausstellt. Der andere, eigentlich gewichtigere, befindet sich jenseits der Binnenperspektive (die im Übrigen oft Gefahr läuft, zur Nabelschau zu geraten) und wird durch die politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Wirklichkeiten der Gegenwart bezeichnet. Dort herrscht das Paradigma der vorangeschrittenen Moderne. Wenn es gilt, ihr Verhältnis zu diesem zu bestimmen, werden von katholischen Intellektuellen durchaus unterschiedliche Signale ausgesendet. Die extremsten Ausschläge bewegen sich zwischen der Fortschreibung entschiedener Gegnerschaft zur Moderne und einer Selbstsäkularisierung zugunsten von Fortschrittsdenken oder der Ethik einer Zivilreligion. Dazwischen gibt es zahllose Anschlussfähigkeiten und Problematisierungen im Detail, mag manches sich auch als transitär erweisen.
Bestehende Schwierigkeiten vieler Intellektueller mit dem kircheninternen Klima wiederholen sich auf dem anderen Feld in gewisser Weise. Die säkulare Gesellschaft ist keineswegs frei von Abwehrgesten einem Denken gegenüber, das religiös bezogen ist. Katholische Intellektuelle mögen somit zuweilen Fremdlinge im doppelten Sinne bleiben. Sie argumentieren quer zu den Linien. Daraus sich ergebende Gemengelagen sind niemals auf einen Nenner zu bringen.
Habituelle Schwermut bei manchen Vertretern katholischer Intellektualität verweist auf eine Versehrtheit, die eines der wertvollsten Zeugnisse dieses Typus darstellt. Es sind Tragiker, welche die Versöhnung mit der Realität verweigern und damit an ihre naturwüchsige Erlösungsbedürftigkeit erinnern: ein Befinden, welches die heutige Gesellschaft einigermaßen erfolgreich verdrängt hat. Auseinandersetzung mit ihnen bedeutet die Konfrontation mit möglichen Abgründen. Vielleicht sehen sie ja klarer als alle die Rhetoriker des Aufbruchs, von denen wir umzingelt sind, den Fitmachern für die Zukunft – was für einer eigentlich? – und der verordneten organisatorischen Optimierungen. In dieser Hinsicht sind sie nicht „konstruktiv“ oder „zielführend“. Gegen das, woran sie sich wundscheuern, hilft keine Reform.
Im geschichtlichen Prozess sieht der katholische Intellektuelle jedenfalls nicht selten Aporien, aus denen kein Entkommen ist. Er trägt sie aus, hält Zweifel offen, den Sinn für Verluste. Was seinesgleichen im Speziellen auszeichnen mag, ist eine Gebrochenheit, die mit dem Spätzeitlichen einhergeht, welcher der Versuch, am Glauben festzuhalten, eingebrannt bleibt, und die sich weder in das Konstrukt einer intakten Vergangenheit zurückschwindelt, noch forsch auf zeitgemäß trimmt.
Ein Gespür für Abwägung macht sich hier geltend, in dem die Vorzüge der Moderne zwar anerkannt, aber nicht zum Fetisch erhoben, sowie ihre Kehrseiten und Ver(w)irrungen, ihr Macht- und Kontrollanspruch nicht hingenommen werden. Als Ansatz katholischer Intellektueller bietet sich das Paradox der Modernisierung an, die eben nicht nur Pluralität und individuellen Freiheitszuwachs befördert, sondern auch Mechanismen der anonymen Steuerung, Domestizierung und Uniformierung. 24Mit dem gleichen Recht, mit dem etwa auf fortschreitende Wahlmöglichkeiten des Einzelnen hingewiesen wird, könnte man auch vom Zerfall des Individuums sprechen, von wachsenden Erfahrungen der Ohnmacht und Desorientierung.
Nun eignet der Moderne eine unangenehme Neigung, sich absolut zu setzen. Aufmerksam zu machen wäre demgegenüber auf die ihr inne wohnenden destruktiven Tendenzen. Der als alternativlos ausgegebene Kult der Geschwindigkeit und rastlosen Innovation etwa hat sich längst selbstzweckhaft verselbstständigt. Er führt zur permanenten Entwertung des Überlieferten oder Vorhandenen zugunsten der Attraktivität zukünftiger Optionen.
Eine der vornehmsten Aufgaben katholischer Intellektualität bestünde somit darin, Mangelerfahrungen im säkularen Kontext anzusprechen, den Stachel für dessen Inszenierungen, Torheiten und Gefahren wach zu halten, mögen diese sich auch als Systemzwänge tarnen. Hier eröffnet sich ein weites Feld. In einer Zeit vorgegebener Sprachregelungen erinnert der katholische Intellektuelle gern auch an vom Aussterben bedrohte Wörter, an Denkformen, die keinen Platz mehr haben in dem, was man „Diskurs“ nennt und oft nichts anderes meint als das, wonach man sich gefälligst zu richten hat, wenn man mitreden möchte. Gerade weil er gläubig zu sein versucht, bleibt er den innerweltlichen Verheißungen gegenüber skeptisch. Er widerspricht der Hegemonie eines naiven Bio-, Psycho- oder Soziozentrismus, einer Reduktion des Menschen, die parallel läuft zu dem Anspruch auf Verfügbarkeit über dessen Natur. Hingegen hält er fest an einer Vorstellung der menschlichen Person, die offen ist für die Transzendenz. Aufzuklären wäre das Selbstmissverständnis der Moderne, sie sei die Religion losgeworden. Noch in der Verweigerung hält sie, in Form von Surrogaten, vielmehr an ihr fest.
Eher kritisch verhält sich katholische Intellektualität angesichts einer alles zulassenden und nichts (oder wenig) mehr ernst nehmenden Gesellschaft. Andererseits speist sich aus dem Widerwillen dagegen manchmal auch eine über den Distinktionsgewinn verweigerter Zeitgenossenschaft weit hinausgehende Verlockung durch scheinbar geordnete Verhältnisse mit klaren Regeln, in denen die verantwortete menschliche Freiheit wenig gilt. Hier wird dann als Markenzeichen des Katholizismus vor allem das betont, was ihn von der säkularen Welt unterscheiden soll – Autorität und Gehorsam nicht zuletzt –, aufgrund dessen man ihn in klarer Gegnerschaft zu dieser aufstellen möchte, die angeblich durch Relativismus, Indifferentismus und liberalistische Dekadenz restlos verdorben sei. Ohnehin übt die Geschlossenheit von Dogmengebäuden als Garant einer intransingent kämpferischen Bollwerk-Kirche auf manche katholische Intellektuelle seit dem frühen 19. Jahrhundert eine größere Faszination aus als Person und Botschaft Jesu. Doch natürlich kann man keine ungebrochene Kontinuität behaupten (wollen) zwischen Zeiten, in denen allein der „Wahrheit“ Daseinsberechtigung zugestanden wurde, und solchen des Einverständnisses mit einem demokratischen Rechtsstaat, der unterschiedliche Überzeugungen schützt. Allein der Eindruck von Grauzonen in dieser Hinsicht wäre verheerend. Die große Mehrheit katholischer Intellektueller indes weiß, dass die Moderne nicht einfach eine Verfallsgeschichte beschreibt, sondern gerade den Religionen vielfache Möglichkeiten bietet, auch zum Bedenken in eigener Sache.
Читать дальше