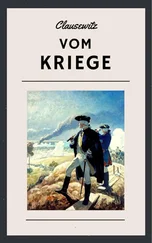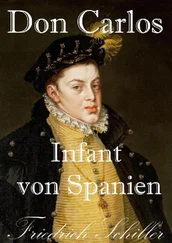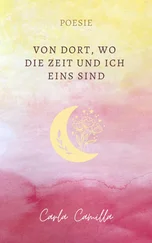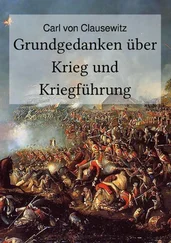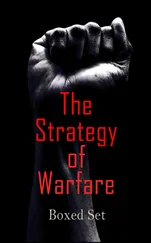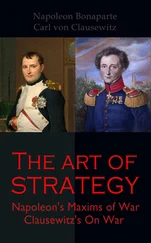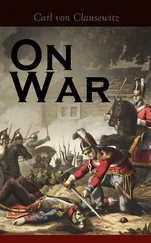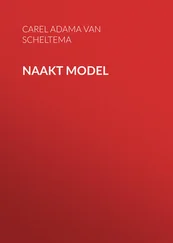Der Kraftaufwand des Gegners liegt in dem Verbrauch seiner Streitkräfte, also in der Zerstörung derselben von unserer Seite, in dem Verlust von Provinzen, also in der Eroberung derselben durch uns.
Daß diese beiden Gegenstände wegen der verschiedenen Bedeutung auch hier nicht allemal mit der gleichnamigen bei einem andern Zweck zusammenfallen, wird sich bei näherer Betrachtung von selbst ergeben. Daß die Unterschiede meistens nur gering sein werden, darf uns nicht irremachen, denn in der Wirklichkeit entscheiden oft bei schwachen Motiven die feinsten [57] Nuancen für die eine oder andere Modalität der Kraftanwendung. Uns kommt es hier nur darauf an, zu zeigen, daß unter Voraussetzung gewisser Bedingungen andere Wege zum Ziele möglich, kein innerer Widerspruch, kein Absurdum, auch nicht einmal Fehler sind.
Außer diesen beiden Gegenständen gibt es nun noch drei eigentümliche Wege, die unmittelbar darauf gerichtet sind, den Kraftaufwand des Gegners zu steigern. Der erste ist die Invasion, d. h. die Einnahme feindlicher Provinzen, nicht mit der Absicht, sie zu behalten, sondern um Kriegssteuern darin zu erheben, oder sie gar zu verwüsten. Der unmittelbare Zweck ist hier weder die Eroberung des feindlichen Landes, noch das Niederwerfen seiner Streitkraft, sondern bloß ganz allgemein der feindliche Schaden. Der zweite Weg ist, unsere Unternehmungen vorzugsweise auf solche Gegenstände zu richten, die den feindlichen Schaden vergrößern. Es ist nichts leichter, als sich zwei verschiedene Richtungen unserer Streitkraft zu denken, davon die eine bei weitem den Vorzug verdient, wenn es darauf ankommt, den Feind niederzuwerfen, die andere aber, wenn vom Niederwerfen nicht die Rede ist und sein kann, einträglicher ist. Wie man zu sagen gewohnt ist, würde man die erste für die mehr militärische, die andere mehr für eine politische halten. Wenn man sich aber auf den höchsten Standpunkt stellt, so ist eine so militärisch wie die andere, und jede nur zweckmäßig, wenn sie zu den gegebenen Bedingungen paßt. Der dritte Weg, an Umfang der ihm zugehörigen Fälle bei weitem der wichtigste, ist das Ermüden des Gegners. Wir wählen diesen Ausdruck nicht bloß, um das Objekt mit einem Worte zu bezeichnen, sondern weil er die Sache ganz ausdrückt und nicht so bildlich ist, als es auf den ersten Blick scheint. In dem Begriff des Ermüdens bei einem Kampfe liegt eine durch die Dauer der Handlung nach und nach hervorgebrachte Erschöpfung der physischen Kräfte und des Willens.
Wollen wir nun den Gegner in der Dauer des Kampfes überbieten, so müssen wir uns mit so kleinen Zwecken als möglich begnügen, denn es liegt in der Natur der Sache, daß ein großer Zweck mehr Kraftaufwand erfordert als ein kleiner; der kleinste Zweck aber, den wir uns vorsetzen können, ist der reine Widerstand, d. h. der Kampf ohne eine positive Absicht. Bei diesem werden also unsere Mittel verhältnismäßig am größten sein, und also das Resultat am meisten gesichert. Wie weit kann nun diese Negativität gehen? Offenbar nicht bis zur absoluten Passivität, denn ein bloßes Leiden wäre kein Kampf mehr; der Widerstand aber ist eine Tätigkeit, und durch diese sollen so viele von des Feindes Kräften zerstört werden, daß er seine Absicht aufgeben muß. Nur das wollen wir bei jedem einzelnen Akt, und darin besteht die negative Natur unserer Absicht.
Unstreitig ist diese negative Absicht in ihrem einzelnen Akt nicht so wirksam, wie eine in gleicher Richtung liegende positive sein würde, vorausgesetzt, daß sie gelinge; aber darin liegt eben der Unterschied, daß jene [58] eher gelingt, also mehr Sicherheit gibt. Was ihr nun an Wirksamkeit im einzelnen Akt abgeht, muß sie durch die Zeit, also durch die Dauer des Kampfes, wieder einbringen; und so ist denn diese negative Absicht, welche das Prinzip des reinen Widerstandes ausmacht, auch das natürliche Mittel, den Gegner in der Dauer des Kampfes zu überbieten, das ist: ihn zu ermüden.
Hier liegt der Ursprung des das ganze Gebiet des Krieges beherrschenden Unterschiedes von Angriff und Verteidigung. Wir können aber diesen Weg hier nicht weiter verfolgen, sondern begnügen, uns zu sagen, daß aus dieser negativen Absicht selbst alle die Vorteile, und so alle die stärkern Formen des Kampfes abgeleitet werden können, die ihr zur Seite stehen, und in welcher sich also dieses philosophisch-dynamische Gesetz, was zwischen Größe und Sicherheit des Erfolges besteht, verwirklicht. Wir werden dies alles in der Folge betrachten.
Gibt also die negative Absicht, d. h. die Vereinigung aller Mittel im bloßen Widerstand, eine Überlegenheit im Kampf: so wird, wenn diese so groß ist, um ein etwaiges Übergewicht des Gegners auszugleichen, die bloße Dauer des Kampfes hinreichen, um den Kraftaufwand beim Gegner nach und nach auf den Punkt zu bringen, daß ihm der politische Zweck desselben nicht mehr das Gleichgewicht halten kann, er ihn also aufgeben muß. Man sieht also, daß dieser Weg, die Ermüdung des Gegners, die große Anzahl von Fällen unter sich begreift, wo der Schwache dem Mächtigen widerstehen will.
Friedrich der Große wäre im Siebenjährigen Kriege niemals imstande gewesen, die österreichische Monarchie niederzuwerfen, und hätte er es in dem Sinne eines Carl XII. versuchen wollen, er würde unfehlbar zugrunde gegangen sein. Nachdem aber die talentvolle Anwendung einer weisen Ökonomie der Kräfte den gegen ihn verbündeten Mächten sieben Jahre lang gezeigt hatte, daß der Kraftaufwand viel größer werde, als sie sich anfangs vorgestellt hatten, beschlossen sie den Frieden.
Wir sehen also, daß es im Kriege der Wege zum Ziele viele gibt, daß nicht jeder Fall an die Niederwerfung des Gegners gebunden ist, daß Vernichtung der feindlichen Streitkraft, Eroberung feindlicher Provinzen, bloße Besetzung derselben, bloße Invasion derselben, Unternehmungen, die unmittelbar auf politische Beziehungen gerichtet sind, endlich ein passives Abwarten der feindlichen Stöße - alles Mittel sind, die, jedes für sich, zur Überwindung des feindlichen Willens gebraucht werden können, je nachdem die Eigentümlichkeit des Falles mehr von dem einen oder dem andern erwarten läßt. Wir können noch eine ganze Klasse von Zwecken als kürzere Wege zum Ziele hinzufügen, die wir Argumente ad hominem nennen könnten. In welchem Gebiete menschlichen Verkehrs kämen diese alle sächlichen Verhältnisse überspringenden Funken der persönlichen Beziehungen nicht vor, und im Kriege, wo die Persönlichkeit der Kämpfer, [59] im Kabinett und Felde, eine so große Rolle spielt, können sie wohl am wenigsten fehlen. Wir begnügen uns, darauf hinzudeuten, weil es eine Pedanterie wäre, sie in Klassen bringen zu wollen. Mit diesen, kann man wohl sagen, wächst die Zahl der möglichen Wege zum Ziel bis ins Unendliche.
Um diese verschiedenen kürzeren Wege zum Ziel nicht unter ihrem Wert zu schätzen, sie entweder nur als seltene Ausnahmen gelten zu lassen, oder den Unterschied, den sie in der Kriegführung bedingen, für unwesentlich zu halten, muß man sich nur der Mannigfaltigkeit der politischen Zwecke bewußt werden, die einen Krieg veranlassen können, oder mit einem Blick den Abstand messen, der zwischen einem Vernichtungskriege um das politische Dasein und einem Kriege stattfindet, den ein erzwungenes oder hinfällig gewordenes Bündnis zur unangenehmen Pflicht macht. Zwischen beiden gibt es zahllose Abstufungen, die in der Wirklichkeit vorkommen. Mit eben dem Recht, womit man eine dieser Abstufungen in der Theorie verwerfen wollte, könnte man sie alle verwerfen, d. h. die wirkliche Welt ganz aus den Augen setzen.
So ist es im allgemeinen mit dem Ziel beschaffen, welches man im Kriege zu verfolgen hat; wenden wir uns jetzt zu den Mitteln.
Dieser Mittel gibt es nur ein einziges: es ist der Kampf. Wie mannigfaltig dieser auch gestaltet sei, wie weit er sich von der rohen Erledigung des Hasses und der Feindschaft im Faustkampfe entfernen möge, wieviel Dinge sich einschieben mögen, die nicht selbst Kampf sind, immer liegt es im Begriff des Krieges, daß alle in ihm erscheinenden Wirkungen ursprünglich vom Kampf ausgehen müssen.
Читать дальше