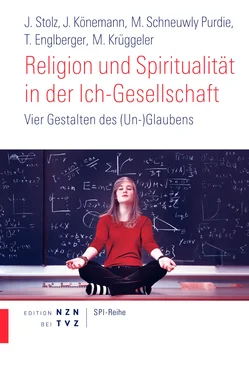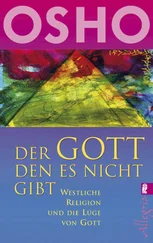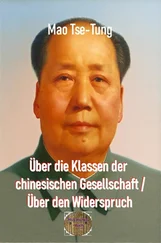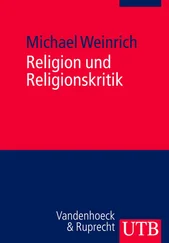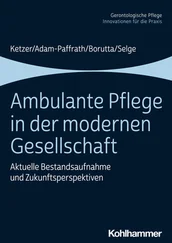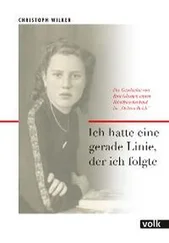H3 Übergang zur Ich-Gesellschaft und Geschlecht. Männer und Frauen sollten sich in verschiedener Hinsicht deutlich unterscheiden. Vor 1940 geborene Personen sollten noch von stark unterschiedlicher religiöser Sozialisierung für Jungen und Mädchen berichten. Die Frauen dieser Generationen sollten auch noch deutlich religiöser sein als die Männer. Zwischen 1940 und 1970 geborene Frauen sollten in erhöhtem Masse von einer Befreiung aus traditionellen religiösen Denkmustern und z. T. von Versuchen innerhalb der alternativen Spiritualität berichten. Bei Jahrgängen nach 1970 sollte |62| sich eine Angleichung in religiöser Hinsicht zwischen den Geschlechtern bemerkbar machen.
H4 Übergang zur Ich-Gesellschaft und Stadt/Land. Die Unterschiede zwischen Stadt und Land sollten sich in religiöser Hinsicht zunächst vergrössern, da der Übergang zur Ich-Gesellschaft (bzw. zum neuen Konkurrenzregime) in den Städten beginnt. In dem Mass, wie der neue Lebensstil sich von der Stadt aufs Land ausbreitet, sollten sich die Unterschiede wieder verringern.
H5 Säkulares Driften. Die Individuen sollten ein säkulares Driften zeigen, d. h., sie sollten – im Durchschnitt – weniger religiös werden. Dies, weil die Individuen seit den 1960er Jahren sehen, dass sie zu Religion nicht mehr gezwungen sind, dass sie viele Ressourcen und sehr viele säkulare Optionen haben und dass sie ihre Bedürfnisse ihrer Ansicht nach oft besser mit säkularen Institutionen befriedigen können. Säkulares Driften sollte insbesondere zwischen Generationen zu beobachten sein, da Religiosität und Spiritualität stark durch Sozialisierung beeinflusst werden und jede neue Generation in einer noch stärker durch säkulare Alternativen gekennzeichneten Welt aufwächst.
H6 Individualisierung und Konsumorientierung. Über die ganze Gesellschaft hinweg sollte in den letzten Jahrzehnten eine Zunahme der Individualisierung und Konsumorientierung zu beobachten sein, d. h., dass die Individuen zunehmend der Meinung sind, sie könnten und müssten in religiösen/säkularen Fragen selbst entscheiden und zunehmend die Optionen wählen, die ihnen subjektiv den grössten «Nutzen» oder die grösste «Befriedigung» verschaffen.
H7 Unterschiedliches Wachstum und Schrumpfen von Grossgruppen. Grossgruppen mit traditionell-christlicher Religiosität sollten schrumpfen; Grossgruppen mit distanzierter Religiosität und säkularen Ansichten sollten wachsen. Eine Grossgruppe mit alternativer Spiritualität sollte ab den 70er Jahren zu beobachten sein. Diese Hypothese setzt eine genauere Beschreibung der Grossgruppen voraus, was Gegenstand der Kapitel 3 bis 8 sein wird. |63|
Da unsere Untersuchung vor allem Daten über Individuen erhoben hat, können wir die aus unserer Theorie folgenden Hypothesen zu den religiösen und spirituellen Anbietern nur zum Teil und nur indirekt (v. a. in den Kapiteln 7, 8 und 9) prüfen. Wiederum fragen wir, was empirisch zu beobachten sein müsste, wenn unsere theoretische Beschreibung richtig sein sollte.
H8 Religiöses Marketing. Die Kirchen und religiösen Gemeinschaften sollten zunehmend religiöses Marketing einsetzen. Da sie bemerken, dass die Individuen nicht mehr Mitglieder sein müssen und es keine Religiosität sanktionierenden Normen mehr gibt, sind die Anbieter gezwungen, sich auf die Bedürfnisse der Individuen einzustellen. Hierfür werden sie vermehrt versuchen, die gleichen Techniken einzusetzen wie andere Organisationen (Marktforschung, Befragung, Milieustudien, Qualitätssicherung, Diversifizierung, Konzentration auf ein Kernprodukt, Werbung usw.)
H9 Megachurches und Fusionen. Um im Konkurrenzkampf vor allem mit den säkularen Anbietern bestehen zu können, werden viele Anbieter versuchen, eine kritische Grösse zu erreichen. Dies kann entweder durch das Anstreben einer Megachurch oder durch Fusionen von bestehenden Gemeinden geschehen.
H10 Akkomodierung vs. Abschliessung. Wollen die Anbieter viele Menschen ansprechen (z. B. «Volkskirchen» bleiben), so werden sie sich auf die Werte und Moralvorstellungen des neuen Konkurrenzregimes einstellen und diese langfristig übernehmen. Sie werden also die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte, Gleichberechtigung von Mann und Frau usw. betonen. Ferner werden sie vom Versuch ablassen, das Verhalten und die moralischen Vorstellungen ihrer Mitglieder zu kontrollieren. Elemente der Ideologie von Anbietern, die nicht dem neuen Konkurrenzregime entsprechen, werden in der Gesellschaft als hochgradig illegitim erscheinen. Sind Anbieter nicht bereit, sich akkomodierend an das neue Konkurrenzregime anzupassen, so werden sie eine Form von sozialer Abschliessung verwenden müssen. Durch die Schaffung von geschlossenen Milieus oder sozialen Gruppen mit klaren Grenzen müssen sie ihre Mitglieder so stark abschotten, dass die Kritik von aussen den Mitgliedern nichts oder wenig anhaben kann.
***
Soweit die Darstellung der Theorie und der aus ihr folgenden Hypothesen. Wer die Literatur kennt, wird bemerkt haben, dass die meisten der hier vertretenen Ideen nicht neu sind. Wir nehmen aber doch in Anspruch, eine neuartige Systematisierung vorzulegen, die in allgemeiner Weise aufzeigt, wie religiös-säkulare |64| Konkurrenz – in Verbindung mit anderen Faktoren – verschiedenste religiöse Phänomene erklären kann. Im Vergleich zu den bisher vorgestellten Theorien weist diese Theorie wie schon erwähnt verschiedene Vorteile auf. Indem sie den Beitrag der (individuellen und kollektiven) Akteure würdigt und die kausalen Mechanismen des Geschehens benennt, ist sie nicht nur beschreibend, sondern auch erklärend. Sie bleibt, mit anderen Worten, nicht bei einer Angabe beschreibender Etiketten wie «Säkularisierung», «Differenzierung», «Rationalisierung» oder «Individualisierung» stehen, sondern führt diese Prozesse auf wenige erklärende Grundmechanismen zurück. Gegenüber der Markttheorie liegt der Vorteil darin, dass intra-religiöse Konkurrenz als ein Spezialfall unter vielen anderen Möglichkeiten erkannt wird. Ausserdem ist die Theorie in der Lage, sowohl den säkularisierenden Makro-Trend als auch historische und geografische Unterschiede zu erklären. Sie erlaubt es, an den verschiedensten Punkten gewissermassen «in die Geschichte einzusteigen», um von dort aus die nächsten Etappen einsichtig zu machen.
Durch wie viel Evidenz wird aber diese Theorie gestützt? Dieser Frage widmen sich alle weiteren Kapitel. Die Kapitel 3–8 werden zunächst die Grossgruppen quantitativ und qualitativ beschreiben. Das Kapitel 9 wird dann die Erklärungsfrage wieder aufnehmen und zeigen, ob und wie diese Hypothesen empirisch verifiziert werden können. |65|
.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.