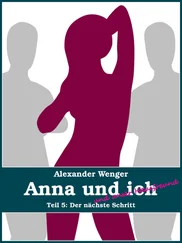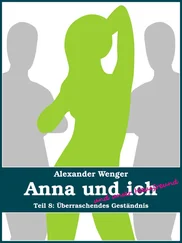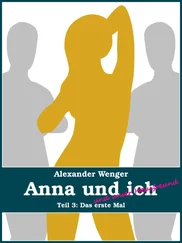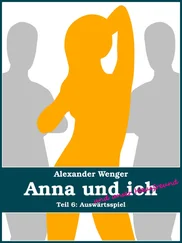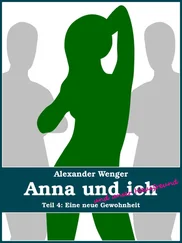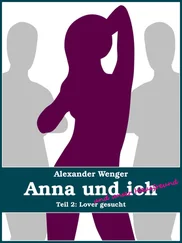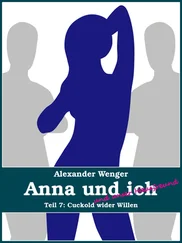Da hat er umsonst gerufen, der große Tübinger Alttestamentler Fridolin Stier, der die Schrift so ursprachlich übersetzt hat, „Der Mensch vom Weib geboren, / an Tagen kurz und unrastsatt –“ (Hiob 14,1) 50. Ein Karl Kraus redivivus würde sich in kirchlichen Kreisen mehr als die Finger verbrennen.
Mit ihrem Hang zur ganzen Länge ziehen sich evangelische Kirchenlieder Probleme zu, die sich die katholischen durch großzügiges Strophenstreichen schlicht ersparen. So fehlt in der auf drei Strophen zurückgebrachten „Gotteslob-Fassung“ des Morgenliedes „Aus meines Herzensgrunde“ (Nr. 669) eine Strophe, die beim jüngsten Übergang vom Evangelischen Kirchengesangbuch (EKG) zum Evangelischen Gesangbuch (EG) den zuständigen Gesangbuchmachern etwas Kopfzerbrechen bereitete. Um das beliebte Lied zu halten, wurde eine kleine Ausbesserung für erforderlich gehalten. Die neue Fassung von EG Nr. 443, 4. Strophe, lautet nun:
„Mein’ Leib und meine Seele, Gemahl, Gut, Ehr und Kind in dein Händ ich befehle und die mir nahe sind als dein Geschenk und Gab, mein Eltern und Verwandten, mein Freunde und Bekannten und alles, was ich hab.“
Was sich geändert hat, ergibt sich aus dem Vergleich mit der vorangegangenen Version des EKG (Nr. 341):
„Mein’ Leib und meine Seele, mein Weib, Gut, Ehr und Kind in dein Händ ich befehle, dazu mein Hausgesind, als dein Geschenk und Gab, mein Eltern und Verwandten, mein Freunde und Bekannten und alles, was ich hab.“
Das ordinäre „Weib“ ist herausgeflogen und hat dem Herrn „Gemahl“ (nicht etwa der Frau Gemahlin) Platz gemacht. Und das „Hausgesind“ wurde ausgewechselt gegen „die mir nahe sind“. Die Absicht ist klar. „Weib“ und „Hausgesind“ gelten als linguistische Indikatoren patriarchalicher Verhältnisse, die aus der Sprache wie aus der gesellschaftlichen Realität zu tilgen sind. Der Fall ist symptomatisch und gibt im Ergebnis doch zu denken. „Weib“ wurde schon vor Jahren im katholischen „Ave Maria“ gegen „Frau“ ausgetauscht, aber das ging hier offenbar nicht. Mit dem bürgerlich gestelzten „Gemahl“ ist man jedoch, rein sozialsprachgeschichtlich gesehen, vom Regen in die Traufe gekommen.
Der Verzicht aufs „Hausgesind“ ist löblich, nimmt jedoch eine soziale Komponente des Morgengebets ins Intim-Private („die mir nahe sind“, womit die „Eltern und Bekannten“, „Freunde und Verwandten“ schon vorweggenommen wären) zurück. Wenn der fromme Haupt- und Amtmann Georg Niege (1525 – 1588), der Verfasser des Liedes, morgens fürs „Hausgesind“ betete und beten ließ, legte er Gott nicht nur sich selbst, sondern auch die ihm so oder so in seinem „Beruf und Stand“ (Str. 7) Untergebenen ans Herz; betrachtete sie und behandelte sie dann vielleicht auch „als dein Geschenk und Gab“, ihm auf Zeit anvertraut; von Diskriminierung jedenfalls keine Spur. Mit der Streichung des „Hausgesinds“ verschwindet die Ökonomie aus dem Gebet, in der alle (nicht bloß ominöse Hausherren) auch heute von der Dienstleistung anderer leben, unsichtbarer vielleicht, aber nicht weniger real als zu den Zeiten des bäuerlich-bürgerlichen Gesindes.
Die Zensoren der alten Texte denken hier, wie häufig, nicht weit genug. Sie flicken an der Textoberfläche, ohne der Sache auf den Grund zu gehen. Darum sind sie dann auch nicht radikal und konsequent genug. Wenn man „Weib“ und „Hausgesind“ für nicht mehr zumutbar hält, wie kann man „Gut, Ehr und Kind“ dann den Nicht-Begüterten, Unverheirateten, Kinderlosen, ja den Kindern selbst zum Singen zumuten?
Mit den kleinen Reparaturen an der Textfassade lässt sich nicht vertuschen, dass das Lied in der Rolle des Hausvaters geschrieben ist, insoweit also patriarchalische Verhältnisse spiegelt. Aber Vater Niege kehrt nicht seine Männlichkeit heraus, oder seine unumschränkte Befehlsgewalt über Weib und Kind und Hausgesind. Er sorgt sich in der Morgenfrühe um das gesamte Hauswesen, dem er vorsteht. Und dieser Gemeinsinn gibt dem Gebet eine lebenspraktische Note, die man in ähnlicher Weise auch im monastischen Stundengebet der Prim findet, „nach der im Kloster die Arbeit verteilt wurde: körperliche Arbeit, Schreiben der Codices, Arbeit in der Klosterschule usw.“ 51So endet auch Georg Nieges Morgenlied: „und streck nun aus mein Hand, / greif an das Werk mit Freuden, / dazu mich Gott beschieden / in meim Beruf und Stand.“ Berufsethos und Frömmigkeit sind hier eng verbunden.
Die Besonderheit der sozialen Situation muss nicht verschleiert werden, es geht im Gebet nicht um die Verhältnisse, sondern um das Verhältnis zu den Verhältnissen. Das ist, wenn man das Lied auf seine eigene Stimme übernimmt („Aus meines Herzensgrunde“), zu transponieren „in meim Beruf und Stand“.
So muss das Fremde der Überlieferung nicht einfach nur hinter uns liegen, vom sozialen Fortschritt überholt, es kann uns, recht bedacht, auch voraus sein. Schneidet man es zurück auf den Meinungsstandard der eigenen Zeit, bleibt man auf dessen Maß beschränkt.
Der große Wiener Poet Ernst Jandl hat viele Gedichte verfasst, die man nicht verstehen kann, wenn man nicht auch Religion im Ohr hat, z. B. das folgende, etwas leichtfüßige Lautgedicht 52:
hosi
anna
maria
magdalena
hosi
hosianna
hosimaria
hosimagdalena
hosinas
hosiannanas
hosimarianas
hosimagdalenanas
Man kann das überhaupt nicht verstehen, wenn man nicht das Sanctus der Messe im Kopf hat, und dazu noch, dass Anna, Maria und Maria Magdalena drei wichtige, in der Bibel in einem Zusammenhang stehende Frauen sind. Aber worauf es hier ankommt, ist das kunstvolle Spiel mit den Assonanzen der Sprache, aus denen ganz neue Kreationen hervorgehen. Ich habe das Gedicht hier herangezogen, um auf eine Ebene aufmerksam zu machen, die über dem großen Bemühen der theologischen Sprachproduktion, alles verständlich zu machen, in den vergangenen Jahrzehnten etwas vernachlässigt wurde: die Musikalität der Sprache, ihr Rhythmus und Klang.
Ich will es an zwei, zugegebenermaßen etwas riskanten Beispielen verdeutlichen. Zunächst, von Jandls hosi angeregt, das Sanctus der Messe. Die heutige Fassung lautet bekanntermaßen: „Heilig, heilig, heilig, Gott, Herr aller Mächte und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe …“ Vor 1975 liturgisch Sozialisierte haben vielleicht noch diese Fassung im Ohr: „Heilig, heilig, heilig. Herr Gott der Heerscharen. Himmel und Erde sind erfüllt von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.“
Der aus dem Alten Testament als Gottesname vertraute „Herr Gott der Heerscharen“ ist ersetzt durch den „aller Mächte und Gewalten“. Die für die alttestamentliche Gottesprädikation nicht unwichtigen zebaoth , die das lateinische Sanctus, im Gefolge der Septuaginta noch im hebräischen Wortlaut transliteriert als Sabaoth aufbewahrt hatte, sind in die neutestamentlichen „Mächte und Gewalten“ umgewandelt, die dominationes und potestates , von denen in manchen Präfationen ja schon vorher die Rede ist. Die semantische Neuerung hatte also einen gewissen Sinn, auch wenn man damit eine wichtige Assoziation zum alttestamentlichen Herkunftstext des Sanctus (Jes 6) opferte und mit dem für die „Heerscharen“ einbestellten Ersatzkommando der „Mächte und Gewalten“ vielleicht nicht ganz so, wie vielleicht erhofft, befürchteten militärischen Konnotationen entkommt.
Was aber vermutlich bei der Sinn-Operation gar keine Rolle gespielt hat, ist die rhythmische und phonetische Struktur, die dem alten Text eignet. Das anlautende „H“ beherrscht die erste Zeile und dann jeweils das erste und letzte Wort der einzelnen Verse – eine Art Hauchhymnus: „Heilig, heilig, heilig, Herr Gott der Heerscharen. Himmel und Erde sind erfüllt von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.“ Diesen Atem kann das „Herr Gott aller Mächte und Gewalten. Erfüllt sind … usw.“ einfach nicht halten.
Читать дальше