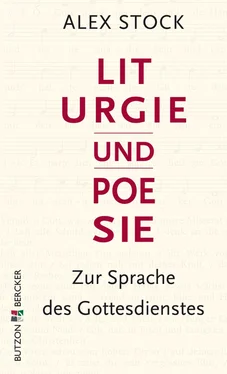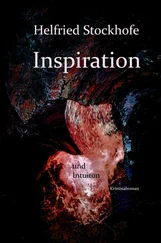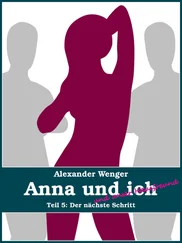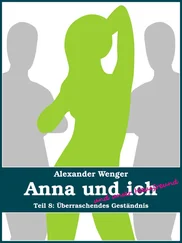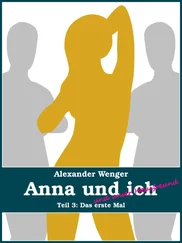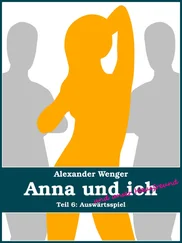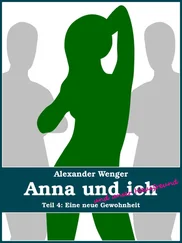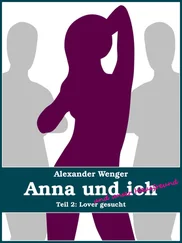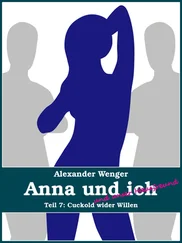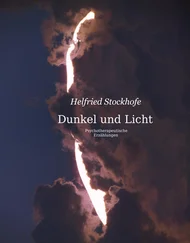„Wir stehen hier in Einigkeit, dem Herrgott hingegeben, wie Engel seinem Dienst geweiht, Soldaten für das Leben. Nun wehe, Banner, allezeit, und führe du im Kriege für Gottes große Herrlichkeit sein Kreuz zu seinem Siege!“
Natürlich ist es des Satans Macht, gegen die hier der Feldgesang angestimmt wird, aber wo der Feind konkret steht, dass man so stark zu singen hat, wird nicht mit Ross und Reiter beim Namen genannt. Ob es 1934 – ein Jahr nach dem Reichskonkordat – schon die Nazis sind oder der atheistische Bolschewismus im Osten, oder einfach die antichristlichen Weltanschauungen, der Liberalismus, Sozialismus, jedenfalls: „Kommt her, des Königs Aufgebot, die seine Fahne fassen.“ 63Weil der Feind nicht genau benannt wird, singt man im Zustand einer permanenten Mobilmachung.
Das „Kirchenlied“ ist nach dem Zweiten Weltkrieg unverändert nachgedruckt worden. Und wir haben als Jugendliche in den fünfziger Jahren mit Bannern und Fackeln gesungen: „Unüberwindlich starker Held, Sankt Michael“, mehr oder minder diffus den Feind unseres katholischen Milieus ahnend. Dieses Lied gehört, von seinem gegenreformatorischen Ursprung wie von der kontextuellen Rezeption in den dreißiger Jahren her gesehen, in einen religionspolitischen Zusammenhang. In den für den Gebrauch des „Gotteslob“ am Anfang der siebziger Jahre gestrichenen beiden Strophen ist das nicht zu übersehen. Aber auch ohne sie ist das Lied dem „Thema des geistigen Kampfes“, sofern man darunter die Spiritualität des geistlichen Kampfes der einzelnen Seele versteht, nicht unterzuordnen. Das hätten die Autoren des „Gotteslob“, die lebensgeschichtlich dem „Kirchenlied“ von 1938 ja nicht allzu fern standen, doch auch sehen können. Warum haben sie es durch Amputationen zu retten gesucht? Aus Anhänglichkeit an das „kraftvolle“ und „herbe“ Liedgut ihrer Jugendjahre? Der Redaktionsbericht deutet selbst einmal an, dass „das Liedgut der Kindheit meist normierend wirkt.“ 64Oder weil man aus theologischem Systemzwang die thematische Rubrik „Engel“ besetzen musste und einem nichts besseres einfiel, als was seit Jugendtagen mit so viel emotionalen Konnotationen besetzt war, ohne viele Gedanken darüber, wo denn im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts solche Michaelsfrömmigkeit im christlichen Bewusstsein ernsthaft unterzubringen sei?
Das Lied wäre nur zu retten, wenn man seine Mentalität nicht durch kleine Korrekturen verschleierte, sondern dazu stehen und sich und andere weiter in sie hinein singen möchte. Da dies die Überarbeiter aber offenbar nicht geradewegs wollen, ist aus dem Ganzen ein Flickwerk geworden, das man besser aufgäbe. Es tut mir Leid um das „Dämpfen der Feinde“, das also mein poetisch-politisches Privatvergnügen bleiben wird. Es tut mir auch Leid um Friedrich Spee, den Dichter des Liedes, der bei allem jesuitisch-gegenreformatorischen Kampfgeist doch ein so großer Poet und Menschenrechtler dazu ist.
Bei Y. Bonnefoy heißt es einmal: „Die Poesie: das Gestrüpp entfernen von dem oder jenem Wort, zu dem man, zufällig, einen Zugang gefunden hat: wie man das Wasser erklingen hört unter dem Schutt und den hohen Kräutern, man kehrt dann zurück dorthin, und legt eine Quelle frei.“ 65„Um das Empfinden des Lebens wiederherzustellen und die Dinge zu fühlen, um den Stein steinern zu machen, existiert das, was man Kunst nennt. Ziel der Kunst ist es, ein Empfinden des Gegenstandes zu vermitteln, als Sehen, und nicht als Wiedererkennen.“ 66„Gott, Innen des Worts, Atem. Wer das Wort handhabt, ist Gott näher, hat also die Pflicht, das Wort zu achten, weil es den Atem trägt, anstatt ihn zu verbergen, ihn erstarren oder verlöschen zu lassen“ 67, hat Philippe Jaccottet geschrieben. Die Lektüre von Gedichten, das aufmerksame Lesen und Bedenken kann dazu führen, dass man sie auch öffentlich einmal verwendet, in der Liturgie oder Katechese. Ebenso wichtig aber ist, dass sie als eine Art Sensorium und Kriterium fungieren für den theologischen Umgang mit der Sprache.
Nehmen wir ein Gedicht der österreichischen Dichterin Friederike Mayröcker, die 1924 in Wien geboren wurde; es ist 1966 in dem Band „Tod durch Musen“ 68erschienen.
WIRD WELKEN WIE GRAS
AUCH MEINE HAND UND DIE PUPILLE
wird welken wie Gras · mein Fusz und mein Haar mein stillstes Wort wird welken wie Gras · dein Mund dein Mund wird welken wie Gras · dein Schauen in mich wird welken wie Gras · meine Wange meine Wange und die kleine Blume die du dort weiszt wird welken wie Gras wird welken wie Gras · dein Mund dein purpurfarbener Mund wird welken wie Gras · aber die Nacht aber der Nebel aber die Fülle wird welken wie Gras wird welken wie Gras
„wird welken wie Gras“ – das ist biblischer Ton. Ps 90,5 f. heißt es von den Menschenkindern: „Sie sind wie das sprossende Gras: am Morgen erblüht es und sprosst, am Abend welkt es und verdorrt.“ Ps 103,15: „Des Menschen Tage sind wie das Gras, er blüht wie die Blume des Feldes; wenn der Wind darüber geht, so ist sie dahin.“ Und Jes 40,6 f. setzt der Prophet dem Aufruf zur Predigt den Einwurf entgegen: „Was soll ich rufen? Alles Fleisch ist ja Gras und all seine Pracht wie die Blume des Feldes. Das Gras verdorrt, und die Blume welkt, wenn der Hauch des Herrn darüber weht“. Er erhält die Antwort: „Ja, das Volk ist wie Gras, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit“ (V 8).
Ich wollte nachsehen, wo diese Verse vorkommen in der Liturgie. Ich fand: als Lesung für den zweiten Adventssonntag im Lesejahr B war Jes 40,1 – 11 vorgesehen. Aber, gerade diese Verse 6 – 8, haarscharf diese Verse, hatten die liturgischen Redakteure aus dem Text herausgeschnitten. Vielleicht passten sie ihnen nicht in die gewünschte adventlich-tröstliche Haupttonart; vielleicht hatte ein beteiligter Exeget redaktionskritische Bedenken – wer weiß.
Den Vers, den die Liturgiebauleute verwarfen, gerade ihn, hat weit außerhalb des theologischen Feldes eine Frau aufgehoben und ihn zum Eckstein und Kehrvers eines Gedichts gemacht. Sie hat sich eingemischt in die biblische Überlieferung. Es ist kein Kommentar zur Stelle, keine gereimte Exegese. Dieser Vers, dieser Vers allein hat es ihr angetan. Sie schrieb mir, dass sie dieses Gedicht nach einer Aufführung von Johannes Brahms’ „Ein deutsches Requiem“ geschrieben hat, dessen zweiter Satz ja diesen Bibelvers zum Zentrum hat.
„wird welken wie Gras“ – Der Vers kehrt wieder und wieder, neunmal, in litaneiartiger Intensität, weil „alles Fleisch“ ausdenkend beim Wort genommen wird, also auch mein Fleisch, dein Fleisch, also auch meine Hand und die Pupille und dein Mund, dein purpurfarbener Mund. Eins ums andere blüht auf und wird eingeholt von dem unentrinnbaren Refrain mit der dreimaligen Assonanz: „wird welken wie Gras“. Beim Wort nehmen heißt sinnlich denken. So ist aus dem biblischen Vers eine Weise von Liebe und Tod geworden, die an diesem, „deinem“, „meinem“ Leib aufeinandertreffen.
Im Lesen eines solchen Gedichts können wir in unserer Einbildungskraft an Erfahrungen Anteil nehmen, die wir in der eigenen leiblichen Realität vielleicht nicht, vielleicht niemals machen. Aber indem unsere Erfahrungen (Erinnerungen, Erwartungen) sich mit den im Gedicht niedergeschriebenen zu unterhalten beginnen, wird unsere Anteilnahme an der Welt gestärkt. Sympathie in diesem Sinne ist eine für Theologen wichtige und zugleich merkwürdig schwierige Tugend. Dass sie schwierig ist, ist vielleicht die Kehrseite jener ungeheuren Affirmation des Kerygmas von Tod und Auferstehung, dieser Glaubensgewissheit, die alles, komme, was wolle, immer schon überstrahlt und aufgefangen hat.
Ehe ein Gedicht wie dies ganz hat gegenwärtig werden können, ist der glaubenssichere Leser längst darüber hinaus: „wird welken, wie Gras.“ Ja, aber das Wort unseres Gottes bleibt, und die Auferstehung der Toten kommt. Weil nicht nur Dickfelligkeit und Hartherzigkeit, sondern auch der sichere Glaube selbst Ursache einer eigentümlichen Anästhese sein kann, darum hat Poesie, die auf Erschütterung zielt, bei gläubigen Theologen keinen leichten Stand. Was ein Requiem sein könnte, wird schon als Auferstehungsamt gefeiert.
Читать дальше