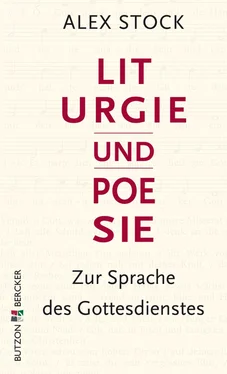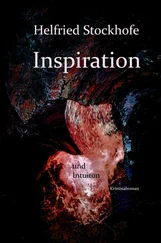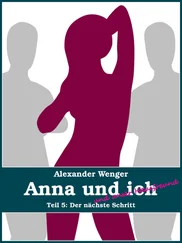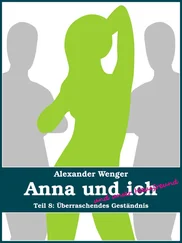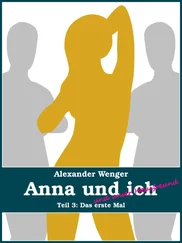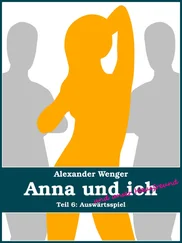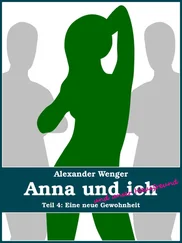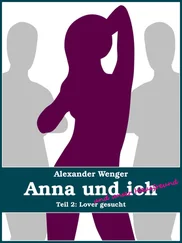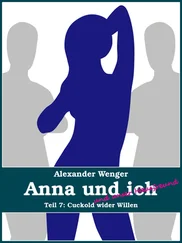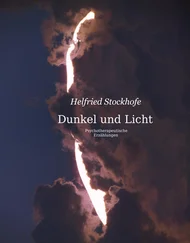Die neue Fassung soll angeblich „die Morgensituation des modernen Menschen berücksichtigen“ 46, das Werkbuch zum Gotteslob erläutert: „dabei wurde dringend gefordert, in den Morgenliedern nicht nur vom fröhlichen Erwachen zu sprechen, sondern auch die Situation des modernen Menschen zu berücksichtigen, der vielfach bedrängt und bedrückt den Belastungen des neuen Tages entgegengeht.“ 47Als ob Knorr von Rosenroth einfach vom „fröhlichen Erwachen“ spräche und von den Nöten des Tagesanfangs keinen Schimmer hätte. Das Urteil verrät die oberflächliche Lektüre. Der poetisch-theologische Erfolg der daraus erwachsenen Totaloperation lässt sich aber wohl auf die Kriegskassendevise aus dem ersten Weltkrieg bringen: „Gold gab ich für Eisen.“
Dieses Verdikt ist keineswegs zu verstehen als nostalgische Aversion gegen modernes Liedgut, nur, jene drei neuen Strophen sind eben gar nicht modern. In neuer Fassung lautet die zweite Strophe:
„Such uns heim mit deiner Kraft, o du Aufgang aus der Höhe, dass der Sünde bittre Haft und des Zweifels Not vergehe. Gib uns Trost und Zuversicht durch dein Licht.“
Was ist daran moderner, morgenrealistischer, verständlicher als die zweite Strophe bei Knorr von Rosenroth:
„Deiner Güte Morgentau fall auf unser matt Gewissen; lass die dürre Lebens-Au lauter süßen Trost genießen und erquick uns, deine Schar, immerdar.“
Knorr dichtet die morgendliche Seelenlage des Menschen sympathetisch mit der Natur als „Lebens-Au“, die in ihrer Gewissensmattigkeit auf erquickenden Frühtau wartet. Thurmair dichtet in losem Anschluss an Lk 1,78 von der Heimsuchung durch eine Kraft, die eine bittere Haft vergehen macht, ohne dass sich in solchem Reimwerk ein einleuchtendes oder gar belebendes Bild einstellt. Es ist angefertigt, aber ohne Inspiration, ohne inspirierende Imagination.
Ich habe meine Überlegungen zu Kriterien des katholischen Kirchenlieds an wenigen Beispielen entwickelt, an strittigen Fällen. Es geht nicht um das Lob der guten alten Lieder. Es gibt durchaus, z. B. von Huub Oosterhuis, moderne Lieder, die in der Modernität das poetisch-theologische Niveau der alten halten und sich im Gemeindegesang bewährt haben. Das Lied „Licht, dat ons anstoot in de morgen“ / „Licht, das uns anstößt früh am Morgen“ 48wäre z. B. ein ernsthafter Kandidat in der Abteilung Morgenlieder. Ein Feind der Poesie wie der Frömmigkeit ist aber das beschränkte Schulmeistern einer großen Tradition, die, wenn wir bescheiden genug sind, uns mitziehen und erheben kann, weil sie uns voraus ist. Das aber verlangt, dass man sich ihr mit gebotener Sorgfalt zuwendet.
Die Qualität eines Kirchenliedes ist ein komplexes Ding. Die poetisch-theologische Analyse kann die logische Konsistenz, die bildlogische Evidenz, die theologische Valenz, die rhythmisch-klangliche Stimmigkeit der Sätze und Wörter untersuchen, Defizite notieren, daraus Rangurteile ableiten. Zur Bewertung der Qualität eines Kirchenliedes ist zweitens unerläßlich der Gesichtspunkt der gottesdienstlichen Verwendbarkeit dieses Lyrikstücks. Eine bewegliche Funktionsforschung, die nach potentiellen Orten des jeweiligen Liedes in liturgischen und paraliturgischen Kontexten fragt, sollte sich jedoch nicht durch jene Funktionsorte fixieren lassen, die die gerade offiziell geltenden Liturgieformulare vorsehen. Liedern können auch angemessene Orte geschaffen werden, sie können von ihrer lyrischen Potenz her selbst gottesdienstbildend sein. Die dritte Dimension, in der die Qualität von Liedern zu prüfen ist, ist die faktische Rezeption. Lieder, die diachron oder synchron oder in beiden Hinsichten eine große Verbreitung aufweisen, sind, auch wenn dies nur auf bestimmte Regionen zutrifft, besonders pfleglich zu behandeln, weil sie Anknüpfungspunkte des kulturellen Gedächtnisses und des gesungenen Konsenses der Glaubensgemeinschaft sind. Eine historische und empirische Rezeptionsforschung ist darum das dritte Feld einer nüchternen Qualitätsprüfung. Wissenschaftliche Forschung kann freilich immer nur Argumente liefern, Entscheidungen mit ihren situativen Imponderabilien aber nicht ersetzen. Nicht also weil wir von poetisch-theologischer Arbeit beurlaubt wären, sondern weil, was da zu leisten ist, unsere Künste insgesamt übersteigt, steht im Gesangbuch, auch im „Gotteslob“ (Nr. 520), ein Lied wie „Liebster Jesu, wir sind hier“, dessen zweite Strophe eben lautet:
„Unser Wissen und Verstand ist mit Finsternis umhüllet, wo nicht deines Geistes Hand uns mit hellem Licht erfüllet. Gutes denken, tun und dichten musst du selbst in uns verrichten.“
III. Im sozialen Wandel
1. Weib
Wie das „Vater unser“ wurde auch das im Frömmigkeitsgebrauch damit einst geradezu notorisch verbundene „Ave Maria“ kleinen Modifikationen unterzogen. „Du bist gebenedeit unter den Frauen“, heißt es nun statt „gebenedeit unter den Weibern“. Dass die frühere Fassung der Rosenkranzleier besser entsprach, ist leicht zu hören: „Du bist gebened ei t unter den W ei bern und gebened ei t ist die Frucht d ei nes L ei bes, Jesus. H ei lige Maria.“ Das „au“ der neuen „Frauen“ springt aus diesem eieiei hörbar heraus.
Aber ich hätte nicht gewagt, auf diese alte Sache zu sprechen zu kommen, wenn nicht einer der wirklich sprachmächtigen katholischen Theologen des 20. Jh., der Tübinger Alttestamentler F. Stier, in seinem Tagebuch sich damit sehr erregt beschäftigt hätte. Als Eintrag unter dem 12. März 1969 heißt es da:
„Mit einem Germanisten beim Kaffee. Weib, sagte er, klingt im Rheinland ,pejorativ‘. In meinen allgäu-alemannischen Ohren nicht. Ich hörte den Allgäuer Bauern über seine jüngst verstorbene Nachbarin sagen: ,Dös war a Wieb!‘ Und den Witwer: ,Sit’s Wieb numma do ischt, ma(g) i seall numma leaba.‘ In diesen Sprachlanden hat ,Weib‘ noch einen guten Ruf. Ich wüßte gern, was in der Psyche der Sprachgemeinschaft vorgegangen ist, daß ,Weib‘ um seine Ehre kam. Um die 980 Mal (ich habe nachgezählt, s. Calwer Konkordanz) in der Lutherbibel! Auch noch in neueren Revisionen, bis in die sechziger Jahre hinein. Ihr verdanke ,Weib‘ eine ,Erneuung‘ seines ,edleren Sinnes‘ (H. Paul). – Es ist Luthers hohe Sprache, die Schiller singen läßt: ,Wer ein holdes Weib errungen …‘ Über die unsterblichen ,Weiber von Weinsberg‘ rümpft niemand die Nase, und bis vor kurzem stieß sich niemand daran an, daß die Mutter Jesu ,gebenedeit unter den Weibern‘ ist … Die ökumenische Einheitsübersetzung droht das ,Weib‘ in der Bibel mit Stumpf und Stiel auszurotten. Die Herren haben es vor. Man wird also Gen 2,22 lesen: Gott ,baute‘ aus Adams Rippe ,eine Frau‘. Und von nun an, fürchte ich, wird die ,Frau‘ in der Sprache dieser Bibel herrschen, das ,Weib‘ verdrängen und nicht ruhen, bis sie auch dem ,apokalyptischen Weib‘ der Geheimen Offenbarung den Garaus gemacht hat … Diese ,weib‘feindlichen Herren Bibelübersetzer! Gibt es keinen Anwalt für ,Weib‘, keinen, der Sinn und Gründe dafür hätte, daß sich eine Bibel, die der Konvention nach dem Munde redet, um das Vorrecht betrügt, sich auch als Sprachgestalt zu ,profilieren‘? Es sind nicht nur meine Allgäuer Bauernohren, die sich über das ,Weib‘ in der Sprache der biblischen Erzähler und Propheten nicht ärgern. Und wenn ich Jesus sagen höre: ,O Weib, dein Glaube ist groß‘, klingt es mir herzhaft und warm. Zur gleichen Zeit, in der Mutter Sprache über die gesellschaftliche Ächtung eines ihrer alten guten Wortkinder trauert, tummelt sich in ihrem Haus ein Gesindel häßlicher Neuwörter. Die Verwaltung der Universität Tübingen suchte vor kurzem per Inserat ,Reinemachefrauen‘ (natürlich müssen sie ,reine‘ machen, denn ,reinmachen‘ tut das Kind in den Topf!). Auch ,Raumpflegerinnen‘ sind gesucht. Wenn die ,Sprachemachemänner‘ in den Ämtern so weitermachen, dann werdet ihr ehrsamen und hochachtbaren Putzfrauen von ehedem eure ,Anhebung‘ zu ,Reinemachedamen‘ und ,Raumkünstlerinnen‘ erleben. Karl Kraus, come back! Schwinge die Peitsche, zünde deine ,Fackel‘, stifte Brand!“ 49
Читать дальше