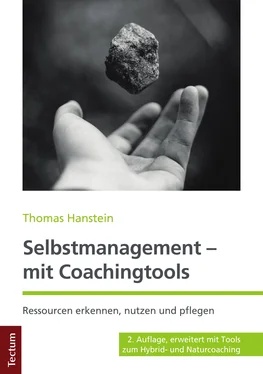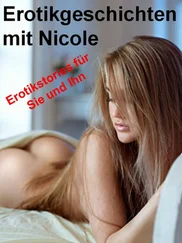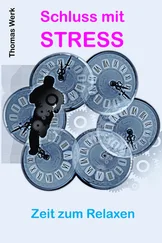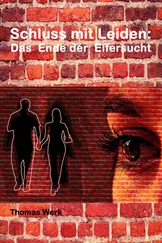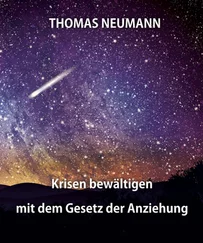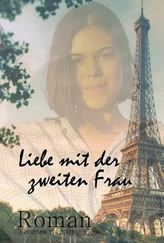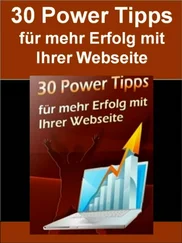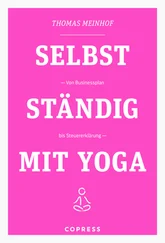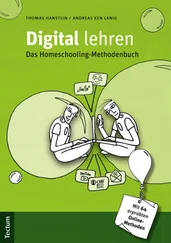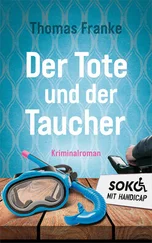Ebenso war vor zwei Jahren eine Entwicklung in vollem Gang, die mit „Vom Präsenz- zum Virtuellen Coaching“ überschrieben wurde (vgl. unter Kap. 2). Die damals skizzierten Linien und beschriebenen technischen Formate sind grundsätzlich auch weiterhin zutreffend. Allerdings ist – auch – durch die Corona-Krise eine Beschleunigung eingetreten, die nach hybriden Formaten verlangt. Dies wird – mit einem anschaulichen Beispiel – ebenfalls im Kontext Naturcoaching dargestellt und visualisiert.
Der mit der 1. Auflage gewählte Ansatz, die wesentlichsten theoretischen Grundlinien für die Tools im praktischen Teil im ersten Drittel zu skizzieren, wurde beibehalten. Auch wenn mancher Verweis durch den geringen zur Verfügung stehenden Umfang sparsam gehalten werden musste, soll auf diese Verschränkung von Theorie (Kap. 1–5) und ausgedehntem Praxisteil (Kap. 6, 7 sowie Anhang) nicht verzichtet werden. Wenn man sich damit auch auf eventuelle Verkürzungen in der Darstellung und Durchdringungstiefe einlassen musste, konnte so jedes einzelne Tool an seine theoretischen Hintergründe rückgebunden werden. Die Verweise finden sich durchgängig mit Hinweispfeilen im Fließtext gekennzeichnet. Dieser Aufbau wurde vielfach positiv rückgemeldet und war als Eigenheit des Buches offensichtlich bereits in der 1. Auflage erkennbar.
Es war wieder wunderbar zu erleben, wie agil Frau Sarah Bellersheim vom Tectum Verlag das Projekt erneut in Angriff genommen hat. Dafür meinen herzlichen Dank! Last not least hat meine Kollegin Petra Wagner die überarbeitete Neuauflage mit einem Exkurs zum intuitiven Schreiben (im Anschluss an ein Naturcoaching) inhaltlich bereichert. Ein ganz besonderer Dank gilt deshalb auch ihr! Und wie immer freue ich mich natürlich auf konstruktive Rückmeldungen aus der „Szene“.
Thomas Hanstein
1Zur besseren Lesbarkeit wird durchgehend die männliche Form verwendet. An den entsprechenden Stellen sind immer alle entsprechenden Personen, unabhängig von ihrem Geschlecht, gemeint.
2Der Coach ist der Coachende, wobei keine weibliche Form existiert. Der „Gecoachte“ wird als Coachee bezeichnet oder – wie hier durchgehend – als Klient.
3Schwerpunkte vgl. unter https//:www.coaching-hanstein.de.
4Weitere Rückmeldungen finden sich – anonymisiert – unter: https://www.coaching-hanstein.de/klientenbewertungen.html.
1 Coaching – ein Etikett für alles und jeden?
Ursprung – sportliche Begleitung erobert die Wirtschaft
Im Sport, insbesondere im Fußball, wird seit vielen Jahren wie selbstverständlich vom Coach und Coaching – synonym zum Trainer und Training 5– gesprochen, ohne dass diese Bezeichnung näher definiert oder gar hinterfragt wird. Was mit der Verwendung des „Coachs“ aber thematisch mitzuschwingen scheint und was eine – zumindest implizite – Spur hinsichtlich der Intention sportlichen Coachings legen kann, ist die Ebene des „mentalen“ Trainings, der ganzheitlichen Einstimmung auf ein Spiel – bzw. dessen mentale Nachbereitung. So kann die schleichende „Platzeroberung“ durch das Thema Coaching auch als Bewusstseinserweiterung dahingehend verstanden werden, dass Fußball mehr als Technik und Teamgeist ist – und was, darüber hinaus, das Besondere und Eigene am Coaching ist. Über den Sport hat sich das Thema in die Wellness-Branche hin ausgeweitet. Durch die nahezu inflationäre Verwendung des Begriffs in diesem Bereich – in etlichen Büchern zur Lebensberatung oder in diversen Fernsehsendungen und auch Spielfilmen zu sehen – kann sich der Eindruck aufdrängen, beim Coaching handle es sich um eine „softe“ Variante der Lebensbegleitung. So sei bereits zu Beginn festgestellt, dass sich „Coaching (…) im deutschsprachigen Raum aus der Begleitung von Führungskräften heraus entwickelt“ hat (Berninger-Schäfer, 2011, S. 11). Wenn auch die terminologische Herkunft im Sport gesehen werden kann, von dem der Begriff in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts in die Wirtschaft überschwappte, gehört Coaching ab dieser Zeit originär in den Bereich der Führungskräftebegleitung (und -entwicklung), weshalb Elke Berninger-Schäfer in der „Qualitätssicherung von Führungstätigkeit (…) nach wie vor das „hauptsächliche Ziel von Coaching“ (ebd.) sieht. In den letzten 30 Jahren hat sich Coaching permanent weiterentwickelt und ausdifferenziert, so dass es, nach Regina Mahlmann, „über die Zielrichtung und über das Verständnis von Einzel- und auch Gruppen-Coaching“ mittlerweile „einen allgemeinen Nenner“ (Mahlmann, 2009, S. 12) gibt. Mahlmann begründet dies mit einem Blick auf grundlegende Ansätze, deren „Definitionen tatsächlich wenig differieren“ (ebd.) würden. So wird Coaching – in diesem Überblick – von Astrid Schreyögg zum Beispiel als „Förderung beruflicher Selbstgestaltungspotenziale“ (nach Schreyögg, 1995) definiert, von Horst Rückle als „Prozess zur Entwicklung der Persönlichkeit und (…) rollen-spezifischer Fähigkeiten“ (nach Rückle, 2000) verstanden, oder von Thomas Holterbernd und Bernd Kochanek als „Unterstützung der Persönlichkeitsbildung in Arbeitszusammenhängen“ (nach Holterbernd/Kochanek, 1999).
So diese Beobachtung von Mahlmann – bei der exemplarischen Nennung von Definitionen – zutrifft, hat die von Berninger-Schäfer konstatierte „Tendenz zur Professionalisierung und Qualitätssicherung“ (Berninger-Schäfer, 2011, S. 13) im Bereich Coaching ab dem Jahr 2000, verstärkt nochmals ab 2004, daran entscheidenden Anteil. In Beiträgen vor dieser Zeit nämlich lassen sich noch Beschreibungen finden, die heute kaum mehr en vogue sein dürften. So schrieb dieselbe, oben zitierte Autorin vor 20 Jahren zum Beispiel von Coaching als „problemorientierter Beratungsform“ (Schreyögg, 1995, zitiert nach Mahlmann, 2009, S. 12). Die in den letzten Jahren ausgebaute Verbandsarbeit, v. a. durch den Deutschen Bundesverband Coaching – als führender Verband im Bereich Business-Coaching und Leadership im deutschsprachigen Raum – hat sich die Qualitätssicherung zur grundlegenden Aufgabe gemacht. So will der DBVC „gewährleisten, dass eine Dynamisierung des Coaching-Feldes durch eine hervorragende und damit anerkannte Qualitätsweiterentwicklung unterlegt wird. Das Festsetzen, Leben und Weiterentwickeln von Standards soll den beteiligten Gruppen eine größere Sicherheit bezüglich der theoretischen Durchdringung und der praktischen Anwendung von Coaching geben. Die wissenschaftliche Fundierung der Arbeit soll Innovationen fördern, die auch in die Ausbildung anerkannter Coachs münden“ ( http://www.dbvc.de/der-verband/ueber-uns/unser-selbstverstaendnis.html).
Die Begriffsbestimmung, die der Deutsche Bundesverband Coaching vornimmt, spiegelt sprachlich die zurückgelegte inhaltliche Weiterentwicklung im professionellen Coaching wider und verweist auf Qualitätsstandards, die immer mit verbindlichen sprachlichen Normierungen beginnen. So wird Coaching heute als „professionelle Beratung, Begleitung und Unterstützung von Personen mit Führungs- und Steuerungsfunktionen und von Experten in Unternehmen und Organisationen“ verstanden. Als Zielsetzung von Coaching nennt der DBVC „die Weiterentwicklung von individuellen oder kollektiven Lern- und Leistungsprozessen bzgl. primär beruflicher Anliegen“ ( http://www.dbvc.de/der-verband/ueber-uns/definition-coaching.html). Neben die Begleitung von Führungskräften trat damit auch die Unterstützung von Fachkräften. Hieran wird deutlich, wie sich Coaching in den letzten Jahrzehnten und Jahren auch „bezüglich Zielgruppen, Anlässen und Settings weiter ausdifferenziert“ (Berninger-Schäfer, 2011, S. 11) und zu einer eigenen und professionellen Fachdisziplin entwickelt hat, welche „die Förderung der Selbstreflexion und -wahrnehmung und die selbstgesteuerte Erweiterung (…) der Möglichkeiten des Klienten bzgl. Wahrnehmung, Erleben und Verhalten“ ( http://www.dbvc.de/der-verband/ueber-uns/definition-coaching.html) als Schwerpunkt hat.
Читать дальше