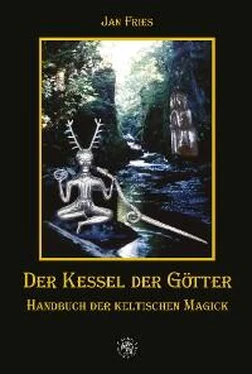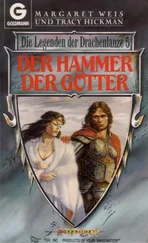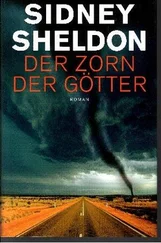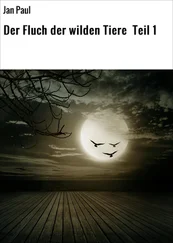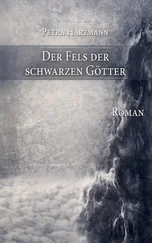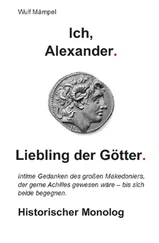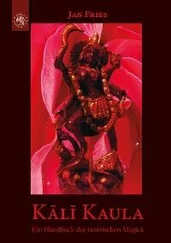Stell Dir einfach einen Autor vor, der in 2500 Jahren über die „europäische Magie” oder die „europäische Religion” schreibt. Du wärst bestimmt entzückt zu erfahren, dass „die Europäer” Stierkämpfe veranstalteten, einen schiefen Turm gebaut haben, Tartans getragen haben, auf langen hölzernen Hörnern Musik gemacht haben, Spaghetti gegessen haben, Bälle in Tore geschossen haben (wahrscheinlich ein Fruchtbarkeitskult), in Ballons gereist sind, Kuckucksuhren als Talismane besessen haben und eine große Anzahl von Göttern verehrt haben, darunter einen nackten Mann an einem Kreuz, ein Lamm, eine Taube, einen Hasen, eine Kiste mit sich bewegenden Bildern, rechteckige Papierstücke, lärmende Metallfahrzeuge und kleine Plastikschachteln, die in einer Geste der Anbetung ans Ohr gehalten wurden. Wenn Du liest, was „die Kelten” getan oder nicht getan haben, denk bitte an diese mysteriösen Europäer.
Leider ist es bereits schwierig, über die westliche Hallstattkultur allgemeine Aussagen zu machen, wobei ihr Wirkungskreis ja lediglich auf einen relativ kleinen Teil Zentraleuropas beschränkt war. Die La Tène-Kultur ist sehr viel komplexer, da sie die keltische Expansion einschließt und damit keltische Völker umfasst, die sich in Frankreich, Britannien, Irland, Spanien, Portugal, Norditalien, Tschechien, der Slowakei, Rumänien, auf dem Balkan und sogar in der zentralen Türkei niedergelassen hatten. Es wäre einfach, davon auszugehen, dass die einfallenden Kelten der Ur-Bevölkerung dieser Länder ihre Kultur aufzwangen, in Wirklichkeit aber führt jede Eroberung zu einer Vermischung der Bevölkerung. Dabei entstehen verschiedene Länder, die unterschiedliche keltische Dialekte sprechen; jedes verfügt über eine keltische Adelsschicht, die aber stark von der einheimischen Kultur beeinflusst ist. Das Ergebnis ist eine Reihe kultureller und religiöser Unterschiede. Aber selbst in den keltischen Heimatländern in Zentraleuropa ist die Lage überraschend kompliziert. Die Völker, die man in unserer Zeit so unbefangen als „keltisch” bezeichnet, waren niemals eine einzelne oder einheitliche Kultur, und für jede Ähnlichkeit findet man ein Dutzend eigenartiger Unterschiede, dank der geduldigen Schaufelei unserer Archäologen. Hier einige Beispiele aus der wunderbaren Welt der Begräbnisriten.
Wie Du Dich sicher erinnerst, ergaben sich zu Beginn der La Tène-Kultur mehrere wichtige Veränderungen in den Begräbnisriten. Die großen Hügel kamen aus der Mode, und Einzelgräber wurden die Regel. An manchen Orten wurden die Leichen verbrannt, an anderen Orten wurden sie auf dem Rücken liegend bestattet. Verglichen mit den Reichtümern von Hallstatt D sind La Tène-Begräbnisse beinahe billig zu nennen, und anders als in Ha D waren die meisten Männer bewaffnet. Eine Sache, die für die Leute von La Tène A und B wirklich wichtig gewesen zu sein scheint, war die Ausrichtung des Grabes. Als noch die großen Hügel gebaut wurden, hat das wohl keine Rolle gespielt – wenn man bis zu hundert Leute in einem einzigen Hügel begräbt, liegen die Leichen in allen möglichen Richtungen. Bei den Einzelbegräbnissen in der La Tène-Zeit wurde die richtige Ausrichtung des Leichnams zu einem Muss. In der Champagne und am Mittelrhein wurde die Mehrzahl der Bestattungen mit einer Nord-West- (45 %) und West-Ausrichtung durchgeführt. Zur gleichen Zeit wird bei Begräbnissen in der Schweiz und in Baden-Württemberg eine Ausrichtung des Kopfes nach Süden (45 %), nach Norden (18 %) und nach Osten (19 %) favorisiert. Das scheint kompliziert, hängt aber teilweise mit dem sozialen Status des Bestatteten zusammen. Die reicheren Krieger lagen mit dem Kopf nach Westen. Bestattete in Österreich und jenseits der Donau lagen mit dem Kopf nach Süden (57 %) und Südosten (28 %). In der Slowakei liegen 50 % aller Bestatteten mit dem Kopf nach Süden, 35 % nach Südosten. In Bayern, Mähren, Schlesien und Böhmen haben fast 80 % eine Ausrichtung nach Norden und etwa 5 % eine Ausrichtung nach Nordwesten.
Diese Prozentzahlen sind grobe Schätzungen, die auf H. Lorenz´ Die Kelten in Mitteleuropa, 1980, basieren. Wie man sieht, ging man in jeder dieser Gegenden sehr systematisch in Bezug auf Begräbnisse vor. Nun haben Begräbnisriten viel mit der Religion und dem Glauben an irgendeine Form von Leben nach dem Tod zu tun. Die La Tène-Kelten glaubten definitiv an heilige Richtungen; sie konnten sich nur nicht auf eine einigen. Wenn man die Ausrichtungen betrachtet, kommt man nicht umhin zu bemerken, dass die frühen La Tène-Leute bereits unterschiedlichen Religionen und/oder Kosmologien anhingen. Man vergesse auch nicht die Leichen, die nicht in die Richtung ausgerichtet lagen, die in ihrer Gegend in Mode war. Gelegentlich mögen solche Unterschiede durch Zufall oder Sorglosigkeit zustande gekommen sein, insgesamt aber erinnern sie doch eher an die „gefährlichen Toten”. Oft genug liegt der Tote in einem solchen Grab in einer seltsamen Position, mit überkreuzten Beinen, erhobenen Armen, gefalteten (oder gefesselten?) Händen, mit ausgerenkten Gliedern, auf dem Bauch, und so weiter. Es gibt keine Regel für das Begraben gefährlicher Leute, die Hauptsache scheint gewesen zu sein, dass man sie anders begrub. Wir befassen uns später noch damit.
Die frühen La Tène-Leute begruben noch häufig die Körper in flachen Gräbern, später wurde es dann notwendig, die Toten zu verbrennen, und so ging es weiter bis zur römischen Besatzung. Doch auch diese Bräuche wurden nie exklusiv befolgt.
Auch die Praxis der Leichenverbrennung folgte nie einer einzigen Regel. Es gab Stämme, die sorgfältig die Knochenstücke aus der Asche holten, um sie zu begraben, und andere, die den ganzen Leichenbrand aus Asche, Knochen- und Holzstücken ins Grab legten. Manche bestatteten alle verbrannten Knochen in einem Grab von der Größe der Leiche, andere legten sie in irgendeinen Behälter – einen Beutel oder eine Urne – oder vergruben nur einen kleinen Teil davon, der das Ganze verkörperte. Wieder andere legten die verbrannten Knochen in Form eines Skeletts aus. Grabbeigaben wurden manchmal verbrannt, manchmal unversehrt vergraben; manche Leichen wurden entkleidet verbrannt, andere mit ihren Kleidern. Es gibt sogar Gräber, in denen offensichtlich gemischte Bräuche zur Anwendung kamen. Wir können behaupten, dass Leichenverbrennung zur mittleren La Tène-Zeit die Regel geworden war, aber es gab keine Standardregel, die befolgt wurde, nicht einmal in den relativ kleinen Distrikten.
Dann gibt es da noch das Problem der Friedhöfe. Die meisten Kelten zogen es vor, die Toten in einiger Entfernung von ihren Siedlungen zu begraben, was von einer gewissen Furcht vor den Toten zeugen mag – oder auch nicht. Ob Friedhöfe umzäunt waren, ist unbekannt. Genauso wenig weiß man, wer eigentlich begraben wurde. Abgesehen vom Friedhof von Nebringen (Baden-Württemberg) weist nichts auf Begräbnisse in Familiengruppen hin. Die Theorie, dass Männer, Frauen und Kinder getrennt begraben wurden, wurde ebenfalls durch Funde widerlegt. Egal ob Feuer- oder Körperbestattung, die Anzahl an Leichen spiegelt nicht die Bevölkerungszahlen wider. Kindergräber sollten die Hälfte aller Gräber ausmachen, sind aber extrem selten. In einigen Gegenden fehlen Frauengräber ganz; nicht so in der Pfalz, wo Frauen und Kinder fast die Hälfte aller Gräber belegen. Viele Orte entziehen sich jeder Erforschung, da die Toten so gründlich verbrannt wurden, dass man nicht mehr sagen kann, welchem Geschlecht sie angehörten. Abermals deutet die Behandlung von Frauen und Kindern auf extrem unterschiedliche soziale Systeme hin. Aber wie auch immer es gewesen sein mag, es war immer nur eine kleine Minderheit, die überhaupt ein richtiges Begräbnis erhielt.
Was mit dem Rest der Bevölkerung geschah und welchen Glauben diese Leute hatten, bleibt ein Rätsel. Es wird sogar noch rätselhafter, wenn wir die Begräbnisse im späten 2. und 1. Jh. vor unserer Zeit betrachten, als die sogenannten Oppida-Kulturen immer größere Ringwälle errichteten, die die Siedlungen ganzer Stämme umschlossen. Die erodierten Wälle dieser großen Hügelstädte sind noch zu sehen; man kann sich leicht die Tausende von Bewohnern vorstellen, die dort lebten, aber ihre Begräbnisriten entziehen sich dem Archäologen seltsamerweise völlig. Was immer die meisten Kelten der Oppida-Zeit mit ihren Toten taten, sie taten es, ohne Spuren zu hinterlassen. Es gibt keine Gräber, keine Grabbeigaben, gar nichts. Natürlich existieren jede Menge wilde Theorien, vom Verstreuen der Asche im Wind über das Versenken in Flüssen, spurlosem Begraben und Bestattungen unter freiem Himmel, bei denen dann die Vögel oder wilde Tiere die Leichen verzehrten. Alles Mögliche könnte zutreffen. Und auch das ist wieder nicht die Regel, denn was immer man findet oder nicht findet, es gibt immer Ausnahmen.
Читать дальше