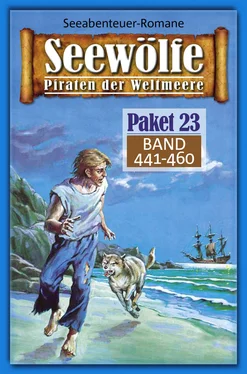Sie flog ein Stück zurück und landete klappernd zwischen den Felsen. Carrero fluchte leise und hastete weiter.
Er wandte sich jetzt zur Küste. Da war zum Teil harter Sand, der nicht die Fußsohlen zerfetzte wie dieses scharfkantige Gestein. Die Aussicht auf einen besseren Boden beruhigte ihn wieder. Er ertrug die Schmerzen ein wenig besser. Immer wieder trieb er sich zu schnellerem Tempo an. Manchmal warf er einen Blick über die Schulter zurück.
Es schien ihm jedoch niemand zu folgen. Somit war die Flucht geglückt. Doch es war ein Fehler, jetzt zu verharren. Erst später, wenn Meilen zwischen ihm und den Verfolgern lagen, durfte er sich eine kurze Verschnaufpause gönnen. Dann ging es weiter, und er rechnete damit, Arica noch während der Nacht zu erreichen.
Dort durfte er sich auf seinen Lorbeeren ausruhen – nur für kurze Zeit, denn anschließend galt es, über die englischen Galgenstricke herzufallen und ihnen den Garaus zu bereiten. Aber aufatmen würde er, und er würde gleich wieder der alte Luis Carrero sein: selbstbewußt, stolz und überlegen.
Wenn er erst wieder in Potosi war – das gab ein Fest! Er würde sich an den Engländern rächen, würde sie schikanieren und foltern. Dann gab es eine große Orgie mit vielen Weibern, und sicherlich würde es auch Don Ramón de Cubillo einen Riesenspaß bereiten, den Sieg über die Bande von Schnapphähnen zu feiern.
Als Krönung der Feier sollte man, so fand Carrero, den Kopf des schwarzhaarigen Bastards Killigrew auf einem silbernen Tablett hereintragen. Ja, das war nach seinem Geschmack!
Seine Allerkatholischste Majestät wollte ja ohnehin nur den Kopf dieses Satans. Er wollte ihn nicht lebend. Welchen Wert hatte es, wenn Killigrew nach Spanien überführt wurde? Nicht den geringsten. Er, Luis Carrero, würde die Belohnung kassieren. Und der Ruhm und der Dank der Nation waren ihm sicher.
Diese Gedanken hielten ihn aufrecht und trieben ihn voran. Wieder verspürte er heftige Schmerzen. Er versuchte, sie zu ignorieren, aber so einfach war das nicht.
Er humpelte. Sein Herz hämmerte in der Brust, und in den Lungen spürte er schon seit geraumer Zeit ein scharfes Stechen. Dennoch hielt Carrero nicht inne. Weiter, weiter, dachte er, bleib nicht stehen!
Er erreichte den schmalen Uferstreifen und schlug die südliche Richtung ein. Ja, im Sand ging es besser. Die Schmerzen ließen jetzt nach. Er hatte den Eindruck, auch wieder schneller voranzukommen.
Noch einmal blickte er über die Schulter zurück. Nichts. Keine Gestalt näherte sich. Hatten die Bastarde von den Schiffen die Verfolgung überhaupt nicht aufgenommen, weil sie meinten, daß es aussichtslos sei?
Möglich war aber auch, daß sie ihren angeschossenen Kumpanen zwischen den Felsen entdeckt hatten und sich in diesem Augenblick um ihn kümmerten. Das verschaffte ihm einen größeren Vorsprung. Alles war zu seinem Vorteil. Es war letztlich auch nicht schlecht gewesen, daß dieser Hundesohn von einem Wachtposten versucht hatte, ihn zu stellen. Er hatte sein Fett empfangen, und die anderen konnten zusehen, wie sie ihn verarzteten.
Noch einmal schaute Carrero sich um. Plötzlich war er irritiert. War da nicht etwas? Links hinter ihm? Nein – er irrte sich bestimmt.
Er blickte wieder voraus und konzentrierte sich auf das Laufen. Wie lange konnte er so durchhalten? Die Fußsohlen brannten nicht mehr so schlimm. Sein Herz schlug noch heftig, aber wieder etwas regelmäßiger. Die Seitenstiche hielten sich in Grenzen. Er rechnete sich aus, daß er noch gut eine Stunde so weiterlaufen konnte.
Da – war da nicht ein Geräusch hinter ihm? Wieder wandte er den Kopf. Diesmal sah er den grauen Schatten, der wie ein Schemen über den Strand huschte.
Das Mark schien ihm in den Knochen zu gefrieren. Ein Hund, dachte er entsetzt. Die Bestie!
Sofort hatte er wieder das Bild vor sich, wie Plymmie ihn an Bord der „Estrella de Málaga“ angeknurrt hatte. Jetzt hatten sie das Vieh auf ihn losgelassen, kein Zweifel. Herrgott, warum hatte er nicht gleich daran gedacht? Und die Stiefel – sie hatte ja nur daran zu riechen brauchen. Und das Blut, das er garantiert auf den Felsen hinterlassen hatte, als er sich die Fußsohlen zerfetzt hatte?
Er wußte Bescheid. Er hatte selbst Hunde gehabt und war ein Fachmann auf dem Gebiet. Was für ein Narr war er doch! Diese Bastarde hatten den einfachsten und sichersten Weg gewählt, ihn zu fassen. Sie hetzten die Hündin hinter ihm her!
So hatte er es getan, wenn einmal Sklaven aus dem Lager am Cerro Rico von Potosi geflohen waren. Auch kurz vor seinem Aufbruch nach Arica, von wo aus seine Expedition in See gegangen war, hatte er einen dieser Indio-Affen, wie er sie nannte, „erlegt“. Der Kerl hatte sich eingebildet, ungesehen und ungehört aus dem Lager zu entwischen.
Aber er hatte einen Fehler begangen: Er hatte versucht, ihn, Carrero, umzubringen, und zwar mit einem Hartholzmesser. Carrero war dem Anschlag auf sein Leben dank seiner Geistesgegenwart entgangen – und dann hatte er seine Bluthunde auf den Mann gehetzt.
Ja, sie hatten ihn zerrissen. Carrero hatte sich das Werk selbst angesehen. Viel war von dem Kerl nicht übriggeblieben. Hatte er es anders verdient? Kein Indio durfte sich in den Kopf setzen, einen Luis Carrero überlisten zu können.
Außerdem waren sie allesamt dumm und dreist, diese Indio-Affen. Waren sie nicht von Gott bestimmt, als Sklaven für die Spanier zu arbeiten? Na also – es gab nichts Besseres und Richtigeres für sie. Statt sich zu beugen und dankbar zu sein, rebellierten sie jedoch. Dagegen gab es nur ein Mittel. Man mußte Exempel statuieren, um die anderen an der Kandare zu halten.
Carrero hatte immer nach dieser Devise gehandelt, unterstützt von Don Ramón de Cubillo, der alles guthieß, was sein Oberaufseher tat. Carreros Erfolge zählten: Er herrschte wie ein Despot, und auch die Aufseher kuschten vor ihm wie die Bluthunde.
Carrero war überall und hielt seine Augen und Ohren offen. Nichts konnte ihm entgehen. Und wenn neue Sklaven beschafft werden mußten, weil einige von den Indios die Frechheit hatten, einfach zu sterben, war Carrero immer sehr schnell mit „Nachschub“ bei der Hand.
Jawohl, er war ein angesehener Mann in Potosi. Und so würde es auch wieder sein, obwohl der Provinzgouverneur inzwischen allen Grund dazu hatte, sich zu sorgen. Keine Nachrichten von Carrero und dem Expeditionstrupp, obwohl diese schon längst hätten zurück sein müssen! Das gab selbst einem behäbigen Mann wie de Cubillo allmählich zu denken.
Warte auf mich, Don Ramón, dachte Carrero, ich komme!
Dann wandte er noch einmal den Kopf und stellte fest, daß der graue Schatten noch nähergerückt war. Das war die Realität – er konnte sich ihr nicht entziehen!
Es war genau die Situation, die er Hunderten von Sklaven mit seinen Bluthunden bereitet hatte. Jetzt war es umgekehrt – er war der Gejagte. Und er hatte Angst vor dieser wölfischen Bestie. Das Grauen, das ihn packte, konnte er nicht abschütteln.
„Nein!“ stieß er hervor.
Er glaubte, ein Hecheln und Knurren zu vernehmen. Der Abstand zwischen ihnen schrumpfte zusammen. Gleich war die Hündin heran. Carrero spürte, wie ihm der kalte Schweiß ausbrach. Sein Atem ging jagend, sein Herz schlug wie wahnsinnig. Die Seitenstiche nahmen wieder zu.
Aufhören! schrie es in ihm. Ich werde verrückt!
Schon einmal hatte ihn dieses Wolfsvieh umgerissen – entsetzlich! Das Hecheln war dicht hinter ihm. Das Knurren, das in unregelmäßigen Zeitabständen ertönte, holte ihn ein und versetzte ihn in Panik.
„Nein!“ schrie er. „Ich will nicht sterben!“
Carrero riß die eine der beiden erbeuteten Pistolen heraus – es war die von Luke Morgan. Er drehte sich halb um, spannte den Hahn, legte auf die Hündin an und drückte mit wutverzerrtem Gesicht ab.
Читать дальше