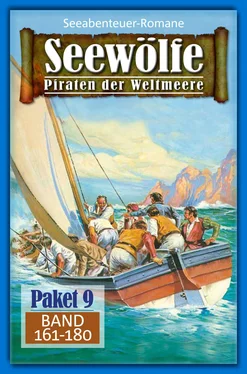Er bugsierte das Faß in einen Vorratsraum und begegnete Jan Ranse und Piet Straaten, den beiden Holländern, die auch mit zugepackt hatten und gerade zwei Kisten auf die Planken stellten. Eric setzte sein Faß ab. Er brauchte nur daran zu schnuppern, um zu wissen, was darin schwappte: echter irischer Whiskey – W-h-i-s-k-e-y. Plötzlich war seine Abneigung gegen Fässer dahin, und er dachte daran, daß man nach einer durchzechten Nacht wieder mit dem anfangen sollte, mit dem man aufgehört hatte.
„Es ist auch Bier da“, meldete Jan Ranse, der Steuermann der „Vengeur“.
„Und Wein“, ergänzte Piet Straaten, der Rudergänger. „Außerdem haben wir Schinken, Dauerwurst, Speckseiten, Fässer mit Mehl, Zucker und Salz, Eier, Brot, Frischgemüse, Weinkraut, Gänse, Hühner und Kaninchen.“
„Tot?“ fragte Eric.
„Wer soll tot sein?“ stieß Jan Ranse verdutzt aus.
„Die Gänse, Hühner und Kaninchen natürlich“, sagte der Glatzkopf. „Wer denn sonst?“
Die Holländer deuteten schweigend auf ein paar fix und fertig ausgenommene und gerupfte Tiere, die an einem der Deckenbalken aufgehängt worden waren. Piet und Jan grinsten, weil Eric sich darüber ärgerte, daß er die Biester nicht gleich entdeckt hatte. Dann grinste auch Eric, denn er vernahm aus dem Nebenraum deutliches Gegacker.
„Tolle Vorräte“, sagte er. „Und auf der ‚Isabella‘ stopfen sie die Vorratskammern mit dem gleichen Zeug voll?“
„Darauf kannst du Gift nehmen, Eric“, sagte Roger Lutz, der soeben mit einem dicken Packen auf der Schulter den Raum betreten hatte.
„So“, meinte Winlow, indem er sich umdrehte. „Aber ich nehme lieber einen anständigen Whiskey zur Brust, wenn du’s wissen willst. Und jetzt heize ich die Kombüsenfeuer an und bereite euch Kakerlaken ein Frühstück, von dem ihr schon lange träumt.“ Er sah, wie Lutz, der Franzose, unter der Last schnaufte, und fügte hinzu: „Du scheinst es ja besonders nötig zu haben, dich zu stärken, Roger. Ist ja auch klar, bei dem Energieverlust von heute nacht.“
Eric hatte die Lacher auf seiner Seite.
Natürlich war etwas faul mit Luis de Bobadilla. Kapitän Pedro de Mendoza litt keineswegs unter Einbildungen. Aber noch lag de Mendoza in seiner Koje und holte nach, was er seit vier Tagen versäumt und eigentlich seit den Vorfällen vor Calais schon nicht mehr richtig getan hatte: Er schlief ein paar Stunden fest durch.
De Bobadilla indessen war schon wieder auf den Beinen, ausgeruht, ziemlich munter und guter Dinge. Er war froh darüber, daß de Mendoza bisher keine Gelegenheit gefunden hatte, ihn genauer zu befragen. Aber er hatte auch keinerlei Zweifel, daß der Kapitän in Kürze entweder in seiner Kammer auftauchen oder ihn zu sich rufen würde, um ihm auf den Zahn zu fühlen und kräftig auf die Finger zu klopfen. Denn wenn erst genaue Recherchen angestellt wurden, konnte er, de Bobadilla, nicht mehr geheimhalten, was er in den vergangenen Wochen immer wieder getan hatte.
Kräftig in die Kriegskasse des Biskaya-Geschwaders hatte er gelangt. Mit dem Proviantmeister Alvarez – nicht mit dem Koch Francisco Sampedro – hatte er ein Abkommen getroffen. Sie betrieben einen schwunghaften Handel mit Gütern, auf die sie beide eigentlich keinen Anspruch hatten. De Bobadilla schleppte Piaster und Reales zu Alvarez, Alvarez händigte ihm dafür Proviant aus, den er heimlich beiseite schaffte. Sie brauchten immer nur einen Zeitpunkt abzuwarten, in dem der Koch sie nicht beobachten konnte, denn der war ein aufrichtiger, ehrlicher Bursche, der alles für seine Kameraden tat und schmutzige Geschäfte haßte.
De Bobadilla grinste.
Sampedro, du Narr, dachte er. Wie konnte ein Mann so idiotisch sein und außer an seinen eigenen Vorteil auch noch an die Interessen der anderen denken! Man sah ja, wohin das führte – nach und nach würden alle krepieren, denn es gab keine Hoffnung auf Hilfe, auf Proviant, Trinkwasser, Medikamente – das alles war ein bloßer Traum.
Selber essen macht fett, das war das Gebot der Stunde!
Luis de Bobadilla war zur Zeit damit beschäftigt, in sein Wams und seine Kürbishosen Goldmünzen einzunähen. Er versah diese Arbeit mit großer Sorgfalt und zwang sich zur Ruhe. Noch hatte er Zeit. Frühestens nach Ablauf von zwei Glasen würde man de Mendoza wecken, soviel hatte er in Erfahrung gebracht.
Dann aber würde er längst fertig sein mit seinen Vorbereitungen, um von Bord der „Gran Grin“ zu gehen. Er hatte die seiner Meinung nach sehr gesunde Absicht, dieses Totenschiff zu verlassen. Wann genau er „von der Fahne“ ging, wußte er noch nicht. Es hing in erster. Linie davon ab, ob der Kapitän ihm mit seinen unbequemen Fragen zu Leibe rükken würde oder nicht.
Vielleicht wurde de Mendoza wieder abgelenkt, vielleicht legte er in den frühen Morgenstunden auch größeren Wert darauf, das Land zu erkunden, vor dem sie lagen, als seinen Zahlmeister zur Rede zu stellen.
De Bobadilla seufzte tief.
Hoffen wir’s, dachte er.
Für sein Vorhaben wäre es sehr vorteilhaft, wenn der Kapitän zunächst einen Spähtrupp an Land schickte und erforschte, in welcher Gegend Irlands man sich befand. Das machte vieles leichter, de Bobadilla konnte dann mit ziemlich sicherer Orientierung von Bord gehen und seinen Weg über Land sicher wählen.
Mit den Goldmünzen, die er mitgehen ließ, würde er sich den Weg zurück nach Spanien nach und nach freikaufen. Die Iren waren arme Hunde, wie er schon bei der Besprechung in der Kapitänskammer bemerkt hatte, für Geld und Gold taten sie sicherlich alles. Dafür begingen sie auch einen Mord und anderes mehr.
De Bobadilla vertraute auf die Macht seines unrechtmäßig zusammengerafften Reichtums – auf sonst nichts.
Als er mit dem Einnähen der Goldmünzen fertig war, stahl er sich aus seiner Kammer und schlich durch das Schiff. Er mied das Oberdeck, wo der erste Offizier de la Torre und der Bootsmann Vallone bei seinem Erscheinen sicherlich argwöhnisch geworden wären.
Ihr Mißtrauen ihm gegenüber wuchs. Auch deswegen mußte er schleunigst zusehen, seinen Plan in die Tat umzusetzen.
De Bobadilla mied aber auch das Mannschaftslogis, in dem die Kranken stöhnten und keuchten. Angewidert verzog er den Mund, preßte sich ein weißes Taschentuch vors Gesicht und sah zu, daß er weiterkam. Der Hauch des Todes ging von diesem elenden Logis aus, der Raum war eine Brutstätte der Seuchen, man hätte ihn in Brand stecken sollen.
De Bobadilla pirschte sich zur Kombüse – zum Stelldichein mit dem Proviantmeister. Seit den letzten zwei Wochen handhabten sie es so, jeden Tag, entweder abends oder morgens, und das Ganze hatte sich prächtig eingespielt.
Immer, wenn der Koch Sampedro Freiwache hatte, päppelte Alvarez den Zahlmeister durch – gegen klingende Münze, versteht sich. Dies war die „hervorragende körperliche Kondition“ des Luis de Bobadilla, das Geheimnis seines gesunden, rosigen Aussehens.
Wenn Sampedro Freiwache hatte, löste Alvarez ihn ab und wog – seit Beginn der Bordrationierung – die Rationen für den nächsten Tag ab. Alvarez deponierte sie in der Kombüse und schloß dann ab. In den letzten Tagen waren die Zuteilungen für Offiziere und Mannschaft immer sparsamer geworden, und abends gab es seit Tagen sowieso nur noch Wassersuppe.
De Bobadilla traf im achteren Bereich des Vordecks-Mittelganges auf Alvarez. Fast schrak er zusammen, als er die Nähe des Proviantmeisters spürte. Er glaubte, Alvarez in der Dunkelheit des Ganges grinsen zu sehen.
Die Stimme des Mannes klang denn auch tatsächlich ein wenig spöttisch. „Angst, mein lieber Luis? Das liegt am schlechten Gewissen, glaub es mir.“
„Das mußt du gerade sagen!“
„Vergiß nicht, daß du mich zu diesem krummen Handel angestiftet hast – ohne dich wäre ich auf so was nie verfallen.“
Читать дальше