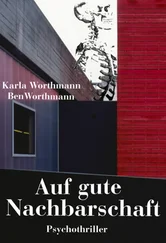Wir gingen vor die Tür, liefen den Sandweg hoch und runter, spähten über das Feld. Mutter war nirgends zu sehen.
Die abendlichen Wanderungen meiner Mutter, die bis tief in die Nacht dauerten, begannen im letzten Jahr, im Spätsommer, als die Tage schon kürzer wurden. Als sie nach dem Abendbrot in die Dunkelheit verschwand, liefen Karine und ich auf den Sandweg vor das Haus und sahen ihr lange nach, und als sie nachts noch nicht zurückgekehrt war, gingen wir noch einmal hinaus und beobachteten das Feld, bis uns die Augen zufielen und wir uns nicht mehr auf den Beinen halten konnten.
Von diesem ersten Tag im Spätsommer an liefen wir meiner Mutter jeden Abend hinterher, wenn sie ohne eine Ankündigung ihren Mantel nahm, ihre Schuhe anzog, die Tür öffnete und die steinerne Treppe hinabstieg. Wir warteten, bis sie durch das Gartentor gegangen war und wir sie aus dem Verandafenster nicht mehr sehen konnten. Dann zogen wir hastig unsere Schuhe an, warfen die Jacken über und liefen aus dem Haus, aus dem Garten, auf den Sandweg. Stellten uns mitten auf den Weg und sahen meine Mutter nur noch klein an seinem Ende, und dann, dann bog sie plötzlich ab und verschwand zwischen den dicht stehenden Tannen.
Es war immer dasselbe, meine Mutter nahm jedes Mal den gleichen Weg, und wir blieben zurück, weil wir nicht wagten, ihr zu folgen. Wir wussten, dass sie wiederkommen würde, wir gewöhnten uns daran, dass sie nun jede Nacht durch den Wald und über die Felder wanderte und uns nie erzählte, was sie dort tat. Wenn sie am nächsten Morgen wieder zurück war, schien es uns, als hätten wir uns ihre Abwesenheit nur eingebildet, als wäre sie nie weg gewesen. Sie machte uns Frühstück, sprach nur das Nötigste, zu dieser Zeit redete sie nicht mehr viel, und schickte uns in die Schule. Karine und ich beschlossen, niemandem davon zu erzählen. Es hätte nichts geändert, die Leute aus dem Dorf hielten sich ohnehin von meiner Mutter fern.
Es passierte an einem Mittwochabend im Winter, der letzte Winter, den meine Mutter mit uns verbrachte. Jeden Mittwoch fand ein Markt im Dorf statt, und meine Mutter schickte mich los, um den guten Käse und das Bauernbrot zu kaufen, das wir auf dem Teppich im Wohnzimmer vor dem Ofen aßen. Ich weiß noch, dass ich an diesem Tag das letzte Stück Käse ergattert hatte und dass das Brot trocken schmeckte, nicht so wie sonst. Es gab nur zwei Stände auf dem Platz vor dem Rathaus, einer gehörte dem alten Holm, von ihm bekamen wir den Käse, am anderen verkaufte Linde Hannemann Gebäck und Brot – sie war die einzige Bäckerin im Dorf, ihr gehörte die kleine Backstube am Marktplatz, und normalerweise nahm sie nur das beste Brot für den Markt, alle wussten das. An diesem Mittwoch war das anders. Es kam niemand mehr, seit Wochen verkauften sich die Produkte so schlecht, dass sie am Abend in die Kammer gepackt und am nächsten Tag wieder angeboten werden mussten. Alles andere rentiere sich nicht, erklärte mir die Linde, als sie mir das Brot vom Vortag in Papier packte und über die Theke reichte. Es sind schlimme Zeiten, Kindchen, sagte sie und schüttelte immer wieder den Kopf. Sie gab mir das Wechselgeld, sogar noch ein bisschen mehr, so viel solltest du nicht für ein altes Brot bezahlen, Kindchen. Als ich ging und mich noch einmal zu ihr umdrehte, stand sie wie erstarrt an ihrem Stand, den Blick auf einen Punkt in der Ferne gerichtet.
Meine Mutter biss in das trockene Brot, auf dem eine dünne Scheibe Käse lag. Karine und ich sahen sie an, das flackernde Licht aus der Ofenluke warf Muster auf ihre Wange, und bis heute ist das Gesicht meiner Mutter in dieser Erinnerung fürchterlich entstellt, die Nase baumelt über ihrem Mund, der Mund ist grimassenhaft verzogen, ihr eines, dem Feuer zugewandtes Auge, zuckt auf und ab. Wir sagten nichts, wir hielten unsere Käsebrote in den Händen und sahen meine Mutter an, keine von uns wagte einen Bissen. Draußen war es längst dunkel geworden, es war so still, dass mir die Stille unheimlich wurde. Die Angst aber kam erst später.
Ihr Zimmer halten wir jetzt verschlossen. Manchmal setzen wir uns vorsichtig auf ihr Bett, das wir nicht verändert haben, seit sie gegangen ist. Die Bettdecke liegt noch zurückgeschlagen, das Kissen ist in der Mitte eingedrückt – die Form ihres Kopfes; das Laken schlägt Falten, dort, wo sie gelegen hat. Auch die Vorhänge vor dem Fenster hängen noch genauso, wie sie sie hinterlassen hat, der eine unordentlich von einem Stoffband gehalten, der andere halb zugezogen. Das Fenster ist geschlossen, wir wagen nicht, es zu öffnen und die Luft hinauszulassen. Die Luft, die sich gesammelt hat, als meine Mutter noch hier war; ihr Duft, ihr Atem, alles bleibt im Zimmer. Wir versuchen, die Tür so schnell es geht zu öffnen und wieder zu schließen, damit so wenig wie möglich von ihr entweicht.
Karine schreit, ich denke, es hat mit dem Zimmer zu tun. Sie wirft sich auf den Boden und trommelt mit ihren Fäusten auf die Holzdielen. Ihr Gesicht wird so rot, dass ich Angst bekomme, ihr Kopf könnte platzen. Ich versuche, sie aufzuheben, nehme sie unter den Achseln und rede auf sie ein. Es ist zwecklos, so zu schreien, es hilft ja nichts. Nach ein paar Minuten ist alles vorbei, Karine setzt sich ruhig auf ihr Bett, ihr Gesicht nimmt langsam wieder seine normale, blasse Farbe an. Ich setze mich neben sie und halte kurz ihre Hand, nur, damit sie nicht gleich wieder anfängt.
Heute stapeln wir das Holz neben dem Ofen, ich nehme zwei Scheite und lege sie in die Asche, zünde sie mit einem langen Streichholz an, puste vorsichtig ins Feuer und sehe zu, wie die Funken durcheinanderfliegen und die Flammen aufsteigen und wieder kleiner werden, bis sie stark sind und sich oben halten, das Holz erfassen und sich darumlegen wie ein leuchtend oranges Gewand.
Karine setzt sich auf den Teppich mitten in das Wohnzimmer und sieht ins Feuer. Ihr Gesicht leuchtet im Schein der Flammen, ihre Locken noch röter als ohnehin schon, das Licht flackert über ihre Wangen. Ich beobachte sie einen Moment, drehe mich weg, setze mich auf den Stuhl, den ich mir vors Fenster gestellt habe, und schaue nach draußen.
Einige Wochen nachdem meine Mutter uns verlassen hatte, hörten Karine und ich auf, jeden Abend vor das Haus zu gehen, uns an die morschen Zaunlatten zu setzen und darauf zu warten, dass wir sie zwischen den Tannen hervorkommen sehen würden.
An jenem Mittwochabend im Winter, als wir trockenes Brot und alten Käse auf dem Schafwollteppich vor dem Ofen aßen, sagte meine Mutter, sie würde wiederkommen. Zu der Zeit hatte der Laden am anderen Ende des Dorfes längst geschlossen, und wir konnten nur noch übrig gebliebene Waren aus dem Lager kaufen, das nur einmal in der Woche öffnete.
Ansonsten bekamen wir einiges vom alten Holm, von der Linde und von wenigen anderen Bauern aus dem Dorf, die weiter ihre Höfe bewirtschafteten, obwohl beinahe niemand mehr da war, um etwas zu kaufen. Viele Häuser waren leer, die großen Geräte, mit denen sie ihre Felder bearbeitet und ihre Waren hergestellt hatten, standen einsam auf den Höfen. An den Gartenzäunen hingen kleine Schilder: Zu verkaufen . Es war fast lächerlich, wie sie dort quietschend im Wind hin- und herschwangen, eine Telefonnummer darauf, als ob irgendjemand hier ein Haus oder einen Hof kaufen würde. Nur noch drei, manchmal vier Kinder, unter ihnen Karine und ich, bekamen Unterricht von der einzigen Lehrerin, die geblieben war. Wir wussten aber, dass das nicht für lange sein würde, auch an ihrem Gartenzaun baumelte schon ein Schild. Fragten wir sie, wann sie wegziehen würde, schüttelte sie nur den Kopf, drehte sich zu der kleinen Tafel und kritzelte mit Kreide eine Aufgabe auf das matte Grün. Ich hatte das Gefühl, dass das Kopfschütteln zu einer Krankheit im Dorf geworden war. Auch meine Mutter schüttelte den Kopf an diesem Abend vor dem Ofen. Sie sagte uns, sie wolle gehen, sie wolle es den anderen gleichtun und etwas Neues finden, irgendwo hinter den Hügeln.
Читать дальше