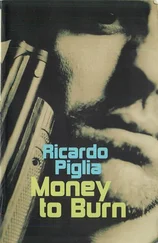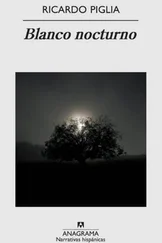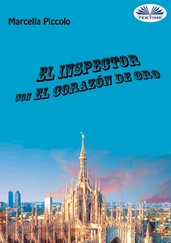Manchmal standen die beiden schon im Morgengrauen auf und fuhren zum Angeln an die Lagune. Sie mieteten ein Ruderboot, warfen die Angelschnur aus und betrachteten den Sonnenaufgang. Tony war auf einer karibischen Insel aufgewachsen und die Lagunen, die sich mit ihren stillen Flussarmen und kleinen Inseln, auf denen Kühe grasten, im Süden der Provinz aneinanderreihten, ließen ihn schmunzeln. Doch ihm gefielen die leeren, weiten Ebenen, die man vom Boot aus sah, jenseits der sanften Wellen, die sich zwischen den Binsen auflösten. Ausgedehnte Felder, von der Sonne versengte Weiden und hin und wieder ein kleiner Tümpel zwischen den Baumgruppen und Wegen.
Zu der Zeit hatte sich die Legende um seine Person bereits gewandelt. Er war kein Don Juan mehr, kein Glücksritter, der reichen südamerikanischen Erbinnen nachstellte. Jetzt war er ein Reisender neuen Typs, ein Abenteurer, der schmutzige Geschäfte machte, ein kühler Ganove, der mithilfe seiner Eleganz und seines amerikanischen Passes Dollars durch den Zoll schmuggelte. Er besaß eine doppelte Persönlichkeit, zwei Gesichter, zwei Wesen. Es schien unmöglich, dass sich eine der Versionen erhärtete, denn sein rätselhaftes Leben sorgte immer wieder für neue Überraschungen. Er war ein verführerischer, extrovertierter Fremder, der viel erzählte, und gleichzeitig ein geheimnisvoller Mann mit einer dunklen Seite, jemand, der in den Bann der Belladonas geraten war und dem es nicht mehr gelang, sich aus diesem Strudel zu befreien.
Das ganze Dorf beteiligte sich daran, die unterschiedlichen Versionen anzupassen und ständig zu ergänzen. Die Motive und der Blickwinkel hatten sich geändert, nicht aber die Person. Die Begebenheiten waren nicht neu, nur die Art, sie zu betrachten. Es gab keine neuen Erkenntnisse, nur andere Interpretationen.
»Aber deshalb haben sie ihn nicht umgebracht«, bemerkte Madariaga und betrachtete den Kommissar im Spiegel, der noch immer nervös im Laden auf und ab ging, die Reitgerte in der Hand.
Ein Rest Abendlicht drang durch das Fenstergitter, hinter dem sich die weite Ebene in der Dämmerung auflöste, als wäre sie aus Wasser.
Sie saßen in Korbsesseln in der zum Garten hin offenen Galerie und unterhielten sich vom späten Nachmittag bis Mitternacht. Immer wieder stand Sofía Belladona auf und trat ins Haus, um neues Eis oder die nächste Flasche Weißwein zu holen. Auch von der Küche aus – oder während sie die Glastür durchschritt, oder während sie sich an das Gitter der Galerie lehnte – sprach sie weiter mit ihm, bevor sie sich wieder setzte und dabei ihre sonnengebräunten Oberschenkel sehen ließ, die weißen Sandalen, die den Blick auf ihre rot lackierten Fußnägel freigaben – die langen Beine, die zarten Knöchel, die perfekten Knie –, die Emilio Renzi versonnen betrachtete, während weiterhin die tiefe, ironische Stimme der jungen Frau ertönte, eine Stimme, die sich wie Musik in der Nacht entfernte und wieder näher kam, bis er sie mit einer Bemerkung unterbrach oder sie für einen Augenblick bat innezuhalten, um ein paar Worte oder einen Satz in seinem schwarzen Notizbuch festzuhalten, wie jemand, der mitten in der Nacht aufwacht und das Licht einschaltet, um ein Detail aus einem Traum, den er gerade eben geträumt hat, auf dem erstbesten Stück Papier zu notieren, in der Hoffnung, ihn sich am folgenden Tag wieder vollständig ins Gedächtnis rufen zu können.
Sofía hatte oft gespürt, dass die Geschichte ihrer Familie ein Teil des historischen Erbes der Gegend war – eine rätselhafte Geschichte, die das ganze Dorf kannte und sich immer wieder neu erzählte, aber nie vollständig zu deuten verstand –, und sie war auch nicht sonderlich beunruhigt wegen der vielen unterschiedlichen Versionen und Verfälschungen, denn schließlich bildeten sie einen Teil des Mythos, den sie und ihre Schwester – die beiden Antigones (oder Iphigenien?) dieser Legende – nicht erklären mussten (sie mussten sich »nicht dazu herablassen, ihn zu erklären«, wie sie immer sagte), doch jetzt, in all dem Durcheinander, das das Verbrechen nach sich gezogen hatte, war es möglicherweise angebracht, den Versuch zu unternehmen, die Ereignisse zu rekonstruieren oder »zu verstehen«. Familiengeschichten gleichen sich, hatte sie einmal gesagt, die Personen wiederholen und überlagern sich – es gibt immer einen durchgedrehten Onkel, eine Verliebte, die ihr Leben lang ledig bleibt, es gibt einen Verrückten, einen Ex-Alkoholiker, einen Cousin, der sich auf den Festen gerne als Frau verkleidet, einen Gescheiterten, einen Gewinner, einen Selbstmörder –, doch was die Sache in ihrem Fall komplizierter machte, war die Tatsache, dass sich die Familiengeschichte der Belladonas und die allgemeine Geschichte des Dorfes überlagerten.
»Mein Großvater hat das Dorf gegründet«, sagte sie verächtlich. »Als er ankam, gab es hier nichts außer karger Erde. Die Engländer haben den Bahnhof errichtet und ihn damit betraut.«
Ihr Großvater war in Italien geboren worden, hatte Ingenieurswissenschaften studiert und war Eisenbahntechniker geworden. Als er nach Argentinien kam, brachte man ihn in diese Einöde und ließ ihn mitten auf dem Land an einer Abzweigung stehen, einer Haltestelle, die in Wahrheit nur der Kreuzungspunkt zweier Bahnstrecken war.
»Manchmal glaube ich«, fuhr sie fort, »dass Tony nicht gestorben wäre, wenn mein Großvater in Turin geblieben wäre. Und wenn wir ihm nicht in Atlantic City über den Weg gelaufen wären oder er weiter bei seinen Großeltern in Río Piedras gelebt hätte, wäre er auch nicht getötet worden. Wie nennt man so etwas?«
»Man nennt es das Leben«, antwortete Renzi.
»Platsch!«, 8 sagte sie. »Sei nicht so kitschig … Was ist los? Sie haben ihn ausgewählt, sie haben ihn getötet, genau an jenem Tag, genau zu jener Stunde, sie hatten nicht viele Gelegenheiten dazu, begreifst du? So viele Chancen, einen Mann wie ihn zu töten, bekommt man nicht.«
DURÁN WURDE TOT auf dem Fußboden seines Hotelzimmers aufgefunden, mit einer Stichwunde in der Brust. Eine Putzfrau hatte ihn entdeckt, als sie das Telefon hinter der Tür klingeln hörte und niemand abnahm. Sie dachte, das Zimmer sei unbewohnt. Es war zwei Uhr nachmittags.
Zur selben Zeit tranken Croce und Saldías einen Wermut in der Hotelbar, so dass sie sich kaum von der Stelle rühren mussten, um mit den Ermittlungen zu beginnen.
»Niemand verlässt das Hotel«, ordnete Croce an. »Wir werden Ihre Aussagen festhalten, dann dürfen Sie gehen.«
Die wenigen Gäste, Handelsreisenden und dauerhaften Bewohner des Hotels saßen in den Ledersesseln im Salon oder standen in Dreier- oder Vierergrüppchen an der Wand und unterhielten sich leise. Saldías hatte an einem Tisch im Büro des Geschäftsführers Platz genommen und rief die Leute nacheinander herein. Er fertigte eine Liste an, notierte sich die persönlichen Daten und Adressen und fragte jeden Einzelnen, wo genau er sich um zwei Uhr nachmittags im Hotel aufgehalten hatte. Dann wies er sie darauf hin, dass sie sich der Polizei weiterhin zur Verfügung halten müssten und dass man sie gegebenenfalls noch einmal als Zeugen vorladen werde. Zum Schluss bat er all jene, die sich in der Nähe des Tatorts aufgehalten hatten oder irgendwelche nützlichen Informationen besaßen, im Speisesaal zu warten. Die Übrigen durften gehen, bis man ihre Hilfe eventuell noch einmal in Anspruch nehmen würde.
»Vier von ihnen haben sich während der Tatzeit in der Nähe von Duráns Zimmer aufgehalten und behaupten, einen Verdächtigen gesehen zu haben. Die werden wir noch einmal genauer befragen müssen.«
»Lass uns gleich damit anfangen …«
Saldías begriff, dass Croce nicht nach oben gehen und die Leiche sehen wollte. Dem Kommissar war das Aussehen der Toten zuwider, dieser sonderbare Ausdruck von Überraschung und Schrecken auf ihren Gesichtern. Er hatte viele Tote in seinem Leben gesehen, zu viele, in allen möglichen Positionen, gestorben an den seltsamsten Todesarten, aber alle hatten sie diesen entsetzten Ausdruck. Er träumte davon, ein Verbrechen aufzuklären, ohne den dazugehörigen Leichnam begutachten zu müssen. Es gibt viel zu viele Leichen, alles ist voll mit ihnen, pflegte er zu sagen.
Читать дальше