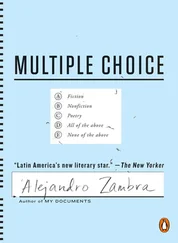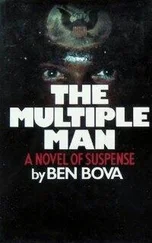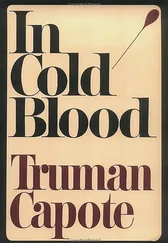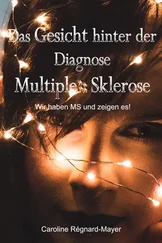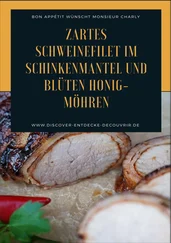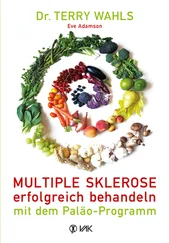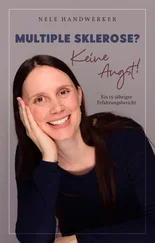Die gegenwärtige Herausforderung bleibt die frühzeitige Diagnosestellung inklusive der Abgrenzung zur ADEM, um eine entsprechende Therapie einleiten zu können.
1.3.2 Neuromyelitis-Optica-Spektrum-Erkrankungen
Neuromyelitis-Optica-Spektrum-Erkrankungen (NMOSD) sind eine Gruppe von entzündlichen, immunvermittelten Erkrankungen des zentralen Nervensystems, bei denen es zu einer schubförmigen Demyelinisierung und axonalen Schädigung vor allem, aber nicht ausschließlich des N. opticus und des Rückenmarks kommt. Die Neuromyelitis optica (NMO; auch Devic-Syndrom, Morbus Devic) wird heutzutage als Subtyp zu diesem Erkrankungsspektrum gerechnet. Diese nach dem französischen Neurologen Eugène Devic benannte Erkrankung wurde Ende des 19. Jahrhunderts erstmals beschrieben (Devic 1894; Devic 1895; Albutt 1870; Erb 1880). Ätiologisch handelt es sich dabei am ehesten um eine Autoimmunerkrankung. Fortschritte in der Diagnostik und insbesondere der Nachweis von NMO-Antikörpern, die sich gegen Aquaporin-4 richten, haben dazu geführt, dass das Erkrankungspektrum als gesonderte Entität und nicht mehr als Subform der MS angesehen wird. Weiterhin zeigen Studien, dass zur Therapie beider Krankheiten unterschiedliche Konzepte notwendig sind, sodass der differentialdiagnostischen Unterscheidung eine besondere Bedeutung zukommt.
Epidemiologie und Genetik
Genaue Daten zur Inzidenz und Prävalenz der NMO und der NMOSD waren lange Zeit aufgrund der Seltenheit der Erkrankung nicht verfügbar. In Japan wurde eine geschätzte Prävalenz von 1,64/100.000 für die NMO und von 3,42 /100.000 für die NMOSD gefunden (Miyamoto et al. 2018), in den USA lag die Prävalenz bei 3,9/100.000 (Flanagan et al. 2016). Insgesamt ist die Prävalenz offenbar weltweit homogener als bei der MS, allerdings wurde wiederholt nachgewiesen, dass die Ethnie Unterschiede in der Prävalenz verursacht (Pandit et al. 2015; Mori et al. 2018).
In Martinique wurde die höchste Prävalenz mit 10/100.000 bei Karibik-Bewohnern afrikanischen Ursprungs gefunden. Die Prävalenz bei Kindern scheint noch geringer zu sein und neuere Studien weisen auf einen möglichen Einfluss der Geschlechtshormone auf den Verlauf der Erkrankung hin (Borisow et al. 2017). Untersuchungen, die auf unterschiedliche Krankheitsverläufe in Abhängigkeit von der Ethnie hindeuten, müssen noch dahingehend evaluiert werden, ob sozioökonomische Faktoren eine Rolle spielen. Aktuelle Daten legen nahe, dass vor allem das Alter zu Erkrankungsbeginn und die rasche Einleitung einer Immuntherapie entscheidende prognostische Faktoren sind (Kim et al. 2018). Vor allem Frauen erkranken an der NMO. Das Verhältnis zu betroffenen Männern liegt zwischen 5 : 1 und 9 : 1 (MS 2 : 1) (Wingerchuk et al. 1999; Jarius und Wildemann 2007), bei den Aquaporin-4-AK-positiven Patienten liegt der Frauenanteil mit bis zu 23 : 1 noch höher. Das mediane Alter bei Erkrankungsbeginn beträgt ca. 35–40 Jahre und ist damit höher als bei der Multiplen Sklerose (hier 28 Jahre) (Wingerchuk et al. 2006; Mealy et al. 2012), aber auch Kinder und ältere Menschen können erkranken (Jeffery und Buncic 1996).
In asiatischen Ländern, insbesondere Japan, wurde bereits seit langem eine optikospinale Form der MS (OSMS) beschrieben. Klinische Charakteristika (Erkrankungsalter) dieser Sonderform ähneln eher der NMO als der MS. Zusätzlich wurde bei ca. 58 % der japanischen Patienten mit einer OSMS Antikörper gegen Aquaporin-4 nachgewiesen, sodass zumindest bei vielen Patienten die Erkrankung identisch mit der NMO zu sein scheint (Weinshenker et al. 2006; Ochi and Fujihara 2016). In Fernostasien weist sie eine höhere Prävalenz als die typische MS auf (Kira 2003). Das MHC-Klasse-II-Allel DPB1*0501 wurde gehäuft bei japanischen Patienten mit OSMS und NMO nachgewiesen (Kira 2003; Yamasaki et al. 1999; Matsushita et al. 2009). Allerdings ist das Allel bei 60 % der japanischen Bevölkerung zu finden (Yamasaki et al. 1999).
Die NMO befällt bevorzugt die Sehnerven und das Rückenmark (Wingerchuk et al. 1999; Wingerchuk et al. 2006; Sato et al. 2013; Bruscolini et al. 2018), aber auch das Gehirn kann betroffen sein (Pittock et al. 2006). In einer multizentrischen Studie zeigten sich bei über 30 % der Patienten Hirnstammsymptome, insbesondere Schluckauf und Erbrechen (Kremer et al. 2014). Eine japanische Studie beobachtete bei 17 % von 47 NMO-Patienten einen persistierenden Schluckauf (Misu et al. 2005). Supratenorielle Läsionen werden bei ca. der Hälfte der Patienten gefunden und meist als nicht MS-typisch eingestuft (Jarius und Wildemann 2012). Die Erkrankung beginnt zumeist monosymptomatisch mit einer Optikusneuritis oder einer akuten Myelitis (90 %), während das klassische Devic-Syndrom mit beidseitiger Optikusneuritis und gleichzeitiger akuter Myelitis nur in 10 % der Fälle auftritt (Jarius et al. 2008). Bei den Patienten ohne Nachweis von Aquaporin-4-AK tritt das klassische Devic-Syndrom häufiger auf (Jarius et al. 2012). Klinisch kann es im Rahmen der Optikusneuritis zu Visusverlust und okulärem Schmerz kommen. Die spinale Symptomatik nimmt unterschiedliche Ausmaße an, die von milden sensiblen Störungen bis hin zum kompletten Querschnittssyndrom reichen. Typische Symptome sind eine hochgradige symmetrische Paraparese, ein sensibles Querschnittssyndrom sowie Blasen- und Mastdarmfunktionsstörungen. Die Myelitis kann auch den Hirnstamm betreffen und birgt dann die Gefahr einer akuten zentralen Ateminsuffizienz (Wingerchuk et al. 1999; Misu et al. 2005; Wingerchuk und Weinshenker 2003), die bei der MS nur selten vorkommt (Pittock et al. 2004).
Typischerweise verläuft die Erkrankung schubförmig (ca. 80–90 %) (Wingerchuk 2007; Jarius et al. 2012; Wingerchuk et al. 1999; de Seze 2002). Innerhalb eines Jahres kommt es bei 60 %, innerhalb von drei Jahren bei 90 % der Patienten zu einem weiteren Schubereignis (Wingerchuk et al. 1999). Dabei tritt der zweite Schub bei Patienten mit einer Myelitis früher auf als bei Patienten mit einer Optikusneuritis (Jarius et al. 2012). Sehr selten beobachtet man eine (sekundär) chronische Progression (2 %) (Wingerchuk 2007a). Der seltener beschriebene monophasische Verlauf ist prognostisch im Hinblick auf die Behinderung eher ungünstig (Sato et al. 2013). Im Unterschied zur MS kommt es bei der NMO nach einem Schubereignis nur selten zu einer spontanen Remission. Zudem sind die Remissionen meist inkomplett, weswegen betroffene Patienten oftmals einen schwereren Krankheitsverlauf als MS-Patienten mit Kumulation von neurologischen Defiziten aufweisen (Jarius et al. 2012). Dennoch sind innerhalb von fünf Jahren nach Krankheitsbeginn über 50 % der Patienten nahezu blind (Visus kleiner 20/200) oder können nicht mehr ohne Unterstützung laufen (Wingerchuk et al. 1999). Als prognostisch ungünstig gelten dabei eine hohe Schubfrequenz in den ersten beiden Jahren, ein schwerer erster Schub (dann auch monophasisch) und eine autoimmunologische Begleiterkrankung wie systemischer Lupus erythematodes (Wingerchuk et al. 1999; Ghezzi 2004).
In einer nordamerikanischen Studie mit 71 Patienten wurde eine Fünf-Jahres-Überlebensrate von 68 % ermittelt (die Patienten verstarben z. B. an einer zentralen Ateminsuffizienz) (Wingerchuk et al. 1999), während eine europäische Studie eine nur unwesentlich geminderte Fünf-Jahres-Überlebensrate von 92 % bei der NMO zeigte (Ghezzi 2004) und bei einer prospektiven Studie mit einer medianen Beobachtungszeit von knapp vier Jahren die krankheitsbezogene Sterberate bei < 5 % lag (Jarius et al. 2012).
Die spinale Bildgebung mittels MRT zeigt bei der NMO zumeist eine ausgeprägte, langstreckige Myelitis (≥ drei Segmente), die im akuten Schub mit einer Gadolinium-Aufnahme, Ödem und auch Nekrosen einhergehen kann (Filippi und Rocca 2004) und als wichtigster nicht serologischer Marker gilt (  Abb. 4.7 a, b). Dabei sind bevorzugt die zentralen Myelonanteile betroffen. Kurzstreckige Läsionen werden nur selten beobachtet (Wingerchuk et al. 2006). Diese finden sich im Unterschied zur NMO eher bei MS-Patienten. Allerdings können verschiedene spinale Läsionen konfluieren und somit den Anschein einer langstreckigen Läsion hervorrufen (Wingerchuk et al. 2006; Lycklama à Niehold und Barkhof 2000; Tartaglino 1995). Das Auftreten zerebraler Herde bei NMO-Patienten wurde in einer 2006 veröffentlichten Studie an 60 Patienten analysiert. Bei 60 % der untersuchten Patienten fanden sich Läsionen im kraniellen MRT. Bei sechs von ihnen (10 %) wurden MS-typische, asymptomatische Läsionen festgestellt. Das entspricht neueren Daten, nach denen sich bei 50 % der NMO-Patienten zerebrale Läsionen fanden (Jarius et al. 2012), die mehrheitlich als nicht MS-typisch eingestuft wurden. In einer lateinamerikanischen Studie wurde bei 81 % der Patienten zu Beginn der Erkrankung zerebrale Läsionen gesehen, vor allem im Bereich des Hirnstamms und Kleinhirns (32,9 %), im Chiasma opticum (20 %) und der Area Postrema (16 %) (Carnero Contentti et al. 2018). Bisweilen wurden bei Läsionen im Bereich des Thalamus und Hypothalamus/Dienzephalon endokrinologische Symptome beschrieben (Pittock et al. 2006; Vernant et al. 1997; Poppe et al. 2005).
Abb. 4.7 a, b). Dabei sind bevorzugt die zentralen Myelonanteile betroffen. Kurzstreckige Läsionen werden nur selten beobachtet (Wingerchuk et al. 2006). Diese finden sich im Unterschied zur NMO eher bei MS-Patienten. Allerdings können verschiedene spinale Läsionen konfluieren und somit den Anschein einer langstreckigen Läsion hervorrufen (Wingerchuk et al. 2006; Lycklama à Niehold und Barkhof 2000; Tartaglino 1995). Das Auftreten zerebraler Herde bei NMO-Patienten wurde in einer 2006 veröffentlichten Studie an 60 Patienten analysiert. Bei 60 % der untersuchten Patienten fanden sich Läsionen im kraniellen MRT. Bei sechs von ihnen (10 %) wurden MS-typische, asymptomatische Läsionen festgestellt. Das entspricht neueren Daten, nach denen sich bei 50 % der NMO-Patienten zerebrale Läsionen fanden (Jarius et al. 2012), die mehrheitlich als nicht MS-typisch eingestuft wurden. In einer lateinamerikanischen Studie wurde bei 81 % der Patienten zu Beginn der Erkrankung zerebrale Läsionen gesehen, vor allem im Bereich des Hirnstamms und Kleinhirns (32,9 %), im Chiasma opticum (20 %) und der Area Postrema (16 %) (Carnero Contentti et al. 2018). Bisweilen wurden bei Läsionen im Bereich des Thalamus und Hypothalamus/Dienzephalon endokrinologische Symptome beschrieben (Pittock et al. 2006; Vernant et al. 1997; Poppe et al. 2005).
Читать дальше
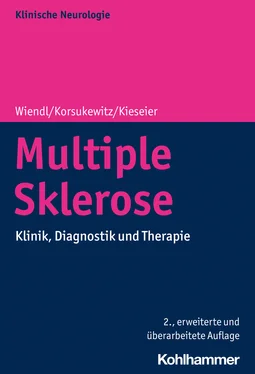
 Abb. 4.7 a, b). Dabei sind bevorzugt die zentralen Myelonanteile betroffen. Kurzstreckige Läsionen werden nur selten beobachtet (Wingerchuk et al. 2006). Diese finden sich im Unterschied zur NMO eher bei MS-Patienten. Allerdings können verschiedene spinale Läsionen konfluieren und somit den Anschein einer langstreckigen Läsion hervorrufen (Wingerchuk et al. 2006; Lycklama à Niehold und Barkhof 2000; Tartaglino 1995). Das Auftreten zerebraler Herde bei NMO-Patienten wurde in einer 2006 veröffentlichten Studie an 60 Patienten analysiert. Bei 60 % der untersuchten Patienten fanden sich Läsionen im kraniellen MRT. Bei sechs von ihnen (10 %) wurden MS-typische, asymptomatische Läsionen festgestellt. Das entspricht neueren Daten, nach denen sich bei 50 % der NMO-Patienten zerebrale Läsionen fanden (Jarius et al. 2012), die mehrheitlich als nicht MS-typisch eingestuft wurden. In einer lateinamerikanischen Studie wurde bei 81 % der Patienten zu Beginn der Erkrankung zerebrale Läsionen gesehen, vor allem im Bereich des Hirnstamms und Kleinhirns (32,9 %), im Chiasma opticum (20 %) und der Area Postrema (16 %) (Carnero Contentti et al. 2018). Bisweilen wurden bei Läsionen im Bereich des Thalamus und Hypothalamus/Dienzephalon endokrinologische Symptome beschrieben (Pittock et al. 2006; Vernant et al. 1997; Poppe et al. 2005).
Abb. 4.7 a, b). Dabei sind bevorzugt die zentralen Myelonanteile betroffen. Kurzstreckige Läsionen werden nur selten beobachtet (Wingerchuk et al. 2006). Diese finden sich im Unterschied zur NMO eher bei MS-Patienten. Allerdings können verschiedene spinale Läsionen konfluieren und somit den Anschein einer langstreckigen Läsion hervorrufen (Wingerchuk et al. 2006; Lycklama à Niehold und Barkhof 2000; Tartaglino 1995). Das Auftreten zerebraler Herde bei NMO-Patienten wurde in einer 2006 veröffentlichten Studie an 60 Patienten analysiert. Bei 60 % der untersuchten Patienten fanden sich Läsionen im kraniellen MRT. Bei sechs von ihnen (10 %) wurden MS-typische, asymptomatische Läsionen festgestellt. Das entspricht neueren Daten, nach denen sich bei 50 % der NMO-Patienten zerebrale Läsionen fanden (Jarius et al. 2012), die mehrheitlich als nicht MS-typisch eingestuft wurden. In einer lateinamerikanischen Studie wurde bei 81 % der Patienten zu Beginn der Erkrankung zerebrale Läsionen gesehen, vor allem im Bereich des Hirnstamms und Kleinhirns (32,9 %), im Chiasma opticum (20 %) und der Area Postrema (16 %) (Carnero Contentti et al. 2018). Bisweilen wurden bei Läsionen im Bereich des Thalamus und Hypothalamus/Dienzephalon endokrinologische Symptome beschrieben (Pittock et al. 2006; Vernant et al. 1997; Poppe et al. 2005).