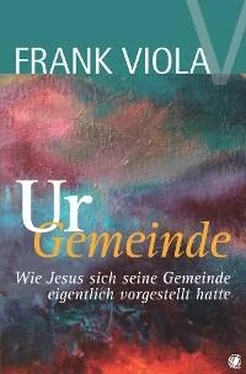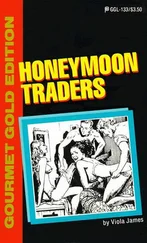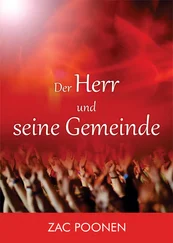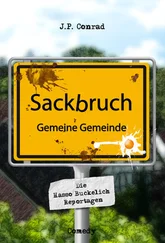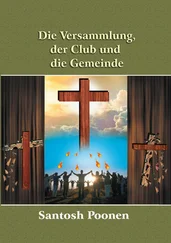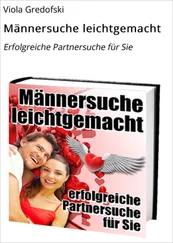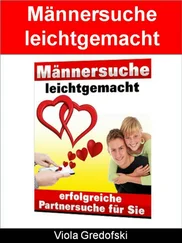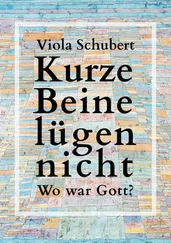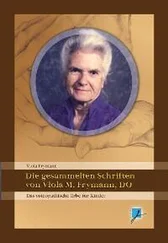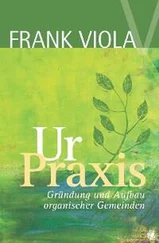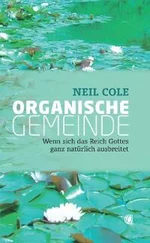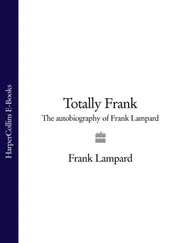F. F. Bruce hat einmal gesagt: „ Entwicklung ist die Entfaltung von dem, was – wenn auch noch im Verborgenen – schon immer da war. Abweichung dagegen ist das Aufgeben eines Grundsatzes zugunsten eines anderen. 18
Alles, was die Gemeinde befähigt, den dreieinigen Gott widerzuspiegeln, ist Entwicklung . Alles, was sie daran hindert, ist Abweichung .
Zusammen mit George Barna habe ich in Heidnisches Christentum? nachgewiesen, dass nur sehr wenig von der Praxis moderner, institutioneller Kirchen seine Wurzeln im Neuen Testament hat. Stattdessen haben von Menschen erfundene Praktiken das Bild der Kirche über die Jahrhunderte geprägt und verändert. Solche Bräuche jedoch unterminieren Christus in seiner Funktion als Haupt der Gemeinde und erschweren das Einander-Dienen der Glieder im Leib Christi. Zudem stehen sie im Widerspruch zur Lehre des Neuen Testaments und dem Vorbildcharakter der trinitarischen Gemeinschaft. Es ist, wie Emil Brunner treffend feststellt: „Die zerbrechliche Struktur der von Jesus gegründeten und vom Heiligen Geist gefestigten Gemeinschaft konnte nicht durch eine institutionelle Organisation ersetzt werden, ohne dass auch der gesamte Charakter der Ekklesia fundamental verändert wurde.“ 19
Warum werden viele dieser Bräuche verteidigt, obwohl sie in klarem Widerspruch zur Heiligen Schrift stehen? Weil religiöse Tradition eine unglaubliche Macht ausübt. Betrachten Sie einmal folgende Schriftstellen:
Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen; aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit (Jes 40,8).
Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Beurteiler der Gedanken und Gesinnungen des Herzens (Heb 4,12).
Denn gleichwie der Regen und der Schnee vom Himmel herabfällt und nicht dahin zurückkehrt, er habe denn die Erde getränkt und befruchtet und sie sprossen gemacht, und dem Sämann Samen gegeben und Brot dem Essenden, also wird mein Wort sein, das aus meinem Munde hervorgeht; es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt, und durchführen, wozu ich es gesandt habe (Jes 55,10-11).
Diese Stellen sprechen von der gewaltigen Kraft des Wortes Gottes. Das Wort Gottes bleibt für immer. Es wird vollbringen, wozu Gott es ausgesandt hat, es wird sein Ziel erreichen und wird nicht unverrichteter Dinge zurückkehren.
Und dennoch – trotz dieser unglaublichen Macht von Gottes Wort – gibt es etwas, das sich ihm aufhaltend in den Weg stellen kann: religiöse Tradition. Beachten Sie, was Jesus, das fleischgewordene Wort Gottes, gesagt hat:
Ihr habt so das Gebot Gottes ungültig gemacht um eurer Überlieferung willen (Mt 15,6).
Und an anderer Stelle:
Denn das Gebot Gottes aufgebend, haltet ihr die Überlieferung der Menschen … Trefflich hebet ihr das Gebot Gottes auf, auf dass ihr eure Überlieferung haltet (Mk 7,8-9).
Religiöse Traditionen haben unser Denken so sehr geprägt, unsere Herzen derart für sich eingenommen und unseren Wortschatz in einem Ausmaß beeinflusst, dass wir jedes Mal, wenn wir unsere Bibel aufschlagen, die gerade aktuellen kirchlichen Bräuche in den Text hineinlesen.
Sobald uns in der Bibel das Wort Hirte („Pastor“) begegnet, denken wir unwillkürlich an den Mann, der sonntags predigt. 20Sobald wir auf das Wort Gemeinde („Kirche“) stoßen, denken wir sofort an ein Gebäude oder an den Sonntagsgottesdienst. Fällt uns das Wort Ältester ins Auge, denken wir gleich an die Gemeindeleitung.
Das stellt uns vor die wichtige Frage: Wie kommt es, dass wir unsere eigene Kirchenpraxis so leicht ins Neue Testament hineinlesen können? Wir sind gewohnt, unser Bibelstudium nach der Methode „cut-and-paste“ (ausschneiden und einfügen) zu betreiben. Da werden „Beweisstellen“ aus ihrem Zusammenhang gerissen und neu arrangiert, um eigene Überzeugungen und Handlungen zu legitimieren. Das geschieht meist unbewusst und wird von zwei Faktoren begünstigt. Erstens entspricht die Anordnung der Briefe in unseren Bibeln nicht der Reihenfolge ihrer Entstehung. Zweitens sind sie in Kapitel und Verse eingeteilt. 21
Der Philosoph John Locke hat das Problem auf den Punkt gebracht. Er schreibt:
Die Schrift wird zerhackt und auseinandergerissen. So, wie sie jetzt gedruckt wird, ist sie ganz zergliedert. Nicht nur das gemeine Volk gebraucht sie nun aphoristisch [indem es aus ihr Regeln formuliert], selbst gebildeten Männern entgeht beim Lesen nicht nur die Kraft, die in ihrem Zusammenhang liegt, sondern auch die davon abhängige Erkenntnis. 22
Wenn das Neue Testament jedoch in chronologischer Reihenfolge und ohne Kapitel- und Verseinteilung gelesen wird, entfaltet sich eine wunderbare Erzählung. Die Geschichte bekommt Fleisch und Blut. Wenn wir das Neue Testament jedoch so lesen, wie es in den gängigen Bibelausgaben vorliegt, lesen wir eine zerstückelte Geschichte. Es fehlt der rote Faden.
Die griechische Mythologie berichtet von einem Mann namens Prokrustes. Er stand in dem Ruf, ein magisches Bett zu besitzen, das die einzigartige Eigenschaft hatte, jeden, der sich hineinlegte, der Größe des Bettes „anzupassen“. War der Gast zu klein, streckte Prokrustes dessen Körper so lange, bis er „passte“. Umgekehrt wurden zu große Gäste grausam gekürzt, bis auch sie „passten“.
Das moderne Kirchenkonzept gleicht einem solchen Prokrustes-Bett. Bibelstellen, die nicht ins Konzept der institutionalisierten Kirche passen, werden „gekürzt“ oder eben so lange „gestreckt“, bis sie ins Konzept passen. Die Methode „cut-and-paste“ erleichtert dieses Vorgehen. Wir reißen verschiedene Verse aus ihrem chronologischen und geschichtlichen Kontext und fügen sie zusammen, um eine bestimmte Lehre oder Praxis zu begründen. Im Gegensatz dazu gibt uns die chronologische Erzählung die Möglichkeit, unsere Schriftauslegung zu prüfen, und hindert uns daran, nach Gutdünken Verse auszuschneiden und einzufügen, damit die Bibel unsere vorgefassten Meinungen stützt.
Tatsache ist, dass ein Großteil unserer gängigen Gemeindepraxis nicht biblisch begründet ist. Solche von Menschen erdachten Bräuche stehen im Widerspruch zum organischen Wesen der Gemeinde. Weder geben sie die Wünsche Jesu Christi wieder, noch spiegeln sie sein Hauptsein und sein herrliches Wesen (wozu die Gemeinde eigentlich berufen ist). Stattdessen bezeugen sie die Inthronisierung menschlicher Ideen und Traditionen. Im Ergebnis ersticken sie den natürlichen Ausdruck der Gemeinde. Und wir rechtfertigen alles mit unserer „cut-and-paste“-Hermeneutik.
Die Beschädigung der gemeindlichen DNA
Einige Christen haben versucht, eine Reihe unbiblischer kirchlicher Praktiken dadurch zu rechtfertigen, dass sie behaupten, die Gemeinde ändere sich je nach Kultur und müsse sich ihrem jeweiligen Umfeld anpassen, in dem sie lebt. Man meint, Gott billige heute ein klerikales System, eine hierarchische Leiterschaft, passives Zuschauerverhalten im Gottesdienst, die „Ein-Mann-Shows“, den Gedanken des „Zur-Kirche-Gehens“ und eine Vielzahl anderer Bräuche, die im vierten Jahrhundert aufkamen, als die Christen die griechisch-römischen Sitten ihrer Umgebung übernahmen.
Ist die Gemeinde wirklich in jeder Kultur anders? Und wenn ja, sind wir dann frei, jede Aktivität in unseren Gottesdienst aufzunehmen? Oder könnte es nicht vielmehr sein, dass die Gemeinde heute sowohl in ihrer Theologie als auch in ihrer Praxis ein Zuviel an moderner westlicher Kultur in sich aufgenommen hat?
Zum Problem der Überkontextualisierung bemerkt Richard Halverson: „Als das Evangelium die Griechen erreichte, verwandelten sie es in eine Philosophie; die Römer machten daraus eine Verwaltung, die Europäer eine Kultur, während das Evangelium in den Händen der Amerikaner zum Geschäft wurde.“ 23In Anlehnung an ein Pauluswort ist zu fragen: „Lehrt euch nicht die Natur …?“
Читать дальше