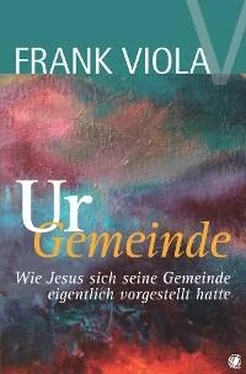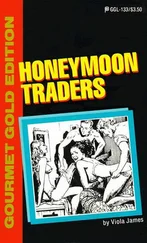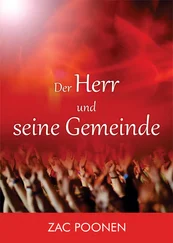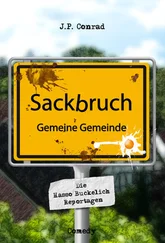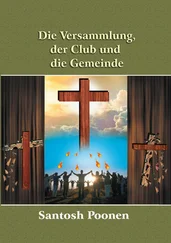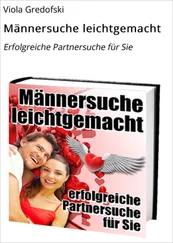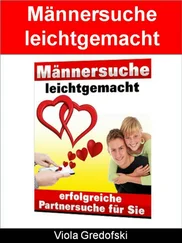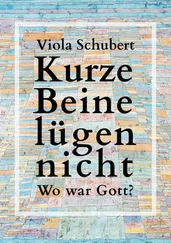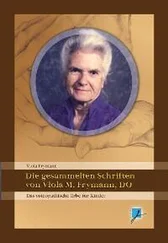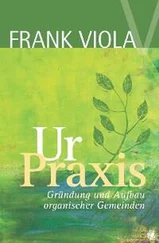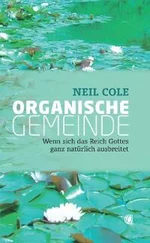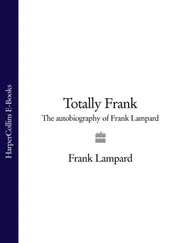9Kevin Giles, What on Earth Is the Church? (London: SPCK, 1995), 222.
10Zitiert nach Kevin Giles, The Trinity and Subordinationism (Downers Grove: InterVarsity Press, 2002), 103.
11Joh 5,30, 14,28.31 und 1 Kor 11,3 stehen in keinem Widerspruch dazu. Diese Stellen beziehen sich auf die freiwillige Unterordnung Christi in seiner irdischen Existenz als Mensch unter Gott den Vater. Er veranschaulichte damit, was es für einen Menschen heißt, sich Gott unterzuordnen. Diese Stellen belegen weder eine hierarchische Struktur noch eine Befehlsordnung innerhalb der Gottheit. Deshalb weisen Theologen jede Vorstellung von einer Hierarchie innerhalb der Gottheit entschieden zurück. In seinem Buch Gemeinschaft (Gerth Medien, 2005) weist Gilbert Bilezekian nach, dass die Kirche den Gedanken einer Subordination innerhalb der Gottheit stets als heidnisches Gedankengut zurückgewiesen hat. Vgl. Kevin Giles, The Trinity & Subordinationism (Downers Grove: InterVarsity Press, 2002); Jesus and the Father (Grand Rapids: Zondervan, 2006); Miroslav Volf, After Our Likeness .
12Vgl. Frank Viola & George Barna, Heidnisches Christentum?
13Dieses Prinzip ist zurückzuführen auf die Lehre „Wo die Schrift schweigt“ bzw. auf das so genannte „Regulativprinzip“. Meines Erachtens sind beide in hohem Maße gesetzlich und nicht praktisch umsetzbar. Sie gehen am Ziel vorbei. Das Neue Testament hat uns kein Gesetz gegeben, dem wir folgen müssten. Es ist so, wie Paulus schreibt: „Der Buchstabe [das Gesetz] tötet, der Geist macht lebendig“ (2 Kor 3,6).
14F. F. Bruce, A Mind for What Matters, 263.
15F. F. Bruce, The Message of the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1972), 98.
16J. B. Philips, aus dem Vorwort zu „Briefe an junge Gemeinden“.
17Damit stimme ich jenen Theologen zu, für die „Haupt“ in Bezug auf Christus sowohl „Kopf“ als auch „Quelle“ bedeutet. Vgl. F. F. Bruce, The Epistles to the Colossians, to Philemon, and to the Ephesians (Grand Rapids: Eerdmans, 1984), 68-69, 274-75; vgl. Francis Foulkes, Ephesians (Grand Rapids: Eerdmans, 1989), 73-74.
18F. F. Bruce, A Mind for What Matters, 238.
19Emil Brunner, Das Missverständnis der Kirche (Zürich: TVZ, 1988), 61.
20Interessanterweise kommt das Wort „Pastor“ (Hirte) im Neuen Testament nur an einer einzigen Stelle vor (Eph 4,11), und da in seiner Mehrzahlform („Hirten“).
21Zur Geschichte der nicht-chronologischen Reihenfolge des Neuen Testaments und deren Einteilung in Kapitel und Verse vgl. Frank Viola & George Barna, Heidnisches Christentum? , Kap. 11.
22Zitiert nach David King (Hrsg.), The Bible Advocate and Precursor of Unity (London: A. Hall & Co, 1848), 126.
23George R. Hunsberger & Craig Van Gelder (Hrsg.), The Church Between Gospel and Culture (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1996), 149.
24Mit Magie hat das freilich wenig zu tun: Der Grund liegt im unterschiedlichen pH-Wert des jeweiligen Bodens.
Kapitel 2: Umdenken – Wie treffen wir uns?
Einige Institutionen sind so alt und ehrbar geworden, dass der Gedanke an ihre Schließung geradezu als Sakrileg erscheint.
F. F. Bruce
Die gesamte reformatorische Theologie suchte die organisierte Kirche neu zu strukturieren, ohne an ihren Grundfesten zu rütteln.
John Howard Yoder
Der Christ spricht gewöhnlich davon, „in die Kirche“ zu gehen. Damit ist die Teilnahme an einem Gottesdienst gemeint. Die Ausdrücke „zur Kirche gehen“ oder „am Gottesdienst teilnehmen“ sind dem Neuen Testament aber fremd. Beide Vorstellungen kamen lange nach dem Tod der Apostel auf. Der Grund dafür ist einfach: Die frühen Christen kannten solche Vorstellungen nicht. „Gemeinde“ war für sie kein Ort, wo man hingehen konnte. Sie verstanden ihre Treffen auch nicht als „(Gottes-)Dienste“.
Wenn wir das Neue Testament im Sinne des frühchristlichen Verständnisses lesen, wird klar, dass es vier Arten von Versammlungen gab:
• Apostolische Treffen: Das waren ganz besondere Versammlungen; die apostolischen Arbeiter predigten einer aktiv beteiligten Zuhörerschaft. Ihr Ziel war es, entweder eine neue Gemeinde zu gründen oder eine existierende zu ermutigen. Die zwölf Apostel hielten solche Treffen im Tempelvorhof in Jerusalem ab, als die Jerusalemer Gemeinde entstand (vgl. Apg 5,40-42). Paulus hielt ähnliche Treffen in der Schule des Tyrannus ab, als er die Gemeinde in Ephesus gründete (vgl. Apg 19,9-10; 20,27.31). Dabei sind für solche Treffen zwei Merkmale beobachtbar: Der apostolische Arbeiter tat die meiste Arbeit, und sie waren immer zeitlich begrenzt. Die Treffen hatten das Ziel, die Gläubigen vor Ort so zuzurüsten, dass sie unter der Leitung Jesu Christi leben und wirken konnten und somit keine menschliche Leitung vonnöten war (vgl. Eph 4,11-16; 1 Kor 14,26). Danach überließ der Apostel die Gemeinde sich selbst. 1
• Evangelistische Treffen: Im ersten Jahrhundert wurde gewöhnlich außerhalb der regulären Gemeindetreffen evangelisiert. Die Apostel predigten das Evangelium dort, wo die Ungläubigen waren. Die Synagoge (Juden) und der Markt (Heiden) zählten zu den bevorzugten Einsatzorten (vgl. Apg 14,1; 17,1-33; 18,4,19). Evangelistische Treffen dienten dem Ziel, eine neue Gemeinde zu gründen oder eine bestehende zu vergrößern. Sie fanden nach Bedarf statt und waren keine feste Einrichtung der Gemeinde. Die Reise des Philippus nach Samaria ist ein Beispiel dafür (vgl. Apg 8,5ff.).
• Treffen zur Entscheidungsfindung: Manchmal musste man zusammenkommen, um wichtige Entscheidungen zu treffen. Zu dieser Art Versammlung zählt etwa das Konzil zu Jerusalem (vgl. Apg 15). Eines der Hauptmerkmale dieser Versammlung war, dass alle am Entscheidungsprozess beteiligt waren. Die Apostel und Ältesten halfen bei diesem Prozess (Näheres dazu in Kapitel 10).
• Gemeindeversammlungen: Dies waren die regulären Versammlungen der Gemeinde und entsprachen unseren „Gottesdiensten“ am Sonntagmorgen. Allerdings waren sie radikal anders.
Im ersten Jahrhundert waren die Treffen der Gemeinde in erster Linie Treffen der Gläubigen. Das wird aus dem Zusammenhang in 1. Korinther 11–14 klar. Zwar waren zuweilen auch Ungläubige anwesend, sie standen aber eher am Rande. Paulus erwähnt die Ungläubigen flüchtig in 1. Korinther 14,23-25.
Anders als heute waren dies keine Treffen, bei denen vorne ein Pastor stand, der eine Predigt hielt, und der Rest passiv zuhörte. Der Gedanke an einen predigtzentrierten Gottesdienst mit einer Zuhörerschaft, die von Kirchenbänken zur Kanzel sah, war den frühen Christen fremd.
Der heutige wöchentliche „Gottesdienst“ dient der Anbetung, der Predigt und in einigen Fällen der Evangelisation. Die Gemeinde des ersten Jahrhunderts dagegen hatte andere Absichten. Hier ging es um die gegenseitige Erbauung. Betrachten Sie folgende Stelle:
Wie ist es nun, ihr Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch etwas: einen Psalm, eine Lehre, eine Sprachenrede, eine Offenbarung, eine Auslegung: alles lasst zur Erbauung geschehen! (1 Kor 14,6). 2
Und lasst uns aufeinander achtgeben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht! (Heb 10,24-25).
Die regulären und schriftgemäßen Versammlungen der Gemeinde erlaubten jedem Mitglied , sich am Aufbau des Leibes Christi zu beteiligen (vgl. Eph 4,16). Es gab keinen, der alles anführte, keinen, der in der „Mitte“ stand.
Wenn sich die Gemeinde damals traf, so war es nicht jedes Mal dieselbe Person, die lehrte. Jedes Mitglied hatte das Vorrecht und die Verantwortung, der Gemeinde zu dienen. Gegenseitige Ermutigung war das Kennzeichen der Versammlungen. „Jeder von euch“: so lautete das Motto.
Читать дальше