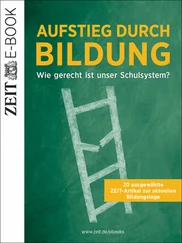Mit ihr entstand und verband sich mein Verlangen, hinter die Erscheinungen dieser Welt zu schauen, ihre geheimen Zusammenhänge zu erkunden und für mich erlebbar zu machen.
Ich begann zu ahnen, wie zerrissen diese Welt war und ist, in der wir zu Hause sind. Die Kraft des Lebens „Miteinander und Füreinander“ schien verlorengegangen zu sein.
Ich spürte plötzlich, welcher Hass in allem steckte, wie es uns sehr schwer nur gelingen wollte, selbst zu einer gestaltenden Kraft zu werden.
Ich suchte mit Miri nach den Sinn des Lebens in der Vergangenheit und wollte so die Spur zum Leben in der Gegenwart finden.
Ich lernte, nicht mehr hilflos und blind durch die Ereignisse zu treiben, nicht mehr ohnmächtig und ohne Halt und Ziel zu existieren, sondern einen neuen Haltepunkt zu suchen und zu finden.
Die Zeitenreise wurde zur Erkenntnisreise. Ich sah, dass Diktaturen das Leben verwüsten konnten, aber ich sah auch, dass sie bezwingbar waren. Miri war es, die zu mir sagte: ``Markus`` schau, sieh dort den ``Völkischen Beobachter`` vom 9. November 1938 vom Winde getrieben durch die Müllerstrasse in Berlin wehen.
Die Menschen treten ihn achtlos beiseite. ``Das Vergängliche`` erkannte ich und das Bleibende, und ich fand im Ansatz den Weg, der es mir ermöglichte, selbst bestimmt und glücklich zu leben.
Gutes zu fühlen und zu tun im richtigen Moment, das verhieß mir die Wanderin der Nacht, sei ein Weg, den ich gehen könnte.
Wie ich zu dieser Einsicht gelangte, das will ich nun erzählen.
Der 21. Dezember 1991 begann mit der gleichen Gewalt wie der Vortag. Noch immer tobte über der Stadt ein Schneesturm. Die Menschen auf den Straßen waren schleichende Schatten.
Für mich ein Tag, an dem ich lieber im Bett geblieben wäre. Allein die Vorstellung, dass ich noch bis zum 24. Dezember arbeiten musste, machte mir das Aufstehen nicht gerade leicht.
Meine Wohnung war dunkel, trist. Ich hatte keine Lust auf Weihnachtsdekoration. In den Jahren davor war mein Wohnzimmerfenster immer festlich geschmückt gewesen. Dieses Jahr hatte ich dazu keine Stimmung. Ich fühlte mich leer, ausgelaugt.
„He, alter Junge, was ist mit dir los? Du bist schon fünfunddreißig Jahre auf dieser Welt, und deine Gefühlswelt ist die eines alternden Teenagers, dem gerade sein Idol gestorben ist! Verdammt noch mal, Markus, reiß dich zusammen, lass dich nicht hängen!“ Verschwinde, kümmere dich um deinen eigenen Kram.„Ich kann dich wirklich nicht verstehen, Markus!“ Schön, mein Herr. Ich musste selbst lachen bei diesem Gedankenspiel. Ist schon gut, ich werde mich bessern! „Na, geht doch, alter Junge!“
Zurück aus meinem Ich, führten meine Gedanken mich zu meinem Nachbarn – Jochen Lampe. Der hatte es besser als ich, seit sechs Wochen war er jetzt Rentner, seine Frau Gerda schmückte alles festlich. Sicher, ich mochte die leuchtende Pracht in den Fenstern. Aber ich konnte mich nicht dazu durchringen, es selbst zu tun.
In unserem Haus lebten noch zwei andere Mieter: im Erdgeschoss Heinz Grahn mit seiner Frau Wilhelmine und im zweiten Obergeschoss unsere alte Dame, Fräulein Erika Grüneberg, schon seit 1932 hier ansässig. Ich glaube, sie war die erste Mieterin, die schon als Kind hierhergezogen war. Damals war es noch ein Neubau. Wir pflegten einen guten nachbarschaftlichen Kontakt zueinander. Jeder war für den anderen da, wenn es mal eng wurde.
Es wurde langsam Zeit, dass ich mich fertig machte. Es war schon wieder sieben nach acht, mein Bus fuhr in fünfzehn Minuten an der Ecke Lampesteig, Richtung U-Bahnhof Residenzstraße.
In den letzten Tagen war ich vergesslich. Beim Rausgehen ließ ich meinen Hut liegen, vergaß meine Handschuhe. Am Schlimmsten war es vor vier Tagen gewesen, da hatte ich meine Hausschuhe noch angehabt, als ich das Haus verlassen wollte. Heinz hatte hinter mir hergerufen: „Markus, du hast ja noch deine Hausschuhe an!“
Ich schaute auf meine Füße. „Scheiße, schon wieder was vergessen!“
Beim Hochrennen lachte Heinz mir hinterher: „Markus, renn nicht so schnell, sonst kommst du nicht heil zur Arbeit!“
In die Stiefel und weg war ich, mit großen Sätzen die Treppe runter auf die Straße, dabei riss ich fast zwei Leute um. Ich rief gerade noch „Entschuldigung“, dann war ich schon um die Ecke. Noch hundert Meter, Markus, dann hast du den Bus erreicht!
An der Haltestelle war kein Mensch mehr da. Ein Blick auf die Uhr sagte warum: fünf Minuten zu spät! Verdammt, warum war die Zeit seit einigen Tagen so gegen mich? Was ich auch machte, immer kam ich zu spät!
Der Schneesturm rüttelte mich, als wollte er mich für meine schlampige Tageseinteilung bestrafen. Ach, was sollte das ganze Gejammer? Mit hängendem Kopf machte ich mich zu Fuß auf den Weg zum U-Bahnhof Residenzstraße. Die Minuten vergingen im Schneesturm wie Stunden; dreißig Minuten brauchte ich, um den kurzen Weg zurückzulegen. Einmal war ich kurz davor, mich auf die Nase zu legen. Beim Rutschen und Schlittern tastete ich nach etwas zum Festhalten: Mal war es der Briefkasten am Straßenrand, mal der Arm einer Person, die ich nicht kannte, im Sturm blind unterwegs wie ich. Ich hörte noch ihr Fluchen: „Pass doch auf, du alter Sack!“ Ich tat so, als würde es nicht mich treffen. Markus, nur weiter, noch ein paar Schritte, machte ich mir Mut.
Bevor ich das Ziel erreichte, riss mich das unaufhörlich fauchende Sturmschneegemisch wieder von den Beinen. Vor mir sah ich etwas Dunkles. Ich griff mit beiden Händen danach – eine Laterne. Ich rutschte bis auf die Knie an ihr runter. So ein blöder Tag! So langsam reichte es mir. In mir kochte es; am liebsten wäre ich den Weg zurückgeflogen: rein ins Bett und schlafen bis zum Frühling! Der Verzweiflung folgte auf den Fuß die Ermahnung meiner inneren Stimme: Aber nicht doch, Markus, ab zur Arbeit und kein Weg zurück!
Bei diesem Gedankenspiel meines Seelenfreundes lachte ich aus ganzem Herzen. Ich raffte mich auf, noch ein paar Meter, endlich war mein Ziel, die U-Bahn, erreicht! Ich fühlte schon die Wärme, die mir aus dem Schacht lockend entgegenkam, rannte die Treppe runter. Der Zug stand gerade noch, der Schaffner rief: „Einsteigen, bitte!“
Ein, zwei, drei große Schritte – im letzten Moment geschafft! Ich blickte mich um. Scheibenkleister, der Pöbel hat sich hier breit gemacht, keiner denkt an mich! Einen Platz bekam ich nicht, alles voller Menschen. Markus, ist doch egal, du bist noch jung, hast ja noch Kraft, sprach ich mir Mut zu.
In meinem morgendlichen Durcheinander fiel mir nicht auf, welch schöner vorweihnachtlicher Duft aus den Wohnungen bei mir im Haus in meine Nase drang.
„Komisch, ich stehe hier unter Menschen und spüre meine Nase nach Mandel und Pfefferkuchen suchen“, stehe mit meinen Gedankenbeinen im Treppenhaus.
Der Zug raste von einer Station zur nächsten. Nach der vierten verließen viele die Bahn. Ich sicherte mir erst einmal einen guten Platz. Meinen Nachbarn links musste ich ein bisschen beiseiteschieben – der hatte seine Tageszeitung mit beiden Armen ausgebreitet, als gehöre ihm der ganze Sitz. Er schaute mich grimmig an, als würde er sagen: Das ist mein Platz!
„Widerlicher alter Sack , dachte ich, du solltest dich lieber mal rasieren und deine Wäsche wechseln, hier riecht’s streng!“ Über meine inneren Worte bog ich mich innerlich vor Lachen, ich schmunzelte vor mich hin. Das hatte zur Folge, dass die Dame mir gegenüber, sie war so um die vierzig, mir freundlich zulächelte. Na, geht doch, Markus, lass die Aggressionen anderer nicht an dich ran, und der Tag wird gut! Zu diesem Zeitpunkt war mir noch nicht klar, was für ereignisreiche Tage vor mir liegen sollten.
Читать дальше