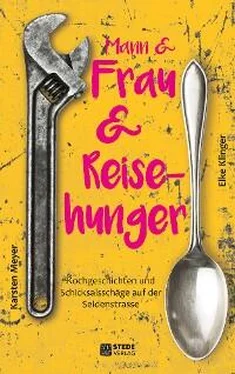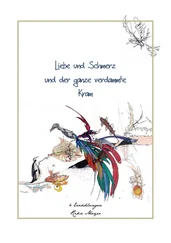Ergriffen bin ich von den Einblicken, die mir Monika hinter die Kulissen ihres islamischen Glaubens gewährt. Bis heute weiß ich nicht, wie ich ihr danken kann, für die Einmaligkeit, mich an ihrem Gebet teilhaben zu lassen. Los geht es mit der rituellen Waschung von Gesicht, Unterarmen und Fußrücken. Dann breitet sie in aller Ruhe ihren Gebetsteppich aus und beginnt mit geschlossenen Augen zu sprechen. Dabei erhebt sie sich, fällt auf die Knie, lässt ihre Stirn den Boden berühren. Eine Choreographie, dem Bewegen in Trance gleich. Immer wieder im Rhythmus der Worte, in der Melodie ihres Körpers. Dass ich dabei bin, auf Atemnähe, lässt mich schamhaft zurück. Als sähe ich etwas, das nicht für meine Augen bestimmt ist. Ich schätze das Vertrauen Monikas, versuche fast tonlos zu atmen und ziehe mich in die hinterste Ecke des kleinen Raumes zurück. Javads Sache ist das mit dem Beten nicht, erzählt mir Monika später. Er hält es mehr mit der Natur und der Farm, während der Glaube in Monikas Leben einen festen Platz eingenommen hat.
Doch des Abenteuers kein Ende. Gäste haben sich angesagt. Die Familie kommt zu Besuch. Und warum? Na klar, wir alle wollen gemeinsam kochen. Mehr und mehr Frauen versammeln sich in der Küche. Jede hat eine andere Rezeptidee mitgebracht. Die Männer sitzen heute im Wohnzimmer auf dem mit dicken Teppichen belegten Boden. Mal an den Wänden angelehnt, in kleinen Grüppchen mitten im Raum, oder auf dem Smartphone spielend in irgendeiner Ecke. Der Fernseher zeigt eine Talkshow. Lärmend geben die Akteure ihr Bestes. Sie sind definitiv Teil der Familienszene. Die Lautstärke ihrer Stimmen haben die Männer denen der Talkmaster angepasst. In der Küche ganz anders. Die Mädchen und ihre Mütter kichern vergnügt miteinander, beim Tee, dem permanenten Begleiter. Die Tanten und Cousinen und Schwägerinnen und Schwiegertöchter erzählen miteinander, schneiden Fleisch, schnippeln Gemüse, dünsten an, braten aus. Jeder Handgriff sitzt. Kochen ist Basis. Da gibt es nichts zu vertun. Auf die Fett spritzende Pfanne wird Zeitung gelegt. Herrliche Idee, wie ich finde. Der Reis gart, indem um den Deckel ein Handtuch gelegt wird. So verfängt sich der Wasserdampf darin und tropft nicht in den Reis zurück. Ich bin damit beschäftigt zuzuschauen, mir die Schritte einzuprägen, aufzuschreiben, wie was geht. Dabei fotografiere ich, meiner eigenen Erinnerung später auf die Sprünge helfend. Fasziniert bin ich von den kunstvollen Nachspeisen aus Granatapfelgelee, den farbenfrohen Salaten in Schmetterlingsform. Die Frauen schneiden ein und aus, kreieren ihre ganz eigenen Muster und Ornamente. Wie das Design einer kunstvollen Hennazeichnung sieht der bunt gedeckte Tisch am Ende aus. Ich probiere von allem, um jede Frau auf diese Weise zu würdigen. Ihr ganzer Stolz ist nun auf dem großen runden Tisch versammelt. Fasziniert darüber, Teil dieses quirligen Familientreffens zu sein, setze ich mich mit meinen zusammengetragenen Leckereien auf den Boden, genieße jede Nuance der Geschmacksexplosion und bin mehr als erfüllt. Nicht nur vom Essen, mehr noch von den vielschichtigen Eindrücken, die ihre Spur in mir hinterlassen. So selbstverständlich und ohne Vorbehalte begegnen uns alle. Wir halten einander die Bäuche vor Lachen beim Fotografieren in den wildesten Posen. Eine unbändige Lebensfreude strahlt aus den Gesichtern der Jugend heraus. Im öffentlichen Raum zurückgehalten, entfaltet sie ihren Glanz im Privaten. Als sei die Wohnungstür ein Flaschenhals, durch den die Emotion nach innen spritzt. Innen bedeutet auch in einem Club-Café. Ganz neu eröffnet. Ein Neffe der Familie hat es, gemeinsam mit Freunden, im Keller eines Hauses gegründet. Musik darf nicht nach außen dringen, das pausbäckige Gelächter der alkoholfreien Szene ebensowenig. Die Scheiben sind abgedunkelt. Abgedämmt die Eingangstür. Und doch haben alle einen Mega-Spaß. Da spielt einer Gitarre, dort singt ein anderer dazu. Hier kreiert jemand einen Super-Kakao, dort gibt es Gebäck an den Tischen. Jungen und Mädchen hocken selbstverständlich zusammen, quatschen, reden, erzählen miteinander. Ganz normal halt. Wie ich es mir denken würde, überall auf der Welt. Hier nun ist es was Besonderes, was Mutiges, was ganz Spezielles. Mit unserem Kommen bringen wir, in den Augen der Jugendlichen, ihrem Club-Café Glück. Und so tanzen wir ausgelassen, einander verbunden, alle miteinander. Und fühlen uns frei, frei, frei dabei, auch wenn ich aufpassen muss, dass mein Kopftuch nicht rutscht in der Stadt der Granatapfelromantik.

Fotos
Der Medicus, Titel eines Buches, dessen opulente Geschichten mir seit Jahren Bilder in den Kopf gebrannt haben. Nun gibt es den Film dazu. Nicht meine Bilder, sondern die eines deutschen Regisseurs. Ich sitze Wochen vor Antritt unserer geplanten großen Jahresreise im Kino und koste seit Langem wieder einmal aus dem Trog der Vorfreude und des Gefühls, nicht abwarten zu können. Von Sandstürmen gepeinigt zieht die Karawane im Film über Jahre dahin. Das England der frühen Tage mit seinen mitunter steifen Ideen hinter sich lassend, macht sich der junge Bader auf, um in Isfahan in Persien zum Medicus ausgebildet zu werden. Die Stadt – ein einziges Geflecht aus Torbögen und Hallen und Nischen und Gemächern. Der Schweiß der Tage scheint der Kitt der Lehmziegel zu sein. Die Gesichter, stets glänzend von den Perlen des eigenen Körpersafts, sind wach und offen, die Blicke neugierig und mutig. Eine Atmosphäre des Miteinander-Denkens, des Lehrens und Lernens, des Hinschauens, wohin zuvor noch niemand gesehen hat. Dieses zeitlose Sehnen nach Erkennen und Erfahren hat die Menschen in den Zeiten des Medicus getrieben und treibt auch mich immer wieder an. Auch wenn meine Erkenntnis die des Nicht-Wissens in immer tieferen Sphären ist. An diesem Abend im Kino weiß ich eins: Da will ich hin! In den Iran nach Isfahan! Wohl wissend, dass das Kino mir ganz andere Orte und Kulissen als das Stadtbild Isfahans verkauft. In diesem Augenblick bin ich käuflich und überlasse mich dem Reich meiner eigenen Phantasie: Ich sehe mich selbst in Tücher gehüllt, damit niemand einen Blick auf meine blonden Haare würfe. Ganz so, wie einst der Medicus sein fremdländisches Gesicht verbarg, um in der Stadt kein Aufsehen zu erregen. Wie meine Haut den goldgelben Ton der Lehmziegel reflektiert und selbst im Winter die vorherrschenden Farbtöne die warmen sind. Kein Einheitsgrau unserer mitteleuropäischen Wintertage.
Und nun, Monate später? So viel Blau der Moscheen, soviel Weiß der Mosaike und ja, auch die warmen Lehmziegeltöne der Brücken haben ihren großflächigen Anteil, als ich in den Straßen von Isfahan stehe. Ich bin wahrhaftig hier. Habe es geschafft, innerhalb von drei Monaten, nicht Jahren, hierher zu gelangen. Mein Traum ist wahr geworden. Auch wenn keine beschauliche Karawanenstätte das erste ist, woran sich mein Blick heftet. Sondern das Vielstraßengeflecht einer lauten, schnellen, pulsierenden, 1,8 Millionen Einwohner zählenden Großstadt. Isfahan Ost und Nord und Süd und West. Isfahan Südost, Nordwest und so weiter sind jeweils nur Teile der Stadt. In ihrer Ausdehnung fast wie eigene Städte wirkend. Wieder einmal sind wir verabredet und wieder einmal wissen wir nicht, wo und mit wem. Die Wegbeschreibung klang am Telefon einfach. Doch das Suchen und Nichtfinden mit unserem Leo gleicht der Fahrt auf einer Achterbahn. Überall blinkt und leuchtet es, überall sind Entscheidungen zum Abbiegen oder lieber doch nicht, in Millisekunden zu fällen, werden Richtungen nur in Farsi geschrieben – und am Ende haben wir so wieder einmal keine Chance. Die rasenden Perser machen uns mit ihrer sprunghaften Fahrweise halb verrückt. Von einem Schreckmoment fallen wir in die nächste Beinah-Ohnmacht. Uns bleibt nur eins, so meinen wir, und entschließen uns zur Opossum-Taktik. Einfach nicht mehr bewegen und abwarten, was passiert. Außer dem Klicken der Warnblinkanlage im Rhythmus unserer gestressten Herzen geschieht nach unserem Stopp am Straßenrand erst mal nichts. Also, in den nächsten Laden gehen, einem Mann darin wortlos, da sprachlos, das Telefon ans Ohr drücken und darauf hoffen, dass die Stimme am anderen Ende danach fragt, wo genau sich der Ort befindet, an welchem jenem Mann das Telefon ans Ohr gepresst wird. Weiter darauf zu vertrauen, dass irgendwann irgendwer diesen Wegweisungen und Ortsbestimmungen einen Punkt zuordnen kann und man uns dort findet. Der eine Teil in uns besteht aus Hoffnung, der andere aus Vertrauen. Und Geduld. Die sitzt vorn im Fahrerhaus und hält ihre beiden Kumpane bei Laune. So routiniert macht sie das inzwischen. Wir merken kaum etwas davon und harren einfach der Personen, die da vielleicht irgendwann kommen. Kein Aktionismus treibt uns mehr, eine sinnfreie Handlung zu vollführen, weil man ja was tun müsse. Kein „Wie lange dauert das denn?“ zischt durch unsere Leo-Kabine. Spaß haben wir am Beobachten der nächtlichen Straßenszenen. Ein Arzt scheint seinen Job in einem der nahen Häuser zu verrichten. Wahrscheinlich ist die Nachtpraxis sein Tagesgeschäft. Und so halten in verlässlichem Rhythmus und Abstand Autos vor ebendiesem Haus. Besorgte Mütter steigen aus. Männer, das kranke Kind auf dem Arm tragend. Die Sorge ist selbst unter dem schwarzen Tschador zu sehen, so sehr überträgt sie sich auf Haltung und Gang der Mütter. Zurück kommen sie eiligen Schritts, in einer anderen Tür verschwindend, wahrscheinlich der Apotheke. Hell erleuchtet ist das hier alles nicht gerade. Alle sind es gewöhnt. So fahren manche Autos gleich ganz ohne Licht vor. Männer springen nur kurz aus dem Wagen, um mit der Medizin im Beutelchen sogleich zu verschwinden. Wie vertraut einem ein Ort wird, wenn man mal mehr als eine Eiskugellänge an ihm verweilt. Den Polizisten der Straße kennen wir nun schon. Der versucht, das absolute Halteverbot durchzusetzen. Nur leider hat er mit uns einen so gewaltig Verstoßenden, dass ihm bei all den Kleinwagen die Argumente ausgehen. Wohin er uns schicken soll, weiß er auch nicht. Also gibt er nicht auf, aber nach. Busse unternehmen den Versuch, vor Leo in eine Haltestelle einzubiegen. Ein vergebliches Unterfangen. Leo ist zu groß und die Busse zu ungelenk. Da bleibt den Leuten nichts übrig, als im rasenden Verkehr das Weite zu suchen. Das alles in der Nacht und das alles im gleichförmigen Klick-Takt der Warnblinkanlage. Alles und alle scheinen der unausgesprochenen Anweisung zu folgen: Nach jedem Klicken der Warnblinkanlage bitte eine Bewegung vollführen.
Читать дальше