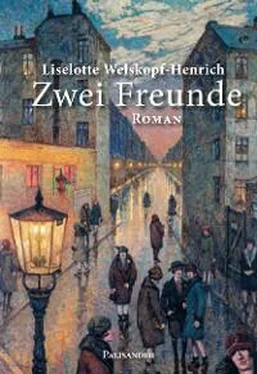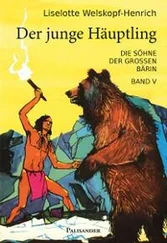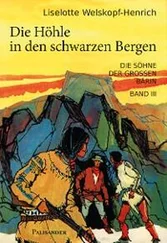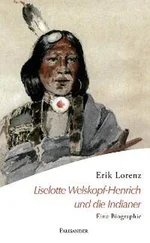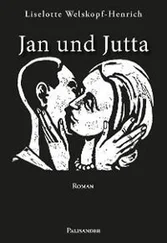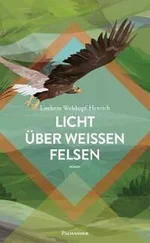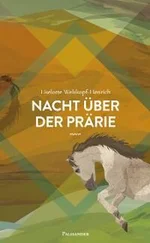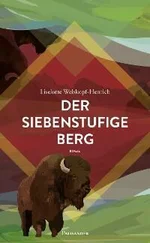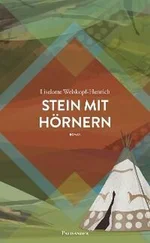»Sie haben sich auch mit wirtschaftlichen Dingen befaßt?«
»Ja.«
»Vielleicht lesen Sie nebenbei die kleine Ausarbeitung hier, die Vorgänge am Rande unseres Arbeitsgebietes behandelt. Vertraulich. Wenn Sie sich zu angestrichenen Fällen irgendwelche Gedanken machen oder Kritik erlauben wollen … um so besser.«
Stumme Verbeugung.
Oskar Wichmann erhielt die Blätter im schützenden blauen Aktendeckel. Er faßte ihn vorsichtig, in dem Gefühl der noch nicht durchschauten Bedeutung des Inhalts, und beobachtete die Art, in der sich die Mundwinkel des Ministerialrats leicht herunterzogen.
Es klopfte an der Polstertür. Die beiden Mitarbeiter traten ein, und Wichmann, der ihnen vorgestellt wurde, merkte sich nicht viel mehr als die Namen und den auffallenden Unterschied der Erscheinung zwischen dem stämmigen, mit körperlicher Energie geladenen Regierungsrat Korts und dem blassen Inspektor Baier, der im Hinausgehen seine Brille putzte.
Die drei Herren waren gemeinsam wieder verabschiedet worden. Wichmann folgte dem Inspektor, um alles das zu hören und entgegenzunehmen, was zu den äußerlichen Bedürfnissen, Beschränkungen und Aufgaben eines Assessors der Abteilung III im Ministerium gehörte.
Als Wichmann endlich, sich selbst überlassen, in seinem neuen Dienstzimmer stand, öffnete er einen Spalt des Fensters. Schattigkühle Herbstluft wehte aus dem Hof herein, den das Gebäude in einem großen Viereck umschloß. Zwei Ulmen, die ihre Blätter verloren, reichten mit der Spitze der Zweige in den Morgensonnenschein, der über das Dach weg in schräger Richtung nur die oberen Stockwerke des Hauses traf. Oskar Wichmann setzte sich zum erstenmal auf seinen Schreibtischstuhl, der nun tagaus, tagein sein Platz sein sollte. Noch einmal rückte er an den Bleistiften, bis sie in ganz genauer Reihe lagen. Inspektor Baier hatte ihm schüchtern und dennoch bestimmt erklärt, daß ein Assessor und ein Regierungsrat mit Tintenstift oder Tinte zeichne, beziehungsweise anmerke, ein Ministerialrat mit Blaustift, der Ministerialdirektor mit Rotstift, der Staatssekretär grün und der Minister gelb. In eben dieser Reihenfolge der Amtsstufen lagen die Stifte jetzt auf dem Tisch des Anfängers und bezeichneten die Möglichkeiten seiner Zukunft – schwarz, blau, rot, grün – bis zum Staatssekretär. Wenn es ihm beliebte, in diesem Hause alt zu werden! Nein, vermutlich beliebte ihm dies nicht. Hier wollte er nur einige erste Schritte tun, um dann – was dann? Er wußte es selbst noch nicht.
Ehe der Assessor begann, die Aufträge seines unmittelbaren Vorgesetzten auszuführen, konnte er sich im Vorzimmer von Boschhofer telefonisch zur Vorstellung anmelden. Das Verzeichnis der Ruf- und Zimmernummern der im Hause Diensttuenden verriet, daß der Ministerialdirektor im ersten Stock hauste. Boschhofer, Josef Boschhofer; Vorzimmer-Ruf Nr. 269. Als Wichmann die Hand nach dem Hörer ausstreckte, der schwarz, gekrümmt auf der Gabel lag, durchflutete ihn eine eigentümliche Ahnung, und er zögerte etwas, ehe er zugriff. Was denn, fürchtete er sich? Er war ja wohl verrückt!
Die Zentrale hatte eine schnippische weibliche Stimme.
»Nr. 269 bitte.«
»Vorzimmer von Ministerialdirektor Boschhofer.«
Wichmann brachte sein Anliegen vor.
Die Antwort der Sekretärin klang nach einem längst volljährigen Mädchen mit dickem Hals und starkem Busen. Ministerialdirektor Boschhofer sei durch Sitzungen sehr in Anspruch genommen – Dr. Wichmann werde vorgemerkt. Anruf gegebenenfalls auch in der Handbücherei, ja. So schnell werde er jedoch kaum empfangen werden.
»Danke.«
Der Hörer knackte wieder auf die Gabel. Boschhofer … Boschhofer. Wichmann summte den Namen vor sich hin. Namen hatten schon als Kind seine Neugier geweckt. Er liebte die farbigen, vorstellungskräftigen Bezeichnungen, die er in seinen Indianerbüchern gefunden hatte: Langspeer, Nachtwandler, brennendes Wasser, flinker Hirsch – Stern, der über dem Berge aufsteigt, und »ihre Füße singen, wenn sie geht«. Boschhofer … Boschhofer … Es gab Märchen, in denen man Namen wissen mußte, um zu zaubern, in denen der Name eine eigene Bannkraft hatte. Alle diese Beziehungen waren jetzt verschüttet von Straßenstaub und Wissenschaft. Nur ein letztes war noch geblieben, der Zusammenhang von Name, Geschichte und Landschaft. Boschhofer … starker dicker Mann, etwas ganz anderes als das Nordlicht Grevenhagen. Eine Beziehung von Acker, Bier, Mastochsen, Barockkirchen und goldenen Engeln, Fett, Schlauheit, Selbstbewußtsein. Die Vorzimmerdame mußte bunter gekleidet sein als Fräulein du Prel, die Unnahbare. Grevenhagen – Grevenhagen – Patrizierahnen, Marschen und tangbehangene Deiche, Schiffsmasten, salziger Geruch der weither rollenden Wogen, Kühle und ein wenig müde gewordener Hochmut und ihm vorgesetzt: Boschhofer – Boschhofer … Da kreuzten sich Ströme, und vielleicht strudelten Wirbel. Der Assessor bildete sich plötzlich mit Gewißheit ein, daß Grevenhagen den Namen Boschhofer auf eine gezwungene Art ausgesprochen habe. Wichmann hatte sich vor dem Hörer gescheut wie ein Mann, der in unbekannte Linien eines Kraftfeldes hineinspringen soll.
Nun war es geschehen.
Wenn der einsame Assessor an seinem Schreibtisch den Kopf hob, sah er die kahle, gelblich gestrichene Wand vor sich, links lag das Fenster. Sein Dienstzimmer war nicht groß; er hockte auf beschränktem Raum zwischen Tisch, Schrank, Regal, Aktenbock und verdecktem Waschtisch. Sitzgelegenheiten waren nur für zwei Besucher vorgesehen. Assessoren hielten noch keine Konferenzen ab.
Die Handbücherei lag nach der anderen Seite der Ottostraße zu. Er wollte später hinübergehen. Erst reizten ihn die Blätter in der blauen Mappe.
Als er den Deckel aufschlug, fand er vier Seiten Schreibmaschinenschrift im Original, auf festem weißem Papier, wie es schien, ganz ohne Fehler geschrieben, von Fräulein du Prel natürlich; er kannte schon den Typ der Adlermaschine. Gleich die ersten Sätze verrieten, daß es sich um ein Exposé über die zu erwartende Konjunkturentwicklunghandelte. Das Ganze war nicht so optimistisch gestimmt, wie Wichmann gefühlsmäßig für richtig gehalten hätte, doch waren die weniger günstigen Prognosen einleuchtend begründet. Auf der vierten Seite, rechts unten in der Ecke, stand das in Blaustift ausgeführte »G« mit dem versteckten Schnörkel. Eine Ausarbeitung des Ministerialrats persönlich.
Wichmann suchte angestrichene Stellen, aber er konnte nicht mehr als die eine auf der zweiten Seite entdecken, die ihm schon beim ersten Blick aufgefallen war. Der Satz: »Die Zahl der Hauptunterstützungsempfänger in der Arbeitslosenversicherung hielt sich im August 1928 noch auf dem jahreszeitlich bedingten niedrigen Stand« war mit Bleistift dick unterstrichen, und am Rande dieser Zeile stand ein grünes Fragezeichen.
Ein grünes Fragezeichen.
Vorrecht des Staatssekretärs!
Wichmann klappte die Mappe zu, griff sich zwanzig linienlose Bogen, untersuchte, ob der Füllhalter ordnungsgemäß in der linken Brusttasche hing, und machte sich auf den Weg. In der Handbücherei wollte er die Unterlagen suchen, um den beanstandeten Satz nachzuprüfen.
Der langgestreckte Raum der Abteilungsbücherei mit den großen Fenstern war ohne Aufsicht und Besucher. Das Licht lag hell auf den abgewetzten Stellen der grünen Tischbespannung; es roch nach dem Staub der Bücherborde, die schwer belastet die Wände säumten. Die Ärmlichkeit des Raumes, die hilflose Pedanterie, mit der ein Handbesen die Wolle der Tischbespannung abgekehrt zu haben schien, um den Staub in die Ecken zu treiben, in denen er die papiernen Mumien juristischer Geister fraß, die alten ausgebleichten Tintenkleckse, Zeugen vergangenen Fleißes, erinnerten – Wichmann wußte nicht, warum – an den Inspektor Baier und seine Brille in der billigen Stahlfassung. Während Wichmann die Aufschriften auf den Rücken der Gesetzblätter, der Kompendien und Kommentare zu entziffern suchte, fiel ihm ein, daß Herr Baier wirklich als der für die Ordnung dieser Bibliothek Verantwortliche genannt worden war.
Читать дальше