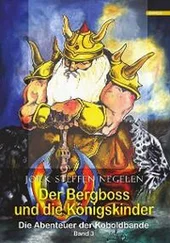Nichtsdestotrotz begegneten ihm die Männer freundlich, man lächelte, schmunzelte und lachte viel. Ein Lächeln unter den Wolken von Schwermut und Melancholie.
Ein junges rothaariges Mädchen tauchte ab und zu auf der Farm auf.
Eine Internatsschülerin aus der Stadt.
Der Fremde sah sie nur an den Wochenenden. Wohl eine Verwandte, sie kochte manchmal, hängte die Wäsche zum Trocknen auf, sprach vom Gerede aus der Stadt: Demnächst sei ein Unwetter zu erwarten, eine Springflut, gar eine Sintflut.
Die Männer hörten zu und sagten nichts, woraufhin das Mädchen sich zumeist in eine Ecke verzog und las. Der Fremde sagte ohnehin kaum etwas, zu Gerüchten schon gar nichts.
Er sah dem Mädchen gern beim Lesen zu. Ihren Namen erfuhr er erst später.
Sie war die Nichte des Farmers. Mutter und Vater des Fischermädchens waren vor Jahren bei stürmischer See ertrunken. Und nun kümmerte sich der Onkel um sie.
Fiona.
Sie war ein Stimmungsaufheller, der Sonnenstrahl im Schatten der alten Farm mit den schweigsamen Männern. Dem Fremden gefiel das Lachen, ihre unbekümmerte Art, so schien es zumindest. Jedenfalls machte sie sich über jeden lustig, der ihr über den Weg lief, und nur dem Fremden fiel eine Spur Sarkasmus in ihrem Spott auf.
Der Mann lernte ihn bald kennen: Sie taufte ihn „sloth“, Faultier also, sein Forschungsthema, es hätte schlimmer kommen können, fand er.
Die Männer nannten sie ‚darling’ oder Fiona, je nach Laune und Stimmung.
Rothaarig und das blasse Gesicht mit Sommersprossen übersät – natürlich.
Sie unterschied sich äußerlich kaum von ihren Altersgenossinnen hier in dieser Region. Doch es gab einen Unterschied: Sie hielt sich Vergnügungen fern, wenn es denn ging.
Man sah sie selten im hiesigen Pub, wo die jungen Mädchen der folk music lauschten, an der Theke stout tranken, mit den Jungs um die Häuser zogen.
Schon gar nicht sah man sie sonntags in der Kirche, was in der Stadt so ziemlich egal war, im Dorf aber eher nicht. Ihr Onkel und ihre Cousins versäumten nie die sonntägliche Predigt.
Dafür las sie gern. Stundenlang lag sie in ihrer Kammer und schmökerte.
Bücher waren ihre Welt. Und an ihre „innere Bibliothek“ – frühe, prägende Leseerlebnisse und lebenslange Begleiter – ließ sie keinen der Männer ran, was auch nicht sonderlich schwierig war: Man las hier gewöhnlich nicht.
Klar würde sie nicht ewig hier im Nordwesten bleiben, sie würde wie fast alle ihre Altersgenossinnen in die Städte der großen Nachbarinsel im Osten gehen und – über kurz oder lang – vielleicht sogar studieren? Man traute es ihr zu.
Und ihr Onkel war sich sicher: Sie weiß, was sie will, eigensinnig wie sie ist.
Einmal trafen sich der Fremde und Fiona rein zufällig am kleinen Yachthafen. Sie saßen am Steg, beobachteten den Sonnenuntergang und – schwiegen.
Danach trafen sie sich mehrere Male wieder rein zufällig – natürlich – am Hafen.
Sie saßen am Steg, beobachteten den Sonnenuntergang und – schwiegen.
Der Fremde hatte sich mit und in der Zeit eingerichtet.
Er machte es sich oben in seinem Stübchen wohnlich. Seine Bücher fanden vorerst auf der Diele Platz, sein Laptop bequem auf einem Tisch vom Möbeldiscounter.
Auf dem Nachttisch „Sein und Zeit“, das Hauptwerk des deutschen Seinsphilosophen Martin Heidegger. Der Fremde suchte darin Antworten, stieß aber nur auf neue Fragen.
Es waren Fragen, die ihn nicht beunruhigten, sondern seine Neugier weckten: Was ist das Sein? Was ist die Zeit? –
Ein Regal für sein Studienmaterial zimmerte er sich erst später. Er war kein Handwerker, für ein Regal reichte es aber. Immerhin, er konnte hier leidlich arbeiten.
In den ersten Nächten störte ihn das Blöken der Schafe, die mit ihren auf den Rücken getünchten Kreuzen die Farm umzingelten und dem Dasein das Gepräge gaben.
Die Farmer waren freundlich zu ihm – natürlich. Kurzes Knurren als Morgenbegrüßung, rasch hingeworfene Bemerkungen über das Wetter; Unwetter sei im Anmarsch, ob er Regenzeug aus der Stadt mitgebracht habe? Hatte er natürlich nicht. Wozu?
Doch irgendwie störten ihn die Witzeleien hinter vorgehaltener Hand, er sei ein „Faultier“. Und so bot er seine Hilfe an: Der studierte Stadtmensch half manchmal den Stall auszumisten, die blökende Herde in den Stall zu treiben, bei der Schur oder auch mal mit Fiona die Kartoffeln zu schälen oder das Gemüse zu putzen. Sie fragte ihn über das Verhalten der Faultiere aus. Er hielt einen Kurzvortrag über die Entschleunigung und meinte, bei Faultieren tickten eben die Uhren anders. Welche Uhren? spottete sie und er wechselte alsbald das Thema.
Anfangs gefiel ihm das nun wirklich nicht akademische Leben, die Gespräche waren einfach und auf pragmatische Dinge der täglichen Arbeit ausgerichtet. Ein wenig Dorfklatsch, der Nachbarjunge sei mal wieder betrunken aus dem Pub getragen worden, man lachte über das „dämliche Schafgesicht“ des Pfarrers Lynch.
Nur die anzüglichen Pfiffe der Söhne über den schönen Körper der Cousine, wenn sie sich morgens halbnackt, nur mit einem Slip bekleidet, im Hof wusch, störten ihn.
Wenn sie nicht unsere Cousine wäre …
Na ja. Er hatte sie auch aus dem Kammerfenster beobachtet. Und sie gefiel ihm außerordentlich.
Und es passierte, dass er nachts von ihrem Körper träumte.
Nach wenigen Wochen fehlten ihm die Bücher, keine Fachbücher, die hatte er ausreichend und manchmal auch die Nase voll von ihnen. Etwas Schönes, vielleicht ein Poesiebändchen mit Versen eines Dichters, die das Land hier doch in so erstaunlicher Fülle hervorgebracht hatte.
Aber in der ganzen Wirtschaft fand sich nichts dergleichen.
Eines Tages fragte er Fiona. Sie kicherte nur. Die Männer bräuchten hier keine Bücher, es wäre auch nutzlos, sie seien halbe Analphabeten. Sie könnten wohl Rechnungen lesen, wenn nötig ihre Unterschrift geben oder allenfalls die großen Buchstaben der yellow press lesen, die im Pub herumläge.
Doch eines Abends klopfte es an seiner Kammertür. Er öffnete. Fiona stand da im weißen Pyjama, engelsgleich, fand er, das rote Haar wirkte wie ein Lichtkranz über ihren Schultern.
Sie gab ihm lächelnd ein altes, dickleibiges Buch im braunen Ledereinband.
Die Bibel habe sie in einer Truhe im Keller gefunden, alter Familienbesitz, fügte sie hinzu und verschwand. Warum bleibt sie nicht? dachte er.
Dennoch freute er sich. Er blätterte in der Bibel.
Sie war alt, sehr alt, Mitte des 17. Jahrhunderts, aus der Zeit, in der die Truppen Oliver Cromwells in der Stadt Droheda unter den irischen Katholiken wütete. Vorfahren des Onkels hätten sie wohl gerettet, vermutete er.
Der Fremde stutzte. Textpassagen aus dem Alten Testament, in denen von der Sintflut berichtet wird, waren am Rande mit dicken Ausrufezeichen versehen.
Natürlich, der ewige Regen hier im Nordwesten, dachte er. Gab es nicht hier vor einem knappen Menschenalter eine verheerende Springflut?
Die Männer der Farm hatten mit den Unkenrufen, ein Unwetter sei im Anmarsch, recht behalten.
Zunächst wurde es heiß und stickig, es war kaum auszuhalten.
An seiner Schreiberei war nicht zu denken. Er konnte keinen ernsthaften Gedanken für seine Doktorarbeit zum Ende führen. Hier und da stilistische Korrekturen, allenfalls Ergänzungen im Quellenverzeichnis, das war alles.
Und da setzte das Unwetter ein!
Ein Blitz schlug mit solcher Kraft in eine nahe Eiche ein, dass das Haus erschütterte.
Und starker Regen trommelte auf die Dächer.
Man – der Farmer, die zwei Söhne, Fiona und der studierte Stadtmensch – traf sich spontan und doch ziemlich beklommen in der Küche, spottete jeweils über die anderen, sie seien Angsthasen. Und man wurde ungewöhnlich redselig, mit Gewittern kenne man sich aus, man habe sie alle überstanden, solange man noch darüber reden könne, ha, ha …
Читать дальше