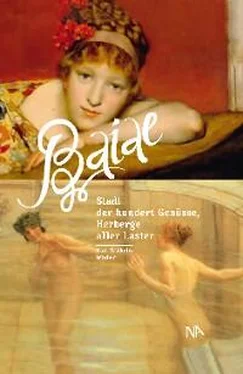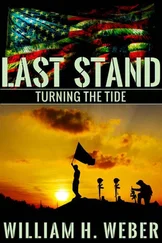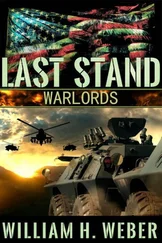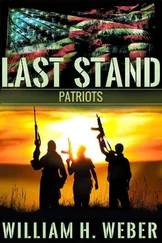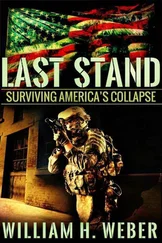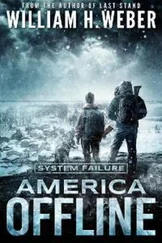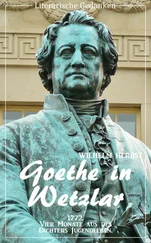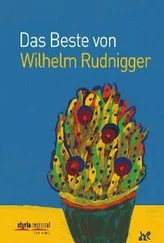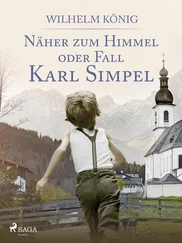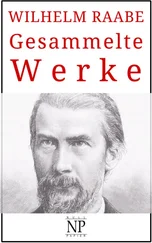Und es war zudem altes Kulturland, dessen blühende Städte von Griechen gegründet worden waren, wo griechische Kultur seit dem 8. Jh. v. Chr. Einzug gehalten und tiefe Spuren hinterlassen hatte. In manchen Gegenden sprach man noch lange nach der römischen Eroberung griechisch; besonders Neapel galt als Graeca urbs (Tac. ann. XV 33, 2; vgl. Vell. Pat. I 4, 2), als Stadt mit griechischem Flair, griechischer Bildung und griechischer Lebensweise – Klein-Griechenland gewissermaßen mit all den positiven kulturellen Assoziationen, die sich damit verknüpften. Auch das hatte seine touristischen Reize, sodass Statius für Kampanien als Alterswohnsitz gegenüber seiner etwas zögerlichen Ehefrau mit variae oblectamenta vitae werben kann, mit „verschiedenen und verschiedenartigen Annehmlichkeiten des Lebens“ (Stat. silv. III 5, 95).
Dort sein Alter zu verbringen, wo andere Urlaub machen – das war schon in römischer Zeit eine Aussicht, die viele faszinierte. Und die nicht nur Statius veranlasste, sich dauerhaft in Kampanien niederzulassen (zumal das seine Heimat war), sondern auch manchen reichen Römer, der der Hauptstadt auf immer Ade sagte und sein Feriendomizil zum „Erstwohnsitz“ umwidmete. Damit war man zwar nicht mehr „in“ und verlor an politischem und gesellschaftlichem Einfluss, aber man gewann dauerhaft an Lebensqualität – ein secessus , „Rückzug“, in eine zauberhafte Landschaft, in der eine attraktive Natur und eine attraktive Kultur zu einer seltenen Einheit verschmolzen.
Schließlich das heitere, beschwingte Lebensgefühl, das diese Landschaft verkörperte! Die griechisch inspirierte Leichtigkeit des Seins, das Savoirvivre, die Neigung zum Hedonismus als Lebenseinstellung – nicht zufällig war Neapel eine Hochburg der epikureischen Philosophie –: Das war ein geistig-moralisches Klima, das auf viele Besucher anziehend wirkte, mochte da auch manche Klischeevorstellung die Realität überlagern. Dieses Phänomen ist der heutigen Welt ja nicht ganz unbekannt und wird von der Tourismus-Industrie nach Kräften gefördert. Entscheidend für die Stimmung und das Lebensgefühl sind nicht unbedingt die Eindrücke, die der Besucher bei der peregrinatio erhält, sondern die Vorprägungen und Erwartungen, die er in den Urlaub mitbringt. Was nicht kompatibel ist, wird mittels selektiver Wahrnehmung kompatibel gemacht.
Es gab indes auch erbitterte Gegner des kampanischen way of life . Das waren die Moralisten, die vor der verweichlichenden Wirkung der tryphé warnten, der Neigung zur Üppigkeit, Schwelgerei und Ausschweifung, die solchen von der Natur verwöhnten Landstrichen angeblich eigen waren. Wo es dem Menschen allzu leicht gemacht werde, da schlage er schnell über die Stränge, ja versinke in gefährlicher luxuria , „Genusssucht“. Ein Klischee, mit dem man hin und wieder auch Politik machen konnte, indem man die Bewohner und Besucher Kampaniens als wenig verantwortungsvolle und obendrein arrogante Genussmenschen verunglimpfte. Cicero war da keine Ausnahme. Obwohl er selbst Besitzer mehrerer Villen im kampanischen crater delicatus , „Wonnekessel“, war, bediente er in der Rede de lege agraria aus politischem Opportunismus die weit verbreiteten Vorurteile: „Die Campaner waren stets übermütig infolge der Güte ihrer Äcker (…). Mit diesem Überfluss an allem hängt ihre bekannte Anmaßung hauptsächlich zusammen“ (Cic. leg. agr. II 95).
Bei Moralisten erfreute sich diese Umwelttheorie großer Beliebtheit: „Eine allzu reizvolle Landschaft ( amoenitas nimia ) verweichlicht die Sinne“, weiß Seneca, „und ohne Zweifel hat eine Gegend beträchtlichen Einfluss darauf, die Körperkraft zu schwächen“ (Sen. ep. 51, 10). Als Beweisinstanzen dienen ihm das Vieh und der Soldat – beide entwickeln, wenn sie durch eine raue Gegend gefordert werden, eine größere Fähigkeit zur Ausdauer, Strapazen zu ertragen. Ein einziges Winterlager in Kampanien habe ausgereicht, um Hannibals Kräfte zu zerrütten, analysiert Seneca reichlich kühn; die fomenta Campaniae , die „Üppigkeit Kampaniens“, hätten den großen Karthager eher besiegt als die Schneefelder der Alpen (Sen. ep. 51, 5). (Abb. 4)
Das klingt nach einem überzeugenden geschichtlichen Beispiel, steht aber auf historisch wackligen Beinen und illustriert eigentlich nur, wie konsequent Seneca die moralisierende Umwelttheorie vertritt. Wenn sich diese von Simplifizierungen und Klischees nicht freie Deutung dann noch mit der von der Antike geliebten Pauschal-Etikettierung von Völkern und Landschaften – konkret der vermeintlichen levitas Graeca , „griechischen Leichtfertigkeit mit Tendenz zur Haltlosigkeit“ – verband, war eine Legende gezimmert, die die Rezeption nachhaltig beeinflussen sollte. Kampanien – das war dolce vita , angenehm, aber nicht sehr seriös, verlockend, aber auch verführerisch, ein paradiesisches Land mit diabolischem Potential, um es in christlicher Diktion zu formulieren. Tatsächlich nahmen die Kirchenväter einen zentralen paganen „Verunglimpfungstext“ wie Senecas 51. Brief nicht ungern in ihr moralisches Arsenal auf und erwiesen sich als ebenso gelehrige wie dankbare Verwerter „geopsychologischer Plattitüden“ (Stärk, Kampanien 112).


Abb. 4 Reizvolle Landschaft mit Ruinen-Romantik.
Baiae im 19. Jh.; Gemälde von
William Turner
Echte Kampanien-„Fans“ – und die waren deutlich in der Mehrheit – ließen sich von griesgrämigen moralisierenden Bedenkenträgern wenig beeindrucken. Ihr „Schlachtruf“ hieß: nunc Campaniam petamus , „auf jetzt nach Kampanien!“, wenn ihnen der Sinn nach delicata , einem kultivierten Urlaubserlebnis in anmutiger Landschaft, stand (Sen. tr. an. II 13). (Abb. 5)
Zum führenden Ferienort Kampaniens entwickelte sich im 1. Jh. v. Chr. Baiae, ein Ortsteil von Cumae. Neben den allgemeinen Vorzügen Kampaniens verfügte die regio Baiana zusätzlich über ein wertvolles, hochattraktives Alleinstellungsmerkmal. Das waren die heißen Dampf- und Wasserquellen, die der Erde hier entwichen. Die aquae calentes , das warme Thermalwasser Baiaes, wurden schon früh zu therapeutischen Zwecken genutzt. Baiae war zu Beginn seiner fulminanten Entwicklung ein Heilbad – freilich eines, das vor allem gutbetuchte Besucher anzog. Diese Tendenz dynamisierte sich in atemberaubendem Tempo, als die Gegend auch als Standort von villae entdeckt wurde und im 1. Jh. v. Chr. jede Menge reicher Römer als aedificatores , „Bauherren“, anlockte, die sich von den besonderen landschaftlichen Reizen faszinieren ließen: Der Ort lag nicht nur am Meer, sondern verfügte auch über zwei Binnenseen, den Averner See und den nur durch eine schmale Küstenstraße, die via Herculanea, vom Meer getrennten Lucriner See. Das lud zu Segeltörns entlang der Küste, aber auch zu Gondelfahrten auf geschützten Binnengewässern ein. Kaiser Nero war nicht der Einzige, der es liebte, am Golf von Baiae entlangzusegeln und in Ausflugslokalen am Strand Halt zu machen, die einen nicht nur guten Ruf genossen (Suet. Nero 27, 3). Aber gerade das – das Flair des Verruchten – gehörte ebenfalls zum Markenkern Baiaes und zog deutlich mehr Urlauber an, als es abschreckte.


Abb. 5 Luftaufnahme vom kampanischen
Читать дальше