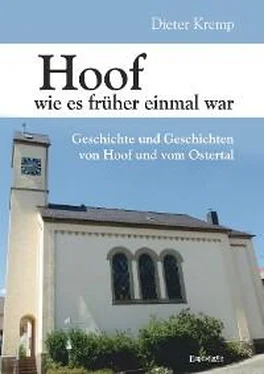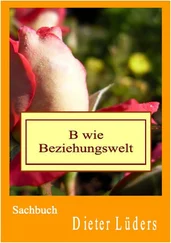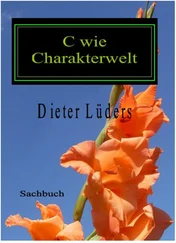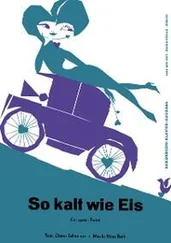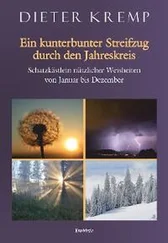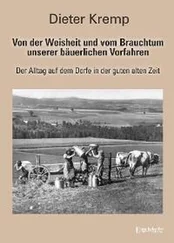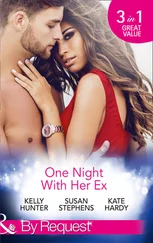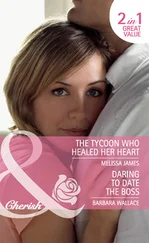Folgende alte männliche Vornamen sind auch heute noch im Ostertal weit verbreitet: Dieter, Jakob, Johann (Johannes), Adam, August, Theobald, Erhard, Gerhard, Walter, Willi (Wilhelm), Karl, Hans, Hannes, Michel, Werner, Robert, Ludwig, Adelbert, Arthur, Bernhard, Emil, Erwin, Friedrich, Herbert, Hermann, Josef, Adolf und Winfried. Der Vorname Adam war ganz früher sehr stark in Hoof verbreitet, heute fast „ausgestorben“.
Ich erkläre hier die Herkunft und Bedeutung der Namen: Dieter (abgeleitet vom germanischen Kriegsgott „thiu“; daraus wurde im althochdeutschen das Wort „thiudisk“, woraus das Wort „deutsch“ wurde. Dieter ist also der „Deutsche“ (volksdeutsche), weshalb der Name auch im Dritten Reich so oft gewählt wurde.
Jakob kommt aus dem hebräischen „ja aqob“, was so viel wie „Fersenhalter“ bedeutet. Bis ins 19. Jahrhundert wurde der Name oft gewählt, geht er doch auf den Apostel Jakob (Jakobus) zurück. Johann – Johannes (biblischer Vorname von hebr. „joschanan“ = der Herr ist gnädig). August (kommt aus dem lateinischen und heißt „der Erhabene“). Emil (kommt aus dem französischen, lateinischen Ursprungs und bedeutet so viel wie „der Sippenhafte“). Erhard (kommt aus dem althochdeutschen „era“, was so viel wie „Ehre“, „Ruhm“, „Ansehen“ bedeutet). Gerhard 8 aus dem althochdeutschen „ger“ (Speer) und „harti“ (hart). Ein „Ger“ war der Wurfspieß der Germanen). Arthur (kommt aus dem englischen, wahrscheinlich keltischen Ursprungs. Er geht auf den keltischen Sagenkönig Artus zurück). Ludwig (kommt aus dem althochdeutschen Wort „hlut“ (berühmt) und „wig“ (Kampf). Ludwig ist also der „berühmte Kämpfer“). Adelbert. Adalbert (aus dem althochdeutschen „adal“ (edel, vornehm) und „beraht“ (glänzend). Adam (aus der Bibel übernommener Vorname, was eigentlich „Mann aus der roten Erde“ heißt). Robert (kommt von „Rupert“ aus dem niederdeutschen und heißt so viel eine „Rute“ („Gerte“). Werner 8 aus dem althochdeutschen „warjan“ (wehren) und „heri“ (Heer). Herbert (aus dem althochdeutschen „heri“ (Heer) und „beraht“ (glänzend). Hermann (aus dem althochdeutschen „heri“ (Heer) und „man“ (Mann). Erwin (aus dem althochdeutschen „heri“ (Herr, Kriegsvolk) und „wini“ (Freund). Friedrich (aus dem althochdeutschen „fridu“ (Frieden) und „rihhi“ (reich, mächtig). Adolf (aus dem althochdeutschen „adal2 (edel, vornehm) und „wolf“ (Wolf). Winfried (aus dem althochdeutschen „wini“ (Freund) und „fridu“ (Friede). Johannes (aus dem biblischen vom hebräischen „jochanan“ (der Herr ist gnädig). Josef (aus der Bibel übernommener Vorname hebräischen Ursprungs, eigentlich „Gott möge vermehren). Bernhard (aus dem althochdeutschen „bero“ (Bär) und „harti“ (hart). Karl (aus dem althochdeutschen „karal“ (Mann, Ehemann) und dem niederdeutschen „kerle“ (Mann nicht ritterlichen Standes). Michael, Michel (aus der Bibel übernommener Vorname hebräischen Ursprungs („Wer ist wie Gott“). Walter (aus dem althochdeutschen „waltan“ (herrschen, walten) und „heri“ (Heer). Wilhelm (aus dem althochdeutschen „willo“ (Wille) und „helm“ (Helm, Schutz). Adam (aus der Bibel übernommener Vorname, eigentlich „Mann aus roter Erde“. In der Bibel ist Adam der Stammvater aller Menschen. Der Vorname war im Mittelalter sehr stark verbreitet, wird aber heute nur noch sehr selten gewählt. Theobald (aus dem griechischen „theos“, was „Gott“ bedeutet.
Althergebrachte Begriffe aus den Gemarkungen der Dörfer im Ostertal
Von Bannen und Gewannen – Herkunft, Entstehung und Bedeutung der Namen
Die Flurnamenforschung bildet eine wichtige Grundlage für die Heimatforschung. Der Bann oder die Gemarkung spielte für die ersten Siedler eine große Rolle, denn hier wurden die ersten Namen verliehen, wobei Berge, Auen, Täler, Wälder, Wiesen, Äcker, Quellen, Brunnen, Bäche und Ortsteile einen besonderen Anhaltspunkt lieferten. Oft haben die Flurnamen eine enge Beziehung zur Sache. Die meisten Flurnamen kann ich noch ihrer Herkunft, Entstehung und Bedeutung nach bis ins Althochdeutsche hinein verfolgen. Es kommt auch vor, dass eine Flur gleich zwei Bezeichnungen hat, nämlich eine katasteramtliche und eine im Volksmund noch heute gebräuchliche.
Die Äcker wurden früher nach Morgen, die Wiesen nach Mannsmahd oder Mannesgemahden, d. h., was ein Mann, ein Leibeigener oder Untertan an einem Tage mähen konnte, gemessen.
Nachfolgend habe ich versucht, althergebrachte Namen zu erklären (erforscht aus meinem „Wasserzieher“ – „Woher“, einem uralten Lexikon von 1947).
Bann, Bannen: die Gesamtheit der Flur eines Dorfes. Das Dorf wurde früher von Bannzäunen umgeben. Im Bannen befand sich früher die Bannmühle, in der alle Hörigen und Leibeigenen ihr Getreide mahlen lassen mussten.
Erklärung des Wortes „Bann“: Kommt vom althochdeutschen „ban“, was soviel wie „sagen“, „Gebot“ oder „Verbot unter Strafandrohung“ heißt. Auswärtige wurden im Mittelalter vom Bann eines Dorfes „verjagt“, „verbannt“. Daher kommt auch das Wort „Bannmeile“.
Flur: Das Wort kommt aus dem mittelhochdeutschen „vluor“, was ursprünglich „ebenes Land“, „Grundboden“, dann „Ackerland“ bedeutete. Gewann: Gotisch „wandjan“, althochdeutsch „wenten“, bedeutete ursprünglich „wenden“. An der Dorfgemarkungsgrenze musste der Bauer „wenden“ und durfte nicht auf die Gemarkung des Nachbardorfes fahren. Gemarkung: Das Wort kommt aus dem althochdeutschen „marke“ (Grenze) und vom mittelhochdeutschen „marka“, was „Rand“ oder „Wald“ bedeutete. Wälder bildeten oft Völkergrenzen. Allmend: Gemeindeland, Gemeindeweide. Das Wort „Gemeinde“ kommt vom mittelhochdeutschen „gemeine“, was „zusammengehörig“, „gemeinsam“, „allgemein“ bedeutete. Althochdeutsch „gimeini“, altnordisch „gimêne“, angelsächsisch „gamaene“.
Allwiese: Alte Wiese, aufgegebene Kultur. Aue: Gute, nasse, fette Wiese in Tälern. Mittelhochdeutsch „ouwe“, althochdeutsch „ouwa“, was auch „Wasser“ bedeutete. Behäng: Waldteil, der mit Strohwischen behängt ist, in den kein Vieh hineingetrieben werden durfte. Bitzen: Gutes Feld; gute, fette Wiese am Haus, am Dorf, meist eingegrenzt. Borresch: Quellbrunnen an einem Abhang (Siehe auch „Born“). Born, Bornacker: Born, poetisch für Brunnen (Bronnen). Kommt vom althochdeutschen „brunno“, gotisch „brunna“, angelsächsisch „burna“. Bleiche: Platz, wo die Wäsche gebleicht wurde. Brache: Zustand des Feldes, wenn es ruht; Acker, der nach der Ernte umgebrochen ruht, nicht bestellt wird. Althochdeutsch „bracha“, umgepflügtes Land.
Bremmenhügel: ein mit Ginstern bewachsener Hügel, der nicht ackerbar war. „Bremme“, mundartlich noch heute für den Ginster verwandt, geht zurück auf das althochdeutsche Wort „Pfriem“, was „Ginster“ oder „Bremme“ bedeutet und wohl auch „Brimma“, was Brombeeren bedeutet. Bruch: sumpfland, Moorland, feuchte Wiese, Sumpfboden. Mittelhochdeutsch „bruoch“, althochdeutsch „bruoh“. Bruchwald: Sumpfiger Wald mit Wasserstellen. Bruchwiese: Sumpfige Wiese mit Quellen und Bach. Buckel: Bodenerhebung, Rücken (auch „Ruckert“). Bungert: Wiese in Dorfnähe, meist eingezäunt, die mit Obstbäumen bestanden war (heute: Baumstück); Bungert, auch Bangert: Baumgarten. Bühl: Eigentlich „Biegung der Erde“, ein Stück Land, das „buckelig“ ist. Bütt: Land oder Wiese, die dem Gemeindediener, dem Büttel, zugeteilt war.
Dachslöcher: Gelände mit Dachs- oder Fuchsbauten. Delle, Dell: Kleine Talmulde. Das Wort kommt vom althochdeutschen „telili“, vom mittelhochdeutschen „telle“, was eigentlich „Tälchen“ bedeutet. Dorfanger: Wiese in der Nähe des Dorfes, wo später auch Dorffeste abgehalten wurden (Gemeindeanger). „Anger“, eigentlich Grasland, althochdeutsch „angar“, was eine „enge“ Wiese war. Dörrwies: Trockene, dürre Wiese, zum Ackern wenig geeignet. Driesch: Brachliegendes, minderwertiges Ackerland. Farrenwiese: Wiese für den Gemeindestier. Fischgrätchen: Kleiner Dorfbach. Fröhn: Hier mussten im Mittelalter die Bauern für die Adligen Frondienst leisten.
Читать дальше