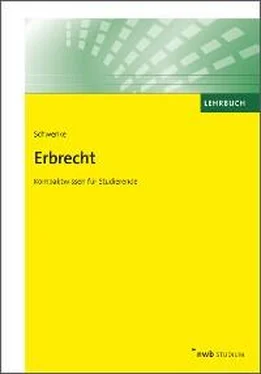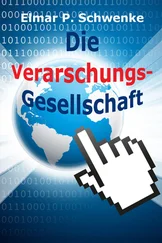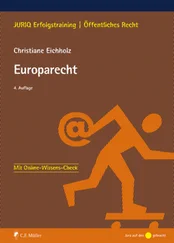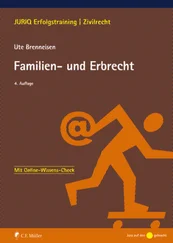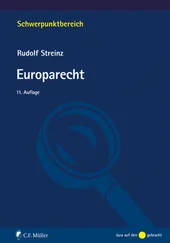Beispiel: Im Fall des Vorversterbens der annehmenden Mutter tritt der Adoptierte ebenso wie ein leibliches Kind ein und beerbt die Großmutter.
Die Verwandtschaftsverhältnisse des Adoptivkindes zu seiner Ursprungsfamilie erlöschen allerdings (§ 1755 BGB), so dass das Adoptivkind insofern kein gesetzliches Erbrecht hat 2).
Bei der Volljährigenadoptionhat das adoptierte Kind ein gesetzliches Erbrecht nur gegenüber dem Annehmenden, nicht gegenüber den Verwandten des Annehmenden (§ 1770 Abs. 1 BGB).
Beispiel: Der Angenommene beerbt seine Adoptivmutter. Da keine Verwandtschaftsverhältnisse zwischen dem Angenommenen und den Geschwistern der Annehmenden entstehen, beerbt er diese nicht.
Das angenommene Kind bleibt allerdings gegenüber seinen natürlichen Verwandten erbberechtigt (§ 1770 Abs. 2 BGB) 3).
III. Das gesetzliche Erbrecht des Ehegatten bzw. des eingetragenen Lebenspartners
Das gesetzliche Erbrecht der Verwandten wird beschränkt durch das gesetzliche Erbrecht des Ehegatten des Erblassers bzw. eingetragenen Lebenspartners (Die Aufführungen zum gesetzlichen Erbrecht der Ehegatten können auf das gesetzliche Erbrecht des eingetragenen Lebenspartners übertragen werden). Mit anderen Worten: Das Erbrecht des überlebenden Ehegatten geht dem gesetzlichen Erbrecht der Verwandten vor.Erst wenn das gesetzliche Erbrecht des Ehegatten bestimmt ist, kann in einem zweiten Schritt das Erbrecht der Verwandten des Erblassers ermittelt werden. Den Verwandten fällt das zu, was kraft Gesetzes nicht an den Ehegatten geht. Hintergrund des Ehegattenerbrechts ist die Existenzsicherung des überlebenden Ehegatten, welche sich an den bisherigen Lebensumständen orientiert.
1. Voraussetzungen des gesetzlichen Erbrechts des Ehegatten
Das gesetzliche Erbrecht des Ehegatten setzt voraus, dass
 |
die Ehe wirksam geschlossen wurde; |
 |
die Ehe durch den Tod eines Ehegatten beendet wurde; |
 |
das Ehegattenerbrecht nicht ausgeschlossen ist (§ 1933 BGB) 4); |
 |
dass auf das gesetzliche Erb- und Pflichtteilsrecht nicht verzichtet wurde (§ 2346 Abs. 1 BGB); |
 |
dass keine Erbunwürdigkeit vorliegt i. S. des § 2339 BGB. |
Für die Berechnung des Erbteils des Ehegatten ist darüber hinaus zu bestimmen,
 |
welcher Ordnungdie neben dem Ehegatten miterbenden Verwandtenangehören (§ 1931 Abs. 1 BGB). |
 |
in welchem Güterstand 5)die Eheleute zum Zeitpunkt des Todes des Erblassers gelebt haben (§ 1931 Abs. 3 und Abs. 4 BGB). |
Haben die Ehegatten im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft gelebt, kann sich der Erbteil des Ehegatten gemäß §§ 1931 Abs. 3, 1371 Abs. 1 BGB pauschal um 1/4 erhöhen.
Der Ehegatte erhält damit folgenden Erbteil:
 |
neben Erben der 1. Ordnung 1/2 (1/4 + 1/4); |
 |
neben Erben der 2. Ordnung 3/4 (1/2 + 1/4); |
 |
neben Erben der 3. Ordnung |
|
sofern alle Großeltern leben 3/4 (1/2 + 1/4)sofern keine Großeltern leben 1/1 6)sofern einzelne Großeltern und Abkömmlinge von Großeltern leben 3/4 + 1/8 = 7/8. |
Beispiel: Der Erblasser lebte mit seiner Ehefrau im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Er hatte keine Kinder. Neben der Ehefrau des Erblassers leben zum Zeitpunkt seines Todes noch sein Großvater und dessen Sohn (= Onkel des Erblassers).
Die gesetzliche Erbfolge stellt sich wie folgt dar: Die Ehefrau erbt als gesetzliche Erbin neben Großeltern (Erben 3. Ordnung) gemäß § 1931 Abs. 1 Satz 1 BGB 1/2. In Fällen in denen der Güterstand durch den Tod des Ehegatten beendet wird, erhöht sich der gesetzliche Erbteil des überlebenden Ehegatten pauschal gemäß §§ 1931 Abs. 3, 1371 Abs. 1 BGB um 1/4, und zwar unabhängig davon, ob überhaupt ein Zugewinn erzielt wurde. An sich würde das verbleibende Viertel unter dem Großvater und seinem Abkömmling als den Erben der 3. Ordnung aufgeteilt, § 1926 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 BGB. Der Großvater und der Onkel des Erblassers würden jeder 1/8 erhalten. Es ist allerdings § 1931 Abs. 1 Satz 2 BGB zu beachten. Danach erhält der Ehegatte den Anteil, der nach § 1926 dem Abkömmling des einen Großelternteils zufallen würde. Danach stellt sich die Erbfolge wie folgt dar: Die Ehefrau erhält zu ihrem 3/4-Anteil noch 1/8, d. h. sie beerbt den Erblasser mit einem Anteil von 7/8, während der Großvater 1/8 erbt. 7)
Zu dem dargestellten erbrechtlichen pauschalen Zugewinnausgleichkommt es nur, wenn der überlebende Ehegatte Erbe oder Vermächtnisnehmer geworden ist (§ 1371 Abs. 2 BGB).
Denkbar ist aber auch, dass der Ehegatte weder Erbe noch Vermächtnisnehmer wird. Dies kann sich aus einer entsprechenden Verfügung von Todes wegen des Erblassers aber auch aus einer Ausschlagung der Erbschaft durch den überlebenden Ehegatten ergeben (sog. taktische Ausschlagung). Auch in den Fällen, in denen der Ehegatte ausschlägt, stehen ihm der konkret zu berechnende güterrechtliche Zugewinnausgleich und der sog. kleine Pflichtteil zu (§ 1371 Abs. 3 BGB). Der sog. kleine Pflichtteil beträgt neben den Kindern des Erblassers 1/8, neben den Eltern des Erblassers 1/4 aus dem um die Zugewinnforderung bereinigten Nachlass.
Da es sich bei der Zugewinnforderung um eine Nachlassverbindlichkeit handelt, ist diese vorweg vom Nachlass in Abzug zu bringen. Dem nicht enterbten Ehegatten steht also ein Wahlrecht zu: Entweder der Ehegatte entscheidet sich für die erbrechtliche oder die güterrechtliche Lösung, wobei er bei letzterer den kleinen Pflichtteil erhält.
Beispiel: Eric Fröhlich (E) ist mit Eva Fröhlich (EF) im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft verheiratet. Die Eheleute haben drei gemeinsame Kinder: Karl, Kevin und Klaus. Zum Zeitpunkt der Eheschließung verfügte E über kein nennenswertes Vermögen. Das Anfangsvermögen der EF belief sich auf 30.000 € und beträgt zum Zeitpunkt des Todes des E 50.000 €. Während der Ehe erwarb E ein Grundstück mit einem Wert in Höhe von 300.000 €. Sonstiges Vermögen haben die Eheleute nicht erworben.
Die erbrechtliche Situationstellt sich wie folgt dar:
Читать дальше