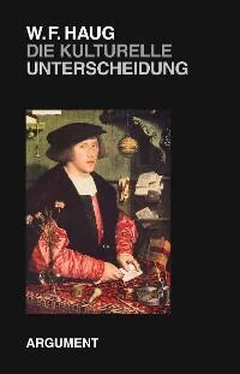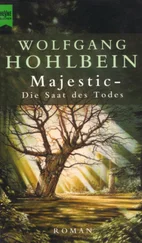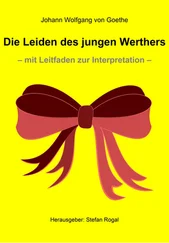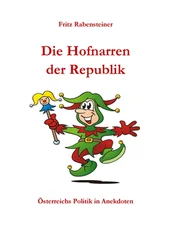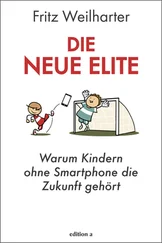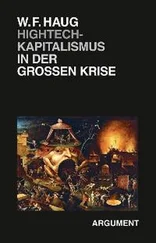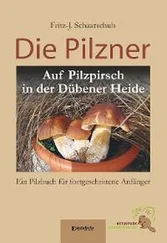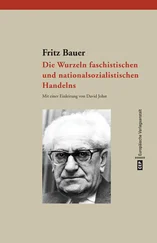Der Vulgärmaterialist macht keine Umwege über die teleologische Struktur der Arbeitstätigkeiten und der Zweckbestimmung ihrer Produkte. »Materiell« ist für ihn etwas Physisch-Stoffliches, das für die Augen sichtbar und mit den Händen berührbar ist. Auch im »nichtmarxistischen Materialismus war es besonders im 19. Jahrhundert verbreitet, ›Materie‹ als Stoff zu deuten und diesen mit auf Atomen aufbauenden physikalischen Strukturen zu identifizieren« (Wittich 2004, 816f). Die Daseinsform, die man ihm zuzuordnen pflegt, ist das Ding oder die Sache, jedenfalls ein stofflicher Gegenstand, der sich (sei es auch mit optischen und haptischen Hilfsmitteln) betrachten und berühren lässt. Die Entdeckung der subatomaren Wirklichkeit hat diese Vorstellung überholt. Einsteins berühmte Formel E = MC2 spielt innerhalb der ›materiellen Welt‹, wie schon Hegel den Alltagsverstand mit seiner Bestimmung des Lichtes als »unkörperliche, ja immaterielle Materie« durcheinander gebracht hat (Enz I, W 8, 118). Und vom Ideellen, das dem Materiellen entgegengesetzt zu werden pflegt, lässt sich vom wissenschaftlich-philosophischen Standpunkt festhalten, dass es »stets von Materiellem genetisch, physiologisch oder auch technisch abhängig bleibt« (Wittich 2004, 818). Verliert damit der Term ›materiell‹ nicht jede Trennschärfe?
Lenin geht energisch dazwischen und bestimmt »Materie« erkenntnistheoretisch als dasjenige, was »außerhalb« des Bewusstseins und »unabhängig« von diesem existiert (LW 14, 141 u.ö.). Damit kann etwa das Licht, ohne das man nichts gegenständlich sehen kann, ohne dass es selbst als solches gegenständlich sichtbar wäre, als etwas Materielles vorgestellt werden, während eben diese Vorstellung als etwas Ideelles gelten kann. Doch diese Lösung des Problems zieht weitere Probleme nach sich. Sie gründet auf der dualistischen Denkstruktur, wie sie seit Descartes und Kant vorherrscht. In der Tat ist sie im Marxismus-Leninismus zu einer dualistischen Ontologie ausgebaut worden, derzufolge es zwei Seinssphären, die Materielle und die Ideell-Immaterielle, auch als ideologisch begriffene gibt, der das weltanschauliche Bekenntnis zum Primat der Materie abverlangt wurde. Diese Denkweise hat vollends zu heillosen Verwirrungen und zum Versuch, diesen mit scholastischen Spitzfindigkeiten zu entkommen, geführt (vgl. Haug 1979). Das »Bewusstsein«, das bei Lenin Materie als das von sich selbst Ausgeschlossene definiert, ist das Individuelle, wenn auch abstrahiert und verallgemeinert. Geht man dagegen wie Marx und Engels von den in Gesellschaft bewusst tätigen Individuen und den Bedingungen ihrer Handlungsfähigkeit aus, kommt man zu Faktoren wie Sprache, Institutionen, Werkzeuggebrauch, Wissen, also kulturell kumulierten und weitergegebenen historischen Hervorbringungen, mittels derer die Individuen untereinander und mit der außermenschlichen Natur in Beziehung treten.
Der Dualismus der beiden Seinssphären ist seit Descartes’ Zweisubstanzenlehre ungeachtet aller Einsprüche solide verankert in der ›westlichen‹ Selbstauslegung, zumal er mit der Innen-Außen-Unterscheidung des individualistisch geprägten Alltagsverstandes konvergiert. Das Unbehagen angesichts der Auseinanderschneidung der Lebensphänomene äußert sich in einem Verbindungsdenken auf Basis der dualistischen Zerfällung. Es lässt sich beobachten am Beispiel des deutschsprachigen Wikipedia-Artikels »Materielle Kultur« (Stand 20.8.2010). Er definiert zunächst: »Als materielle (auch: materiale) Kultur wird die von einer Kultur oder Gesellschaft hervorgebrachte Gesamtheit der Geräte, Werkzeuge, Bauten, Kleidungs- und Schmuckstücke und dergleichen bezeichnet.« Kultur ist hier nur ein anderes Wort für Gesellschaft, und materielle Kultur reduziert sich auf deren dingliches Skelett, auf Gebrauchsgegenstände ohne Gebrauch und Behausungen ohne Bewohner, wie sie Museen sammeln oder zumindest in Fragmenten präsentieren könnten. Der Artikel fährt fort: »Kultur und Materielles sind ohne einander nicht denkbar. Erst durch eine Verbindung mit dem Materiellen und Immateriellen entsteht ein Zugang zum Verstehen des Alltags verschiedenster Gesellschaften.« Die Konfusion regiert. Bemerkenswert ist gleichwohl das Schema, das sich als das Kombinationsparadigma bezeichnen lässt. Man ›weiß‹ dabei, dass es eine Sphäre des Materiellen und eine Sphäre des Immateriellen gibt und dass die Kombination beider Sphären die Lösung birgt. Alfred Kosing referiert in den Grundlagen des historischen Materialismus die »in der marxistisch-leninistischen Literatur [… verbreitete] Auffassung, dass die Kultur einer bestimmten Gesellschaft durch die Gesamtheit ihrer materiellen und geistigen Produkte oder Werte gebildet werde. Auf dieser Grundlage wird zwischen der materiellen Kultur und der geistigen Kultur unterschieden, wobei materielle und geistige Kultur in einem weiteren Kulturbegriff zusammengefasst werden, während der engere Kulturbegriff lediglich die geistige Kultur enthält.« (1976, 704f) Statt vom widersprüchlichen, gleichwohl einheitlichen sozialen Lebensprozess auszugehen und dessen historische Ausdifferenzierung zu rekonstruieren, gehen diese und ähnliche Bestimmungsversuche von fertigen Rubriken aus, um sie nachträglich in eine Art von Ordnung zu bringen. Aber geistige Kultur gibt es an sich ebenso wenig wie materielle Kultur, und es steigert die Verlegenheit eher noch, ihre »Unterscheidung« auf den Status »eines ersten Gesichtspunkts der Klassifizierung kultureller Verhältnisse entsprechend der gesellschaftlichen Lebensbereiche« zu reduzieren.68 Es sind dies konzeptionelle Zugriffe auf eine widersprüchliche und antagonistische Wirklichkeit, und diese Zugriffe sind historisch und sozial situiert. Es sind keine wissenschaftlichen Begriffe, sondern gängige Kategorien, die nicht ohne Kritik in die Theorie übernommen werden können.
4. Ausgrabungsfund und archäologische Ergänzung
Die Ethnologie hat es mit lebenden Objekten, die Archäologie mit ausgestorbenen zu tun. Jene geht von der kommunikativen Bewegung aus, diese vom stummen fragmentarischen Beweisstück. Man könnte daher meinen, ein an stofflichen Dingen oder Umweltveränderungen orientiertes Verständnis materieller Kultur sei wie geschaffen für die Archäologie, da diese kein Leben vorfindet und häufig in ›vorgeschichtlichen‹ (das heißt, vor der geschriebenen Geschichte existierenden) Bezügen, an Stelle der Dokumente oder Quellen nur Relikte längst vergangener Kulturen zur Verfügung hat bzw. sucht.
Doch auch wenn es sich bei diesen Überbleibseln im Unterschied zu den formellen Zeichenträgern nur um physisch-stoffliche Dinge handelt, wird niemand auf die Idee kommen, ihnen die Bedeutungsdimension abzusprechen. Wo die Archäologie sich der Vorgeschichte widmet, sind »ihre Urkunden die Werkzeuge, Waffen, Hütten, die die Menschen der Vorzeit hergestellt haben, um sich Nahrung und Obdach zu sichern« (Childe 1959, 41). Urkunden müssen gelesen werden. Das gilt nicht nur für schriftliche Dokumente. Auch vorgeschichtliche Objekte, die keine Symbole tragen, müssen ›entziffert‹ werden. In ihrem Fall heißt das, sie müssen als funktional und als Bestandteile eines Ensembles funktionaler Dinge und Umweltveränderungen, auf das eine einstige Kultur sich als auf ihre Mittel gestützt hat, verstanden werden. Das gilt nicht nur für die eigentlichen produzierten Kulturmittel, sondern mutatis mutandis auch für den Abfall, der in Gestalt abgeschlagener Steinsplitter, Asche, Tierknochen usw. bei ihrer Produktion bzw. Konsumtion angefallen ist, Exkremente des Einsatzes stofflicher Kulturmittel. Ohne eine solche zumindest ansatzweise ›Lektüre‹ würden sich dem archäologischen Blick keine archäologischen Objekte aus dem Ausgrabungsmaterial abheben. Es bliebe bei Abraum, einem Haufen indifferenter Naturdinge.
Das Problem, das bei Archäologen und Ethnologen auf der Hand liegt, dass auf dem Weg vom Augenschein zum Verständnis eine Distanz zu überbrücken ist, stellt sich in anderer Form auch in zeitgenössischen Erkenntnisprozessen. Brecht hat das Problem in seiner Schrift Der Dreigroschenprozess – Ein soziologisches Experiment umrissen. Das Wesen eines kapitalistischen Industriebetriebs lässt sich nicht mit den Augen sehen oder mit der Kamera photographieren. Es ist »in die Funktionale« gerutscht. Sie muss folglich erforscht und ans Licht gezogen werden. Ohne Theorie ist das nicht möglich. Louis Althusser hat das gleiche Problem epistemologisch reflektiert. Ohne Abstraktionen lässt die Wirklichkeit sich nicht erkennen. So ist zum Beispiel die kapitalistische Produktionsweise fürs Auge unsichtbar, beherrscht aber die sichtbare Realität »terriblement« mehr als die sicht- und berührbaren Objekte (1969, 10).
Читать дальше