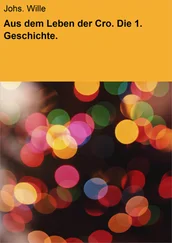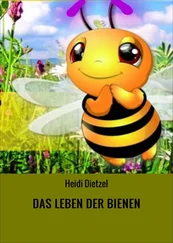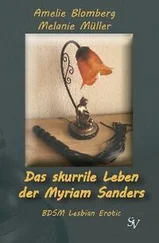Das führt uns zurück zum Zellgeschehen. Ein charakteristisches Merkmal der Expression proteincodierender Gene in eukaryotischen Zellen ist die räumliche Trennung der Gen-Transkription, die im Zellkern erfolgt, und der Proteinsynthese, die im Zytoplasma stattfindet. Diese Trennung erfordert die Translokation der exportfähigen mRNP-Komplexe aus dem Zellkern in das Zytoplasma. Zunächst einmal müssen die mRNPs die Kernmembran erreichen und dort an einen der 2.000 bis 3.000 Kernporenkomplexe andocken, die den Transport ins Zytoplasma übernehmen. In der Regel kommen mRNAs und die aus diesen hervorgehenden mRNPs nicht in Scharen vor. Im Gegenteil: In Humanzellen sind rund 95 % der Transkripte in höchstens fünf Kopien vorhanden; in Hefezellen wurde Ähnliches gefunden – 80 % der mRNAs sind höchstens doppelt vorhanden.17
Das Vorliegen einzelner mRNPs lässt ein stochastisches Zeitmuster des Aufspürens der Kernporen und der Bindung an dieselben durch Brown’sche Irrfahrt erwarten. In herkömmlichen Modellen, die auf grundlegende Arbeiten von Marian von Smoluchowski zurückgehen, ergeben sich deterministische Gesetzmäßigkeiten molekularer Interaktionen durch die Überlagerung der Brown’schen Bewegungen einer sehr großen (unendlichen) Zahl von Teilchen oder (Mako-)Molekülen in makroskopischen (unbegrenzten) Volumina oder Flächen.
In endlichen, kleinen Volumina, auf begrenzten Flächen oder Strecken können diffusionsabhängige Interaktionen einzelner Reaktanten unter bestimmten Bedingungen trotzdem mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit erfolgen. Ein vereinfachtes Modell soll uns helfen, die wesentlichen Prinzipien zu erkennen. Dazu betrachten wir einen kugelförmigen Zellkern, in dem ein einzelner mRNP-Komplex an einer beliebigen Position innerhalb des Kerns eine unbehinderte Irrfahrt beginnt. Uns interessiert nun erstens die Erstpassagezeit , das ist die Zeit, die der mRNP-Komplex benötigt, bis er das erste Mal die Kernmembran erreicht, und weiterhin die Wahrscheinlichkeit , dass dies innerhalb eines gewissen Zeitfensters geschieht. Erwartungsgemäß variieren die Erstpassagezeiten, aber es gibt keine „wahrscheinlichste“ Erstpassagezeit. Lange Zeiten bis zum Erreichen der Kernmembran, die beispielsweise das 5-fache der durchschnittlichen Passagezeit überschreiten, sind unwahrscheinlich – für Zellkerne mit einem Radius von 8 µm und einem effektiven Diffusionskoeffizienten von 0,04 µm 2/s (beides gemessene Werte in humanen Osteosarkomzellen). Andererseits ergibt sich nur eine Wahrscheinlichkeit von 0,67 dafür, dass ein mRNP-Komplex für das Erreichen der Kernmembran nicht länger als die durchschnittliche Erstpassagezeit benötigt – das ist weit entfernt von einem sicheren Ereignis. Das Bild ändert sich, wenn, wie bei Hefe-Zellkernen, der Radius nur 0,8 µm, ungefähr 1/10 des Osteosarkom-Zellkernradius, beträgt: Bei Annahme desselben niedrigen Wertes für den Diffusionskoeffizienten von 0,04 µm 2/s können einzelne mRNPs jetzt eine Kernpore in weniger als 100 Sekunden mit praktischer Sicherheit lokalisieren.18
Diese Modellrechnungen veranschaulichen, dass die Verringerung des Volumens ein wirksames Mittel sein kann, um die Effizienz des Aufspürens von spezifischen Zielorten oder generell von diffusionskontrollierten Interaktionen zu erhöhen, insbesondere wenn die Zahl der interagierenden (Makro-)Moleküle und Rezeptoren sehr klein ist. Unser spezieller Fall weist auf ein generelles Prinzip hin: Die für die Zellorganisation charakteristische strukturelle und funktionelle Kompartimentierung erhöht die Wahrscheinlichkeit für makromolekulare Interaktionen; unter bestimmten zellulären Bedingungen können Interaktionen von wenigen mobilen Makromolekülen und einzelnen „Zielen“ (engl. targets ) mit großer Effizienz erfolgen. Ein solcher exemplarischer Fall wird uns bei der Regulation des Lactose-Operons in E. coli begegnen.
Zu den zentralen intrazellulären Interaktionen zählen Protein-Protein- und Protein-Nukleinsäure-Wechselwirkungen. Solche Interaktionen sind mit inhärenten Unsicherheiten verbunden. Daher interessiert uns besonders der Übergang von stochastischen Interaktionen zu deterministischem „Verhalten“. Zwei Modelle bieten sich hierfür an: das Lactose ( Lac)- Operon-Modell und der Lebenszyklus des Phagen Lamda ( λ ) in E. coli. Beides sind paradigmatische Modelle in der Molekulargenetik, die eine bedeutende Rolle in der Entwicklung regulatorischer Konzepte gespielt haben, und, aufgrund des Modellcharakters, nach wie vor spielen.
Modell 1. Das Bakterium E. coli kann neben Glucose auch Lactose als Kohlenstoff- und Energiequelle verwerten – nach Induktion. Der Induktor ist nicht die Lactose selbst, sondern die aus der Lactose enzymatisch gebildete Allolactose. Die Verwertung von Lactose durch E. coli steht unter der Kontrolle des Lac- Operons. Diese genetische Funktionseinheit kontrolliert die Synthese von drei Enzymen, von denen eines, die Permease, den Transport der Lactose durch die Zellplasmamembran ermöglicht, während ein weiteres Enzym, die ß-Galactosidase, die Spaltung der Lactose in Galactose und Glucose katalysiert. Die biologische Funktion des dritten Enzyms, ß-Galactosid-Transacetylase, ist unklar.19
Modell 2. Der Bakteriophage λ infiziert E. coli , indem die Phagen-DNA in das Bakterium eindringt. Das hat zwei mögliche Folgen: Entweder vermehrt sich der Phage, innerhalb von ungefähr 45 Minuten, mit Hilfe der Enzymausstattung seines Wirts und zerstört (lysiert) diesen dabei – unter Freisetzung von ungefähr 50 bis 100 intakten Phagen – oder die DNA eines Phagen wird in die ringförmige DNA des Bakteriums integriert. In letzterem Falle verweilt die Phagen-DNA als Prophage in der DNA der Wirtszelle und wird mit der Wirtszell-DNA verdoppelt. Dieser Lysogenie genannte Zustand kann über sehr viele Zellteilungen stabil bleiben, bis beispielsweise durch Mutationen auslösende UV-Bestrahlung das Wachstum der Wirtszelle gestoppt und stattdessen die Vermehrung des Phagen initiiert wird.20
Die regulierten Prozesse der Lactose-Verwertung und das Lysogenie/Lyse -Verhalten des λ-Phagen in E. coli veranschaulichen molekulare Schalter . „Schalter“ deswegen, weil die Transkription von proteincodierenden Genen durch eine „Alles-oder-nichts“-Regulation entweder zugelassen oder unterbunden wird. Die wegweisenden Arbeiten von André M. Lwoff (1902 - 1994), Franҫois Jacob (1920 - 2013) und Jacques L. Monod (1910 - 1976) führten zu einer Theorie der Regulation der Proteinsynthese in Prokaryoten; sie kulminierten in der Vorstellung des Operon-Modells im Jahre 1961 und des Allosterie-Konzepts regulatorischer Proteine (1963).
Den „Schalter“ in den betrachteten Lac- und Lambda -Systemen bilden regulatorische Proteine, die als Repressoren bezeichnet werden, und kurze DNA-Sequenzen – sogenannte Operatoren, an denen der jeweilige spezifische Repressor fest, aber reversibel bindet. Durch die Bindung des Repressors wird die Assoziation der RNA-Polymerase an eine als Promotor bezeichnete DNA-Sequenz in direkter Nachbarschaft des Operators unterbunden. Promotor, Repressor-Gen, Operatoren und die proteincodierenden Gene bilden zusammen eine Funktionseinheit – das Operon.21
Der Lac- Repressor war das erste regulatorische Molekül, das isoliert und als Protein identifiziert wurde. Mit Hilfe von Mutanten, die diesen Repressor in großer Anzahl synthetisieren, gelang es, größere Mengen zu gewinnen. Denn im Durchschnitt befinden sich nur 10 bis 20 tetramere (aus vier identischen Untereinheiten zusammengesetzte) Repressormoleküle und ein oder zwei Lac -Operons in einer wachsenden E. coli -Zelle.22 Verblüffung löste ebenfalls die ungewöhnliche Stabilität des λ- Prophagen aus; auch hier war die Zahl der dimeren Repressormoleküle nicht groß: durchschnittlich etwa 100, bei großer Variabilität von Zelle zu Zelle. Und diese geringe Anzahl ist sogar ausreichend, um eine „Immunität“ gegen die Lyse durch weitere in die E. coli -Zelle eindringende Phagen-DNA sicherzustellen.23
Читать дальше