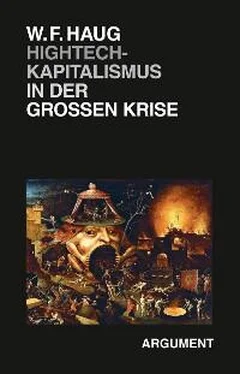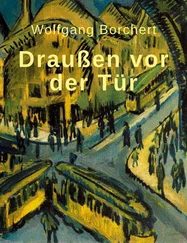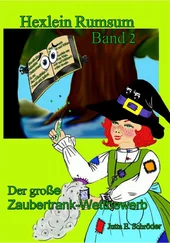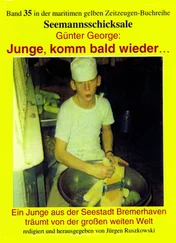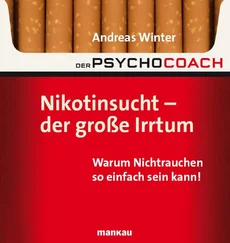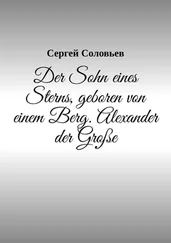Wir können nicht wissen, was aus der neuen Großen Krise folgt. Aber wir können Triebkräfte, Strukturen, Bewegungsformen und Tendenzen der computerbasierten Produktionsweise und der von ihr in den Veränderungssog gezogenen Staatenwelt studieren.
Unsere Benennung dieser Produktionsweise als transnationaler Hightech-Kapitalismus zieht zwei Einwände auf sich. Der erste bezieht sich auf den Begriff des Transnationalen. Ist nicht der Nationalstaat nach wie vor ein durch nichts ersetzbarer Akteur? Und sind nicht die tonangebenden Konzerne, auch wenn transnational aktiv, nach wie vor primär national verankert, und haben sie nicht in ›ihrem‹ Staat – in Europa allenfalls der EU – die Instanz, die ihnen im Zweifelsfall national oder auch gegenüber anderen Staaten beispringt? Überdies scheint die Globalisierung ins Stocken gekommen und die Entwicklung auf Regionalisierung oder auch »Kontinentalisierung« (Zinn) in einer multizentrischen Welt zuzulaufen. Das hat alles seine Richtigkeit. Dennoch ist »ein kohärenter Zusammenhang von Produktion, Verteilung und Konsumtion auf nationaler Ebene weniger denn je gegeben«, und vieles deutet darauf hin, dass man »im Grunde […] von einem globalen Akkumulationsregime sprechen« muss (Sablowski 2009, 118). Freilich kann dieses an Dichte und Standardisierung dem noch nationalstaatlich geprägten Regime des Fordismus nicht gleichen. Unzweifelhaft aber ist die nationale Ebene für den Einsatz der Produktivkräfte und mehr noch für die epochal dominanten Kapitale zu eng, und die Weltmarktakteure zögern nicht, andere Standorte gegen ihren angestammten auszuspielen. 2Der Begriff des Transnationalen ist bescheidener als der des globalen Regimes. Er ist offen dafür, die globale Ordnung als unfertig und nur partiell umfassend und innerhalb ihrer die Verschachtelung relativ selbständiger, ja sogar in gewissen Grenzen rivalisierender Regime zu denken.
2Die drei großen US-Hightech-Konzerne Apple, Google und Microsoft fakturieren ihre außerhalb der USA anfallenden Umsätze (mehr als zwei Drittel ihres Gesamtumsatzes) in Ländern wie Puerto Rico, Singapur und Irland, wodurch sie ihrem Stammland den Löwenanteil der dort fälligen Gewinnsteuer entziehen. Entsprechend Inditex, einer der wenigen der mitten in der Krise weltweit erfolgreichen Konzerne Spaniens, der in Irland fakturieren lässt. Es bedurfte eines nationalen Skandals, um Inditex dazu zu bringen, wenigstens die innerspanischen Umsätze im Inland zu fakturieren und damit auch zu versteuern. Auch den Regulierungen pflegen die Weltmarktakteure auszuweichen. So 2012 der BASF-Konzern, der auf das EU-Verbot von Freilandversuchen mit gen-veränderten Pflanzen kurzerhand mit der Verlagerung seines damit befassten Betriebsteils in die USA antwortete.
Ein zweiter Einwand hakt beim Begriff der Hochtechnologie ein mit dem bereits im ersten Buch (HTK I, 12f) erörterten Argument, die Höhe einer Technologie sei etwas Relatives. In der Tat mag einer künftigen Epoche das Niveau unseres technischen Arsenals und seiner Anwendungen einmal niedrig vorkommen. Auf medizinischem, generell biotechnischem Gebiet etwa hat die hochtechnologische Zukunft erst begonnen. So unbestreitbar das ist, muss es uns nicht daran hindern, die aus dem Sprachgebrauch der Gegenwart aufgegriffene Hightech- oder Hochtechnologie-Kategorie zum Begriff auszuarbeiten. 3Denn die Informationstechnologie hat einen qualitativen Niveausprung der Produktivkräfte ausgelöst, dessen Reichweite und verändernde Wirkung auf Basis, Überbau und Lebenswelt der Gesellschaften noch kaum absehbar sind. So wenig Marx sich den Computer vorzustellen vermochte, so wenig können wir Heutigen uns schon einen weiteren Produktivkraftsprung vorstellen, der die Entwicklung über das in der Breite und Vielfalt seiner künftigen Anwendungen und Umwälzungsfolgen noch unauslotbare Prinzip der mikroelektronisch gestützten und informationstechnisch erschlossenen Produktivkräfte hinausheben könnte.
3Die im Vergleich zu Buch I veränderte Schreibung (statt ursprünglich »High-Tech« nun »Hightech«) trägt der zwischenzeitlichen Einbürgerung des Ausdrucks und seiner Schreibung in einem Wort Rechnung. So findet er sich nicht nur in Wikipedia, sondern auch auf der Internetseite des Bundesministeriums für Bildung und Fortschritt, wo die Bundesregierung erklärt, Ziel ihrer »Hightech-Strategie« sei es, »Deutschland zum Vorreiter bei der Lösung globaler Herausforderungen zu machen« . »Vorreiter« steht für die Fähigkeit, die Konkurrenz der anderen Länder zu schlagen.
Wie in der Produktion die Arbeitsmittel in Wechselwirkung mit den Produktionsverhältnissen Epoche machen, so in der Geschichte der zwischennationalen politisch-ökonomischen Beziehungen die organisatorisch-kommunikativen Techniken und Apparate in Wechselwirkung mit den militärischen und politisch-kulturellen Kräfteverhältnissen. Die »informatischen ›Metamaschinen‹, die wir Computer nennen und die zur revolutionären Allgemeinmaschine geworden sind« (KV II, 169), haben nicht nur die Welt der Produktion, sondern auch den Weltmarkt, seine kapitalistischen Akteure, Verkehrsformen und Ordnungselemente umgepflügt. Die mit diesen Entwicklungen einhergehende tektonische Verschiebung der globalen Konkurrenz- und Kräfteverhältnisse wird nicht zuletzt mit technologischen Innovationen ausgefochten. Die Fragen von Hegemonie und Herrschaft, von Imperialismus oder Imperium stellen sich seither neu. Im Folgenden werden wir uns zunächst mit den hochtechnologisch basierten Bewegungsformen der Krise befassen, um uns dann den Veränderungen der inneren und äußeren Hegemonieverhältnisse der USA, sodann den Formen und Folgen des chinesischen Aufstiegs und schließlich der europäischen Krisendynamik zuzuwenden.
Ungeachtet dieser Abfolge geht es uns gerade um den Zusammenhang der Geschehensebenen. Da hierfür jenes Zusammenhangsdenken benötigt wird, das Theorie genannt wird, beschäftigen uns auf dem Weg durch die Ereignisfolgen immer auch die im Umlauf befindlichen und auf diese Realebene sich beziehenden Analysen und ihre theoretischen Konzepte. Wenn im ersten Teil geläufige Diagnosen wie »Finanzialisierung« oder »finanz(markt)getriebener Kapitalismus« auf den Prüfstand rücken, so im zweiten Teil der gramscianische Hegemoniebegriff in seinem Verhältnis zu Theorien imperialistischer vs. imperialer Herrschaft, wobei die Konkretisierung und Weiterbildung der damit zusammenhängenden Begrifflichkeit am Material eine der durchgängigen Linien bildet.
2. Was hat sich seit dem ersten Buch verändert?
Wenn in Zeiten weltgeschichtlicher Umwälzungen zu einem Gegenwartsthema im Abstand von einem knappen Jahrzehnt ein zweiter Band erscheint, ist ein Blick auf seither eingetretene Veränderungen fällig. Die Verschiebungen in den politisch-ökonomischen Weltverhältnissen im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts sind kaum weniger dramatisch als die 1989 vom Fall der Berliner Mauer besiegelten. Dieser Einschnitt schloss die erste Phase des aufsteigenden Hightech-Kapitalismus ab und leitete die Epoche der beschleunigten kapitalistischen Globalisierung ein, deren virtuelle Infrastruktur in den 1990er Jahren erdumspannend zusammenschoss. In Gestalt des Internet dient sie seither nicht nur der Wirtschaft und den Staaten, sondern begleitet den Alltag von Milliarden von Menschen.
Indem das Ausscheiden des staatssozialistischen Systemkonkurrenten die USA als einzige Supermacht übrig ließ, schuf es die Voraussetzung des Projekts eines »American Century«, für dessen militärisch akute Phase die Terrorakte vom 11. September 2001 das Signal gaben. Inzwischen ist die daraus hervorgegangene Politik des Griffs nach »Herrschaft ohne Hegemonie« unter George W. Bush gescheitert und hat einer Rückkehr zu einer Politik multilateraler Aushandlung Platz gemacht. Der Zusammenbruch des Finanzmarkts, der das militärische Fiasko der USA im Irak und in Afghanistan überlagerte, trieb die Verschiebungen unerbittlich voran. Der »Konsument letzter Instanz« laborierte am Rande zur Zahlungsunfähigkeit, und das noch immer mit großem Abstand mächtigste Land der Welt, dessen Präsidenten seit dem Zusammenbruch des Systemantagonisten immer zugleich eine informelle Weltpräsidentschaft zufällt, rang kraft der Obstruktionspolitik des republikanischen Extremismus mit innenpolitischer Lähmung. Auch die europäische Gemeinschaft taumelte in die von der Rezession unterlegte Hegemoniekrise. Der Widerspruch zwischen transnationaler Vereinheitlichung von Markt und Geld bei nationaler Zersplitterung von Wirtschafts- und Finanzpolitik stellte sie vor die Notwendigkeit eines nachholenden politischen Integrationsschubs bei Strafe des ökonomischen und politischen Auseinanderbrechens. Kaum beeindruckt von der Wirtschaftskrise, entwickelte sich der ostasiatische Wirtschaftsraum zum neuen Gravitationsfeld des Weltkapitalismus, mit China als dem »hauptsächlichen neuen Wachstumszentrum der Weltwirtschaft als solcher« (Gowan 2007, 169).
Читать дальше