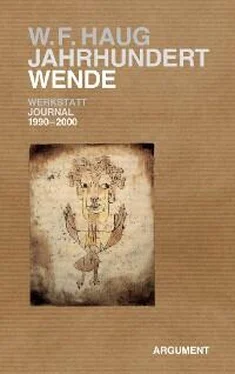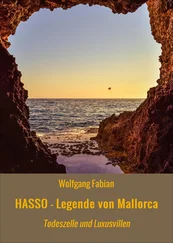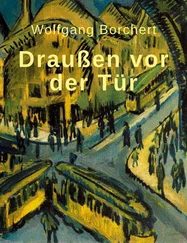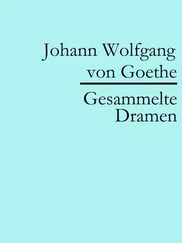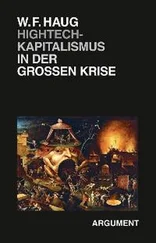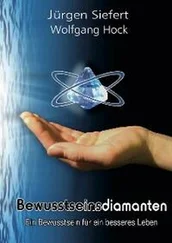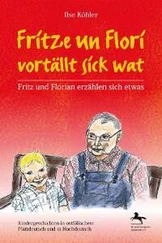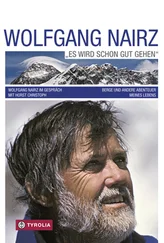Das Korporative als »eiserne Grenze« sowohl der Individualitäten als auch der Anwandlungen zu wirklicher Allgemeinheit. Rüthers entwirft ein Bild des »Hauptgeschäftsführer« als des kunstvoll-diskreten Herrschers im Verband. Dieser Abschnitt (der längste) eigentümlich fad und rührselig, als habe er ihn für einen imaginären Verband solcher Hauptgeschäftsführer geschrieben.
Helga Grebing hält die Fahne des »demokratischen Sozialismus« hoch (»Warum Sozialdemokraten am Sozialismus festhalten müssen«, FR, 26.4.). Auf diese Orientierung zu verzichten, »käme einem Verrat der Sozialdemokratie an ihrer Geschichte gleich« und hieße »zuzugeben, dass man insgeheim dann doch wohl das kommunistische Regime […] für den eigentlichen Sozialismus gehalten hat«. Sie weist die Bezeichnung »Sozialismus an der Macht« für das Untergegangene zurück und spricht vom »totalitär-bürokratischen Kommunismus«. Die Sozialdemokratie habe mit den Kommunisten ein »ökonomistisches Paradigma« geteilt, das jetzt erledigt sei. Auch »das ökonomische System, das sich auf einen einseitig interpretierten Marxismus-Begriff gründete, ist gescheitert; Sozialismus kann offensichtlich in kapitalistisch noch nicht voll entwickelten Gesellschaften […] gar nicht möglich sein.« Auch wenn bei uns ein »sozial erheblich temperierter Kapitalismus« herrsche, bleibt »die ökonomische Grundstruktur der Gesellschaft eine kapitalistische«, auch gebe es »noch keine Alternative zu einer mit Marx’ Ideen gesättigten Kapitalismus-Kritik«. Demokratischen Sozialismus artikuliert Grebing als regulative Idee möglichst allseitiger Demokratisierung. Mit Gorz unterscheidet sie Abschaffung von Aufhebung des Kapitalismus. Ihre Haltung nicht schlecht. Darauf zurückzukommen.
Bei Aufräumversuchen stoße ich auf einen Artikel von Peter Scherer (Sozialismus 10/1990), der »eine neue politische Eiszeit ankündigt: Die bipolare Welt verändert sich zur polaren.« Er sieht einen »Arktischen Block« zwischen USA und SU kommen, dessen Dimensionen »sowohl Japan als auch Europa zu einer Art gewerbefleißiger Stadtstaaten heruntersinken« lassen würden. Die (wenig rosige) Alternative dazu wäre, dass »der westeuropäische Imperialismus dem Osten des Kontinents sich in ähnlicher Weise ›anschließen‹ kann, wie es das westliche Deutschland derzeit mit dem östlichen tut«. – Ein Zeugnis für den Schock, den der Zusammenbruch des Ostblocks bewirkt: der als instabil erfahrenen Welt wird alles Mögliche zugetraut.
Gefühlsfelder, tief unter der Erdkruste, unter einem Druck, der sich, wenn sie plötzlich zufällig angebohrt werden, mit artesischen Effekten geltend macht. So das verlorene Kind, von dem du nicht weißt, bist du es oder wolltest du es finden.
Die Siegesparaden in den USA, die größten seit Ende des Zweiten Weltkriegs, haben etwas Altrömisches. Vor allem machen sie den UNOAuftrag und die Zielsetzungen zur Farce. Überdies der »Sieg« doppelt lächerlich, einerseits wegen des hochtechnologischen »Truthahnschießens«, andrerseits wegen der Multiplikation der Probleme, die er hinterlassen hat. Zum Beispiel fällt in diesen Tagen das weltliche Algerien in die Hände des islamischen Fundamentalismus. Wird nicht Marokko folgen? Tunesien? Sowieso Jordanien?
*
Auf der Fahrt zu den Bries hielten wir vor dem Haus in Hirschgarten, wo einst Friggas Großvater gewohnt und sie selbst viele Wochenenden verbracht hat. Das Haus verwahrlost, aber der Ginko lebte noch und schlug grade aus. Pathetisch das alte durchgerostete Gartentor zum Müggelseedamm, das von innen vom Flieder vollkommen zugewachsen ist und gehalten wird. Mit einer Art von Scheu betrachten wir den rostigen Klingelknopf und das Schild mit dem Namen »Kassler«.
Michael Bries Vater war Botschafter in Japan, kannte daher Wolfram Adolphi, den langjährigen Japankorrespondenten der DDR und jetzigen Berliner PDS-Vorsitzenden, der kürzlich seine Mitarbeit bei der Stasi bekannt hat.
Die Askoldows zurück aus Moskau. Swetlana erzählt, sie hätten drei Wochen auf eine Platzkarte für die Eisenbahn warten müssen, und Eisenbahn musste es sein wegen der vielen Bücher, die diesmal mitzunehmen waren (sie richten sich anscheinend hier zur Arbeit ein). Der Zug überfüllt, viele wirkten auf sie wie Kriminelle. Ihr gesamter Wagen wurde vom sowjetischen Zoll übergangen. Die Schaffnerin, von ihr nach den Gründen befragt, meinte, jemand aus ihrem Wagen habe den Zoll »gekauft«.
Dieter Senghaas (»Es gibt eine große Unbekannte: Die Sowjetunion«, FR) beschreibt den Effekt der Perestrojka als »Osmanisierung« der SU, Einleitung einer vielleicht langen Siechphase, weil weder in Politik, noch in Ökonomie ein wirklicher Schnitt vollzogen worden sei. Er sieht die Lösung in der Auflösung. Jetzt herrsche »Anomie«, das heißt »eine tendenzielle Chaotisierung der Lebensverhältnisse, eine gesamtgesellschaftliche Regression«.
Dass Berlin wieder Hauptstadt werden soll, lässt uns einerseits kalt, andrerseits schwant uns, dass das zum Teufelspakt für die Stadt werden könnte.
Merkwürdige Wirtschaftsnachrichten: Die FAZ spricht von einer »Gründerwelle in der Bundesrepublik«, worunter sie versteht, dass 230 500 Geburten »nur« 162 000 Todesfälle von Unternehmen gegenüberstehen. Aus dem DDR-Gebiet aber meldet sie 40 000 (Aus-)Löschungen gegenüber 169 000 Gründungen, die wiederum rund 100 000 Arbeitsplätze brächten oder 1,69 Arbeitsplätze pro neugegründeter Firma. Falls da nicht ein gewaltiger Druckfehler vorliegt, kann die Misere im Osten als aufgeklärt betrachtet werden.
In »Sinn und Form« ein erstaunliches Gespräch zwischen dem Chefredakteur Sebastian Kleinschmidt und Hans-Georg Gadamer. Kleinschmidt war zu diesem als der Personifikation von Hermeneutik gepilgert. Gadamer begegnet ihm wahrhaft grandseigneural, fast ›liberal‹ in seiner gegnerlosen Gelassenheit. Schön, wie die Rolle des Calvados in diesem Gespräch wie ein Refrain vorkommt, nicht ohne Platon als Kronzeugen einzuführen. In den ›Wonnen der Vergeblichkeit‹ findet dann die Wiedervereinigung zwischen den Gesprächspartnern, einschließlich Marion Kleinschmidts, statt. Gadamer erscheint ›links‹ von den gewendeten Ossis: So viel ist ihm »doch klar, dass irgendetwas sehr falsch sein muss in unserem gesellschaftlichen Tun, wenn junge Menschen nur von der Vergeblichkeit überzeugt sind«. Er setzt auf die Angst, die er als den Affekt der Freiheit begreift und von der er erwartet, dass sie »die Funktion« hat, »dass wir im Laufe von hundert oder zweihundert Jahren […] so etwas wie eine Selbstkontrolle dieser aus den Fugen geratenen Natur, die man Mensch nennt, aufbauen«. Maliziös sein spitzes Diktum: »Habermas sagt immer, er kenne die Wirklichkeit nicht, und ich sage immer, Habermas kennt die Wirklichkeit nicht. Wir sind uns völlig einig in dieser Uneinigkeit. Manchmal denke ich, […] er weiß gar nicht, wie ideologisch er ist.«
Zwischen Atemlosigkeit und langem Marsch der Philologie bei der Übersetzung von Gramscis Gefängnisheften . So vieles zu besorgen. Vor allem der Aufruf zur Rettung der MEGA hat viel Zeit gekostet.
*
Gestern Abend mit Otto Zonschitz in der Voraufführung des Schwejk, eingeladen von Wekwerth, der Regie geführt hat. Das Stück von Brecht, mitsamt zwei eingebauten Passagen aus den Flüchtlingsgesprächen, ist hervorragend. Die Inszenierung lag glücklos darüber. Fand (suchte?) keinen Ansatzpunkt in der Gegenwart. Wekwerth im Verhalten und Reden ungenau, hatte vielleicht getrunken. Das stand im Widerspruch zu seinem »genauen« Aussehen. Äußerte sich zu meinem Entsetzen begeistert über Nicolai Hartmann. Er hat offenbar eine Zeitlang bei Harich studiert.
Читать дальше