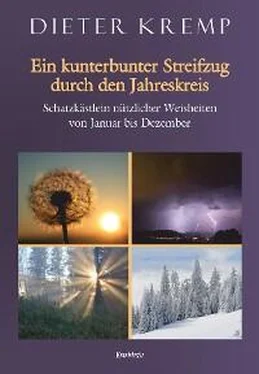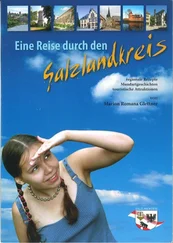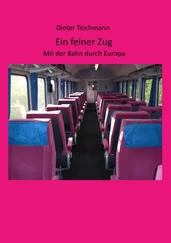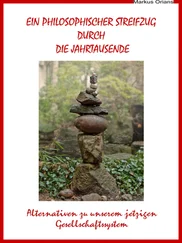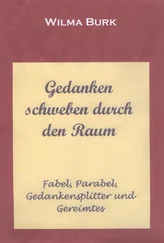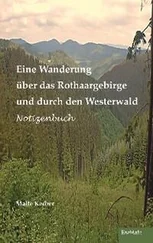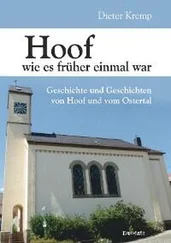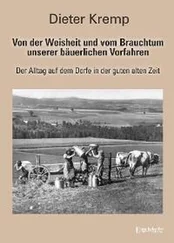Den ältesten mythologischen Hinweis über die Frühlingsgöttin Flora gibt Ovid. Ovid setzt Flora mit der griechischen Nymphe Chloris gleich, die durch Homer bekannt ist. Diese Chloris wird durch den griechischen Gott des Westwindes Zephyr geraubt und vergewaltigt und geehelicht und somit in Flora verwandelt.
Flora präsentiert sich durch die Jahrhunderte hindurch als Jungfrau von berauschender Schönheit. Sie ist die klassische junge Göttin: wunderschön, jung, fröhlich, ausgelassen, ungebunden und sexuell freizügig. Hüpfend und tanzend zieht sie im Frühling über das Land. Sie erscheint oft feenhaft, auch beflügelt und rückt somit auch in die Nähe der Pflanzengeister. Flora ist die personifizierte Gestalt des Frühlingsüberschwangs, der die Welt wieder neu erfasst und als Blumen- und Fruchtbarkeitsgöttin bringt sie den Frühling zurück.
DUFTENDE MÄDCHENSCHÖNHEITEN IM MÄRZ
Veronika, der Lenz ist da …
„Veronika, der Lenz ist da …“, heißt es in einem bekannten Frühlingslied der 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts, das jetzt wieder in Mode gekommen ist. Mit dem wunderschönen Mädchennamen Veronika bezeichnen die Botaniker den blau blühenden Ehrenpreis, der ab Mitte März für bunten Flor in unseren Wiesen sorgt.
Kommt der Frühlingsherold, bekränzt mit seinem Blütenfüllhorn um Stirn und Haar, öffnen eine Reihe von Mädchenschönheiten ihre duftenden Blütenaugen. Und seltsam ist es schon, dass gerade der Frühling uns Blumen schenkt, die allesamt hübsche Mädchennamen tragen.
Als häufig im Laubwald vorkommende Frühlingsblume erhielt das Buschwindröschen oder die Anemone (Anemone nemerosa) im Volksmund viele Namen. Wegen der weißen Blüten nennt man die Anemone auch Mehlblume, Schneerose und Nacktes Weib. In der Antike galt die Anemone als Symbol für alles Vergängliche, da die Blütenblätter bald abfallen. („Anemos“ = griechisch „Wind“). Die alten Römer feierten zur Hochzeit ihrer Blüten das „Floralienfest“. Das Blumenfest zu Ehren der Göttin Flora sollte den Vollfrühling herbeirufen.
Anemonen begnügen sich nicht mit halben Sachen. Wo sie sich ansiedeln, bilden sie bald große Teppiche. In diesen Teppichen nicken die zarten Blüten, nicht immer ganz weiß, teilweise auch rosa angehaucht, und das filigrane Laub ist auch ohne Blüten noch sehr schön.
In der griechischen Mythologie stellt Apoll, der Sohn des Zeus, der schönen Nymphe Daphne leidenschaftlich nach. Sie läuft ihm davon, er eilt auf beflügelten Sohlen hinterher. Fast hat er sie eingeholt, da schickt sie ein Stoßgebet zum Himmel – und wird in einen Lorbeerstrauch verwandelt. Apollo hat das Nachsehen und statt einer Geliebten den Lorbeer, der ihn von da an ebenso schmückte wie so manchen seiner poetischen Schutzbefohlenen. So kam die Daphne (Daphne mezerum) zu ihrem hübschen Mädchennamen.
Zuerst riecht der Wanderer den ansprechenden Balsamduft, den die rosaroten bis hell lila leuchtenden Blüten ausströmen. Damit lockt die Daphne die ersten Bienen des Jahres an, fängt sie doch schon Ende März an zu blühen. Die sonore Duftmusik der Daphne betäubt den Besucher in einem ährenartigen Blütenstand. In schattigen Laub- und Mischwäldern leuchtet die Daphne, die ihrer Seltenheit wegen geschützt ist. Der Seidelbast mit den fast eiförmigen, scharlachroten Beeren ist stark giftig. Im Garten angepflanzt, fühlt sich die Daphne mit ihrem Frühlingsflor am wohlsten im Halbschatten.
Mit der gleichnamigen Blume identisch ist auch der weibliche Vorname Magnolia. Der frühblühende Zierbaum mit seinen tulpenförmigen Blüten, aus China und Japan stammend, hat seinen Namen nach dem französischen Botaniker Magnol. Die Magnolia wird fälschlicherweise auch als Tulpenbaum bezeichnet.
Die Echte Sternmiere Stellaria, im Volksmund auch Stella genannt, hat wunderschöne große Sternblüten, die sich ab Ende März/Anfang April in Wäldern und unter Gebüschen öffnen. Die schneeweißen Blüten leuchten im Gras und an dunklen Waldrändern mit ganz besonderer Intensität. Die Blüten entfalten sich mit ihren zehn Strahlen zu regelmäßigen weißen Sternen. Jedes der fünf Blütenblätter, ein so genanntes Dichasium, ist charakteristisch für die Familie der Nelkengewächse. Die Blüten bilden am Grund der Staubblätter aus grünen Drüsen Nektar und werden von Bienen, Fliegen und Schmetterlingen besucht.
Veronika, der Ehrenpreis, kündigt mit dem Aufblühen seiner himmelblauen Blüten den endgültigen Sieg des Lenzes über den Winter an. Der Echte Ehrenpreis (Veronica officinalis) ist die „siegbringende“ Heilpflanze. Im Volksmund trägt sie verschiedene Namen: „Himmelsblümchen“, „Sternling“ und „Männertreu“. Sie wächst auf trockenen Wiesen, auch in lichten Laubwäldern, auf Heide und Magerrasen. Im Mittelalter glaubte man, ein Teeaufguss von „Männertreu“ würde die Treue zur eigenen Frau erhalten.
Doch nicht die Schlüsselblume, sondern das Veilchen Viola wurde zum Symbol des Frühlings. Trotz seiner sprichwörtlichen Zurückhaltung, Sinnbild der Sittsamkeit und Bescheidenheit, gibt das Veilchen den Ton in der Duftmusik der Frühblüher. Wenn wir die Veilchenplätze in den Wäldern unserer Kindheit ins Gedächtnis zurückrufen, wird uns inne, welch starken Eindruck auch hier bescheiden gebückte Winzigkeit hervorrufen kann, wo sie in Massen auftritt. Das ist in der Frühlingssonne schon eine betörende Duftwolke, die aus dem Teppich unter dem Haselstrauch ausströmt. Aber ach, wie rasch ist die Vergänglichkeit des Duftgenusses bei Veilchen! Das Wohlriechende Veilchen (Viola odorata) weckt vielleicht außer der Rose die meisten romantischen und poetischen Gedankenverbindungen aller Blumen.
Das Veilchen ist die Blume der Liebenden. Die Sprache der Veilchen ist die Botschaft der Zärtlichkeit, der nicht drängenden Liebe. Wollte man Venus, die Göttin der Liebe, ins Brautgemach einladen, dann wurde das Bett mit Veilchen geschmückt. Duft und Farbe der Blüten üben eine aphrodisierende Wirkung aus.
VÖGEL ALS WETTERANSAGER IM FRÜHLING
„Der verschwenderische Jüngling und die Schwalbe“ heißt eine griechische Fabel. In ihr wird erzählt, ein Jüngling habe alles, was er besaß, bis auf einen Mantel vertan. Und auch den habe er versetzt, als er die erste Schwalbe ankommen sah. Nun sei es Sommer, meinte er, und bedürfe auch des Mantels nicht mehr. Danach aber, so heißt es weiter, sein ein heftiger Frost gekommen, die Schwalbe sei erfroren, und der frierende Verschwender sei so zornig geworden, dass er der toten Schwalbe noch viele böse Worte nachgerufen habe. Er nannte sie, die selbst Opfer einer Täuschung geworden, eine Täuscherin. Aristoteles, der diese Fabel überliefert hat, zieht daraus die Lehre: „Eine Schwalbe macht noch keinen Frühling.“ Äsop, bei dem sich diese Fabel findet, sagt dazu: „Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.“
Und unsere gelehrten Wetterpropheten, wahrscheinlich schon die in den Klöstern, die die alten griechischen Sagen kannten, haben nicht nur ein Sprichwort daraus gemacht – dass ein kleiner Teil noch kein Ganzes mache -, sie haben, verschwenderisch wie sie waren, dieses Sprichwort auf fast alle Vögel ausgedehnt, nicht nur auf die Zugvögel, die im Frühling aus dem Süden zurückkommen, sogar auf die, die vor dem Winter gar nicht wegziehen, also auch zum Frühling oder Sommer gar nicht erst zu kommen brauchen.
So heißt es auch: „Ein Sperling auf dem Dach macht den Lenz nicht.“ Da der Sperling aber kein Zugvogel ist, da er den ganzen Winter auf dem Dach und im Geäste sitzt –was soll er uns dann noch das Frühjahr ankünden?
Von der Lerche heißt es übrigens auch, dass sie, kommt nur erst eine bei uns an, noch nicht den Frühling mache, aber sie verkünde ihn.
Bekannt sind zum Beispiel folgende Wetterregeln, in denen Vögel den Frühling ansagen:
Читать дальше