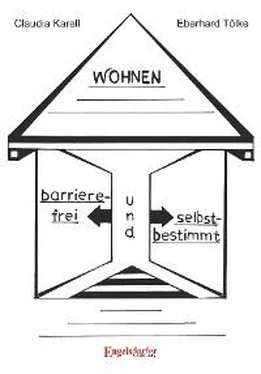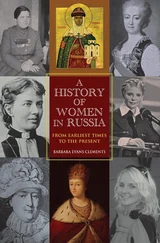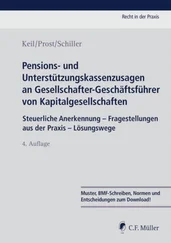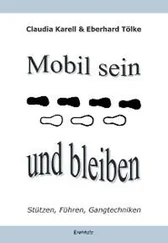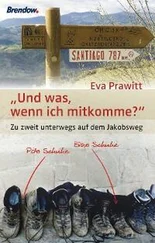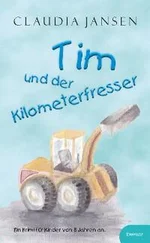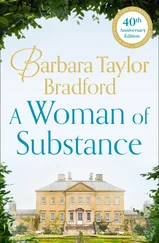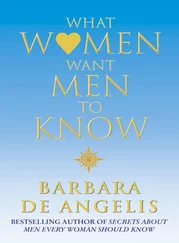Stolperfallen wie z. Bsp.: fehlende Stufenmarkierungen, umherliegende Kabel
zu lange Kleidung, die auf den Boden schleift
schlecht sitzendes Schuhwerk, welches in der Folge zu Gehunsicherheiten führt
mangelhafte Lichtverhältnisse: nicht ausreichend, blendend, spiegelnd (blank gebohnerte Bodenbeläge) und Schatten werfende Lichtverhältnisse
Veränderungen, wie z. Bsp. durch das Aufstellen weiterer Möbel im Zimmer
für Kinder kommen u. a. auch Fensterbänke, Tische und Stühle in Frage, auf welche sie klettern können
1.4.2 Personengruppen mit besonderem Sturzrisiko
Zu diesen Personengruppen gehören insbesondere:
Personen über 70 Jahre
Personen mit reduziertem bzw. schlechtem Allgemeinzustand
Personen mit körperlicher Behinderung
inaktive sowie immobile Personen
1.4.3 Maßnahmen zur Reduzierung von Stürzen
Bei den nachstehenden Beispielen für die Maßnahmen zur Reduzierung von Stürzen handelt es sich um keine abschließende Auflistung.
Maßnahmen in Gebäuden und deren Freiflächen:
stufenlose Zugänge
gemeinsame Orientierungsgänge durch die Räumlichkeiten mit Hinweis auf Gefahrenstellen, wie z. Bsp.: Stufen, Podeste
Einsatz von rutschhemmenden Fußbodenbelägen
ausreichende, blend- und schattenfreie Beleuchtung, insbesondere für Gefahrenstellen, wie Treppen
taktile Kennzeichnung von Treppen
visuelle Stufenmarkierungen
in langen Fluren:
barrierefreie Handläufe
ggf. Sitzmöglichkeiten in Abständen zum Ausruhen bereitstellen
Maßnahmen im Wohnbereich:
Lichtschalter und Klingeln zum Ruf von Hilfspersonen stets im Greifbereich anordnen, wichtig: keine Klingelschnur über Gehbereiche führen
Optimierung der Nachtbeleuchtung
Einsatz von rutschhemmenden Fußbodenbelägen
Veränderungen im Zimmer, z. Bsp. Aufstellen weiterer Möbel, sollten möglichst am Vormittag erfolgen (Bewohner kann sich somit bis zur Nacht besser darauf einstellen)
Maßnahmen für Sanitärbereiche:
Einsatz von rutschhemmenden Fußbodenbelägen und Matten z. Bsp. in Wanne und Dusche
ebene, bodenbündige Duschen
ausreichend nutzbare Festhaltemöglichkeiten
Maßnahmen beim Einsatz von Hilfsmitteln:
Anleitung im Umgang mit Gehhilfen (durch Physiotherapeut)
Einsatz von Hilfsmitteln, wie Stockhalter
Rollstühle, Rollatoren und Betten nach Nutzung stets mit Hilfe der Bremsen feststellen
Bereithaltung eines fahrbaren Lifters, der sich auch eignet um gestürzte Personen vom Boden aufheben zu können
Personenbezogene Maßnahmen:
Beobachtung der Reaktion auf verabreichte Medikamente
wenn erforderlich, rechtzeitige Schlafmittelverabreichung
Passform von Bekleidung und Schuhen prüfen und ggf. korrigieren
Einsatz rutschhemmender Schuhe für Begleiter und zu Begleitenden
Bewegungs- und Gleichgewichtsübungen zur Verbesserung der Stand- und Schrittsicherheit durch die Anleitung eines Physiotherapeuten
regelmäßige Fußpflege zur Vermeidung schmerzhafter Druckstellen
Anpassung der Inkontinenzhilfsmittel
Im Bedarfsfall Aufstellen eines Alarm-/Vorsorgeplans
Dieser sollte mindestens folgendes enthalten:
konkrete Handlungsanweisungen
eine Photokopie anzuwendender Techniken für den Patiententransfer
Standort des Lifts
Verzeichnis zu alarmierender Personen und Institutionen
1.5 Was bringt die Barrierefreiheit der Gesellschaft?
Eine Attraktivitätsverbesserung für alle Bürger.

Animierung von Senioren und Menschen mit Handicaps zur Gesundheitserhaltung durch barrierefrei zugängliche Fitness- und Sportangebote wie z. B. Gymnastik, Schwimmen, Wandern, Kegeln etc.

Verstärkte Nutzung von Tourismus-, Freizeit- und Kulturangeboten.

Erhöhung der Lebensfreude für Senioren und Menschen mit Handicaps.

Die Verbesserung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben fördert das Konsumverhalten von Senioren und Menschen mit Handicaps.

Steigerung des ehrenamtlichen Engagements von Senioren und Menschen mit Handicaps in Verbänden der Selbsthilfe und sozialen Einrichtungen.

Verlängerte Erhaltung der Mobilität älterer Menschen bis ins hohe Lebensalter.

Verringerung der benötigten stationären Heim- und Pflegeplätze.

Aus diesen Fakten entwickelt sich eine wirtschaftliche Nachhaltigkeit der Barrierefreiheit. Dieser Aspekt muss insbesondere vor dem Hintergrund des demographischen Wandels betrachtet werden.

Insgesamt ist eine positive Auswirkung auf die Volkswirtschaft zu erwarten.

Daraus lässt sich beispielsweise für Wohnungsbauunternehmen ableiten:
➢ langzeitige Vermietung des Wohnungsbestandes
➢ Verringerung des Wohnungsleerstandes
➢ Verbesserung des Marktwertes der Wohnungen
Der Gesetzgeber hat im „Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen“ (BGG) zur Begrifflichkeit „Behinderung“ eine rechtlich verbindliche Definition9 formuliert.
Diese dort enthaltene Definition zur „Behinderung“ gilt bei der Anwendung des „Gesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen“ für alle Menschen mit Handicap im gleichen Maße.
Übernahme des Begriffs „Behinderung“ durch die Bundesländer
Die Bundesländer haben die Definition der Begrifflichkeit „Behinderung“ in ihre Gesetze zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung aufgenommen. Dabei haben sie sich der Definition „Behinderung“ des „Gesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen“ (BGG) des Bundes angeschlossen und diese übernommen.
Die Definition „Behinderung“ in den Gesetzen zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung der Bundesländer gilt für ihren jeweiligen Zuständigkeits- bzw. Geltungsbereich.
Beispiel:
Thüringer Gesetz zur Gleichstellung und Verbesserung der Integration von Menschen mit Behinderungen vom 16.Dezember 2005
Читать дальше