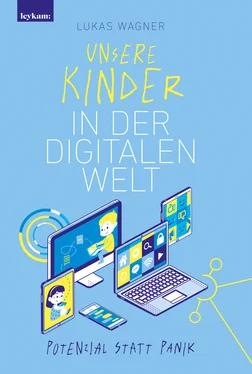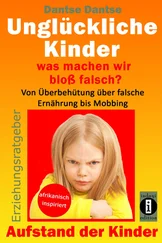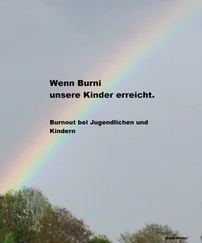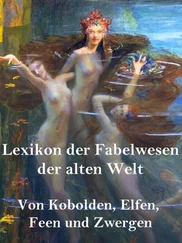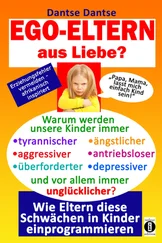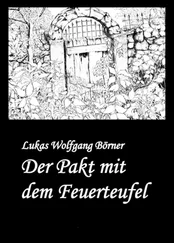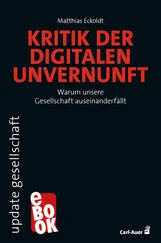Kinder, die nach 2007 geboren sind, haben eine Welt ohne ständige mobile Vernetzung niemals erlebt. Während die heutige Großelterngeneration von Vierteltelefonen erzählt (wo man immer hoffen musste, dass die Nachbarn nicht gerade telefonierten) oder von einer Zeit, in der es nicht rund um die Uhr unterschiedlichstes Fernsehprogramm gab, müssen wir der neuen Generation von einer Zeit berichten, in der nicht jede Information jederzeit auf Knopfdruck verfügbar war. Wir erzählen von einer Zeit, in der nicht jeder immer sofort erreichbar war und in der es vielleicht noch gar keine Mobiltelefone gab. Damals (also vor 2007), als Google Maps als Navigationssystem nicht auf jedem Smartphone verfügbar war. Oder damals, als es eigene Geräte zum Musikhören gab. Der Walkman, der Discman und der MP3-Player sind ganze Gerätetypen, die durch das Smartphone nahtlos ersetzt wurden.
Von Eltern wird ein pädagogisch sicheres Handeln mit Technologien erwartet, die sie selbst vielleicht nie hatten, und in digitalen Lebenswelten, die sie nicht verstehen oder noch nicht kennengelernt haben. Von Lehrerinnen und Lehrern wird gefordert, neue Medien im Unterricht zu verwenden und über diese zu informieren und zu sprechen, auch wenn dieses Thema kaum oder gar nicht Teil ihrer Ausbildung war. Die sogenannte digitale Revolution hat uns überholt und wir suchen laufend nach Antworten. Apps und Computerspiele können im Monatstakt wechseln, und während ein Trend erforscht wird, wurde er schon vom nächsten abgelöst. Wir bestaunen moderne 3D-Grafik, und der nächste angebliche Trend, die virtuelle Realität mittels Virtual-Reality-Brille, steht schon in den Startlöchern.
Wie viel ist zu viel? Wie kann ich etwas begleiten, was ich selbst nicht verstehe? Wie kann ich mein Kind unterstützen, wenn es selbst das Gerät weitaus besser bedienen kann als ich? Was ist die Faszination dieser Videos und Spiele? Warum fällt es so schwer, abzuschalten, und wie kann das trotzdem gelingen? Wie kann ich mein Kind vor möglichen Gefahren im Internet schützen? Wie kann es gelingen, ein mündiger und verantwortungsvoller Internetnutzer zu werden?
Dieses Buch soll dabei unterstützen, auf diese Fragen Antworten zu finden. Wichtig ist hierbei, dass es keine Standardantworten gibt, die für alle Familien passen. Alle Kinder und Jugendlichen sind unterschiedlich und ebenso alle Familien. Die digitalen Technologien und Trends ändern sich rasend schnell und die Forschung zur Wirkung digitaler Medien auf Erwachsene, aber noch mehr auf Kinder und Jugendliche, hinkt durch das hohe Tempo der Entwicklung hinterher. Das Buch soll eine Begleitung durch den digitalen Dschungel darstellen und dabei helfen, eigene Lösungen als Familie zu erarbeiten. Mit meiner Arbeit will ich Eltern, Bezugspersonen und Pädagoginnen und Pädagogen helfen, Kindern und Jugendlichen in ihren digitalen Lebenswelten zu begegnen, sie zu verstehen und zu begleiten. Damit soll dieses Buch eine unterstützende Funktion bei der Erfüllung unserer Aufgabe als Eltern und Pädagoginnen und Pädagogen haben, Kindern sichere Rahmenbedingungen zu bieten, damit diese selbstständig die Welt um sie herum entdecken können.
Heranwachsen in einer vernetzten Welt sieht heutzutage anders aus als die Medienerfahrungen der 90er-Jahre und des frühen neuen Jahrtausends. Als Neugeborener wurde er bereits von den Eltern mit der Handykamera fotografiert. Die Bilder wurden stolz in der WhatsApp-Familiengruppe geteilt und an Freunde verschickt. In diesem Stil werden auch die ersten Wochen und Monate von Klaus von Medien geprägt sein, von jeder Bildaufnahme, vom Videotelefonat über Skype mit den Großeltern und dem Läuten des Handys der Eltern, wenn Freunde telefonisch zu seiner Geburt gratulieren wollen. Selfies mit Klaus, süße Videos und vielleicht auch Fotos für den eigenen Blog oder Instagram-Account sind die früheste Form der Mediengestaltung, an der er, wenn auch noch passiv, teilnimmt.
Klaus sieht seine Eltern täglich mit diesen magischen Geräten interagieren. Sie leuchten, piepen, läuten, blinken und üben damit eine unglaubliche Anziehung aus. Gleichzeitig haben sie oft auch den Ruf des Verbotenen. Der Zugang zu diesen Geräten wird häufig durch die Eltern limitiert. Diese Verhaltensweise macht die Anziehung noch größer. Mit zwei oder drei Jahren beginnt Klaus, mit Kinder-Apps am Tablet zu spielen und gemeinsam mit der Mutter Fotos am Handy anzuschauen. YouTube-Videos ersetzen das Nachmittagsfernsehen, da hier alles immer auf Wunsch (möglichst kindergerecht) abrufbar ist. Auf »Shaun das Schaf« muss nicht gewartet werden, denn Shaun ist immer mit dabei. Beim Besuch der Freunde ist Ruhe, denn die Kinder schauen gemeinsam YouTube-Videos und haben dabei längst entdeckt, dass jede Berührung des Bildschirms eine direkte Reaktion des Geräts bewirkt. Neugierig, wie Klaus ist, beginnt er bereits, diese digitale Welt zu erforschen. In seinem Umgang mit der digitalen Welt ist Klaus dabei viel natürlicher als Erwachsene. Während die Generation der »Digital Immigrants«, also der digitalen Immigranten, die vor 1980 geboren wurden, mehr über Folgen und Komplikationen, Bezahlabos oder pornografische Inhalte nachdenkt, tippt Klaus fröhlich auf das erste blinkende Bild, um zu schauen, was passiert. Klaus ist ein sogenannter »Digital Native«, ein digitaler Eingeborener. Während die Digital Immigrants in eine digitale Welt erst nach und nach eingezogen sind, wurde Klaus als Digital Native bereits in diese Welt hineingeboren.
Mit sieben Jahren hat Klaus ein eigenes Tablet. Natürlich ist der Zugang zu diesem Gerät zeitlich limitiert, doch Klaus kann davon kaum genug bekommen. Um jede weitere Runde im Spiel und jedes weitere YouTube-Video wird mit den Eltern verhandelt: Noch eine Runde spielen, noch ein Video schauen, dann ist aber wirklich Schluss. Zur Erstkommunion bekommt Klaus ein eigenes Smartphone. Damit wird für ihn der Einstieg in die schon lange angekündigte Welt von WhatsApp und anderen Messengern möglich. Vorher hatte Klaus jahrelang Zeit, die Eltern im Umgang mit diesen Medien zu beobachten: Bilder verschicken, Nachrichten versenden, in Gruppen aktiv sein. Beim Essen läutet das Handy und der Vater erzählt von seiner Freundesgruppe, die sich zum Volleyball verabredet. Selbstverständlich will Klaus an dieser Welt der ständigen Verfügbarkeit und Kommunikation teilnehmen. Mit dem eigenen Handy werden Klaus endlich diese digitale Welt und die mit ihr verbundenen Möglichkeiten, wie Fotos und Videos zu verschicken, den eigenen Standort zu teilen und vieles mehr, eröffnet. Eine der größten Herausforderungen wird für ihn sein, von dieser Welt bewusst Abstand zu nehmen und Abgrenzung zu erlernen. Welchen Druck es bedeutet, ständig erreichbar zu sein, wird Klaus nun kennenlernen.
Spätestens mit Eintritt in die Unterstufe ist ein eigener Computer notwendig. Zunehmend werden auch in Volksschulen bereits Computer verwendet. E-Homework will erledigt werden, die Lehrerinnen und Lehrer schreiben E-Mails mit Zusatzaufgaben und Informationen zum Klassenausflug und Hausübungen dürfen statt mit Hand und Füllfeder mit Microsoft Word geschrieben werden. Die Zeiten von COVID-19 haben deutlich gemacht, wie sehr gesellschaftlich und politisch davon ausgegangen wird, dass alle Kinder Laptop und Internetanschluss besitzen und diese Technologien auch entsprechend bedienen können. Mit dem eigenen Computer wird auch die Spielewelt vom Handy auf den großen Bildschirm erweitert. Seine Freunde haben schon lange Spielkonsolen wie Xbox oder PlayStation, also möchte auch Klaus langsam eine eigene. Manche Freunde wollen nicht mehr zu Besuch kommen, da er keine Konsole besitzt.
Nach WhatsApp folgt ein Snapchat-Account, welcherdie Kommunikation mit Freundinnen und Freunden weiter beschleunigt. Darauf folgt der Instagram-Account. Klaus ist inzwischen zu einem Jugendlichen geworden und nutzt das Internet mit 14 Jahren etwa sechs Stunden pro Tag (ARD-ZDF-Onlinestudie 2019). Die durchschnittliche Nutzungsdauer ist 2019 im Vergleich zum Vorjahr um weitere 15 Minuten angestiegen. Fließend wechselt er zwischen WhatsApp, Snapchat, Instagram, Handy- und Konsolenspielen. Abgeschaltet wird ungern. Es gibt immer noch etwas, was wichtig ist – und selbstverständlich haben angeblich alle Klassenkolleginnen und Klassenkollegen unbegrenzten Zugriff auf ihre Geräte und viel weniger strenge Eltern.
Читать дальше