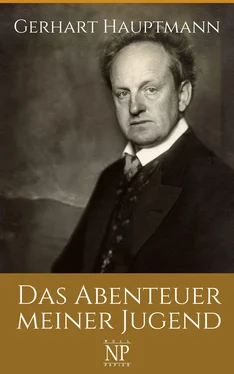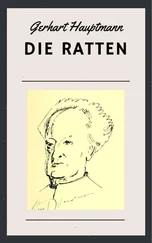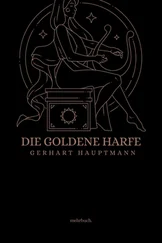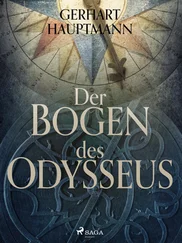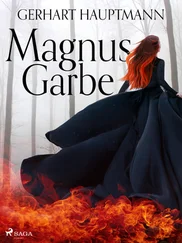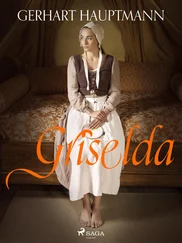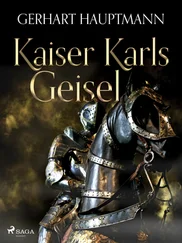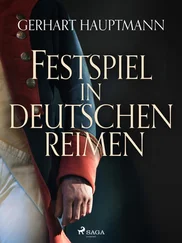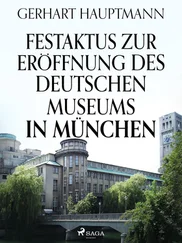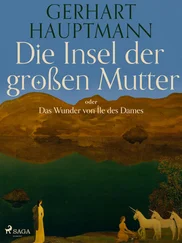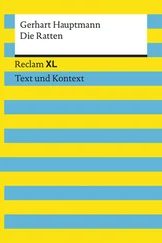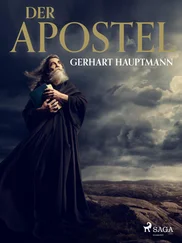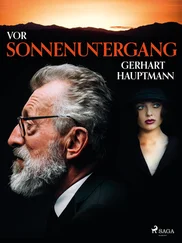*
Mein Vater bekämpfte in uns die Furchtsamkeit und besonders auch die Gespensterfurcht. Wenn winters Geistergeschichten erzählt wurden, was damals allgemein üblich war, warf er meist nur sarkastische Brocken ein. Die Korridore alter Schlösser mit ihren kettenschleppenden weißen Frauen, die Erscheinung Sterbender bei Verwandten, die hunderte Meilen entfernt wohnten, im Augenblick des Todes genossen bei ihm keine Glaubhaftigkeit. Ein bestimmter Fall aber, den er selber erlebt hatte, blieb auch für ihn unaufgeklärt.
Nachts bei Mondschein im Herbst kam er nach Hause. Auf dem Platz zwischen Elisenhalle und Elternhaus angelangt, hörte er seinen Namen rufen. Als er mit »Hier bin ich!« geantwortet hatte, trat eine kurze Stille ein. Die Stimme kam – oder schien zu kommen – aus einem düsteren Wäldchen auf dem Kronenberg, der unseren Vorgarten fortsetzte. Diesem Wäldchen gegenüber lag der Elisenhof, einer Familie Enke gehörig. Unsere Hintergärten grenzten aneinander Zaun an Zaun.
Ein junger und leider kranker Mensch aus dieser Familie hatte mit meinem Vater Freundschaft geschlossen. Ich denke, das Ganze muss, als noch meines Vaters Vater, Großvater Hauptmann, lebte, vorgefallen sein. Nun also, der Ruf wiederholte sich, mein Vater empfand ihn als Hilferuf, und als er wiederum mit »Hier bin ich!« geantwortet hatte, rannte er, wie um Hilfe zu bringen, gegen das Wäldchen hinauf.
Eine Weile vergeblichen Suchens überzeugte ihn, dass er einer Gehörtäuschung unterlegen sei, in der Stille der Nacht nicht ungewöhnlich. So war er bis vor das Kronenportal zurückgekehrt und wollte soeben den schweren Schlüssel im Schloss umdrehen, als es abermals klar und deutlich »Robert!«, seinen Vornamen, rief. Mit leichtem Schauder betrat er das Haus, ohne weiter Rücksicht zu nehmen.
Am nächsten Morgen wurde die Nachricht gebracht, dass der junge Enke gestorben sei. Und zwar in der Tat um die gleiche Zeit, in der mein Vater das Rufen gehört hatte.
Auch diesen Fall entkleidete mein Vater nach und nach des Wunderbaren. »Gespenster, die sich allzu mausig machen, soll man einfach beim Kragen nehmen«, sagte er, »oder ihnen mit einem tüchtigen Stock zuleibe gehen.« Hie und da, besonders im Herbst, wo er Zeit fand, sich uns zu widmen, wurden entsprechende Mutproben mit uns angestellt. An den späteren Nachmittagen, wenn die Nacht bereits hereingebrochen war und Mondschein sie zu schwachem Dämmer aufhellte, traten wir etwa aus dem Kleinen Saal auf die Terrasse hinaus, um noch ein wenig Luft zu atmen. Die Elisenhalle, mit ihrem dorischen Giebelbau, warf ihren Schatten auf den Platz, kein Mensch war zu sehen weit und breit und ebensowenig ein Laut zu hören.
Da konnte mein Vater plötzlich behaupten, dass er da und da, weit hinten auf einer Bank der Elisenhalle, seinen Hut vergessen habe, und den Wunsch äußern, ich möge sehen, ob er noch dort liege, und ihn womöglich zurückbringen. Es wäre ein Panamahut oder irgendso, und er würde ihn sehr ungern einbüßen.
Die Halle war offen nach Osten gegen den Park und gegen Westen geschlossen. An dieser Seite, hinter der unmittelbar die kupferfarbene Salzbach rauschte, hatte man nach Art eines Basars Verkaufsläden eingebaut.
Wenn man über die große Freitreppe auf den lehmgestampften Boden des Tempelbaues trat, weckte man lauten Widerhall. Am Ende des Raumes traf man, nachdem man über hölzerne Stufen einen Holzpodest erstiegen hatte, auf große Glastüren, die zum Kurhaus gehörten und dessen Gesellschaftssäle abschlossen. Rechts davor eine niedrige Tür führte in einen kleinen, meist übelriechenden Raum, der auf der anderen Seite durch ein gleiches Türchen verschlossen war. Nicht einmal am Tage war es uns Kindern angenehm, durch diesen »Sichdichfür«, dieses lichtlose Loch, hindurchzuschlüpfen. Es lief auf eine Brücke über die Salzbach aus.
Im Familienkreis galt ich als das verhätschelte, zutunlich weiche Nesthäkchen. Man wusste hier nichts – und nicht einmal ich selber wusste es – von dem Ruf, den ich auf der Gasse genoss, wo ich als ein verwegener, durchtriebener, gänzlich furchtloser Bursche genommen wurde. Wie oft war die Nacht über unserer wilden Spielerei hereingebrochen: der finsterste Winkel im Eifer des Kriegsspiels schreckte mich nicht.
Jetzt, im anderen Seelenkostüm, war ich scheu, ängstlich, furchtsam, verzärtelt, zimperlich. Nur mit heroischer Überwindung konnte ich dem Wunsche des Vaters nachkommen. Schon die Überquerung des Platzes, wo sommers die Droschken standen, war keine Kleinigkeit. Es kam dann das Ersteigen der Freitreppe mit dem tiefen, düstern Raume als Hintergrund. Kaum dass ich den hallenden Boden betrat, auf dem die dicken Schatten der Säulen lagen, fing ich auch schon zu laufen an, worauf sogleich vom Schall meiner Sohlen Tausende dämonischer Stimmen laut wurden. Sie schrien und peitschten allseitig auf mich ein. Und nun kamen die blinden Glastüren der Kursäle, die, eisige und leere Höhlen, dahinter lauerten. Das Kurhaus war im Winter geschlossen. Die Scheiben klirrten von meinem Schritt, und unter mir tönte hohl die Holzdiele. Zur Rechten hatte ich den scheußlichen Sichdichfür, worin ich mir etwas wie lauernde mörderische Erinnyen vorstellte. Wenn ich den Hut nun durchaus nicht entdecken konnte, lief ich, vielleicht mich anders besinnend, nicht wie gehetzt davon und zurück, sondern bewegte mich steif und auf lautlos-furchtsame Weise. Und nun traten wohl vor die vernagelten Läden die sommerlichen Inhaber: das Gespenst Gertischkes, des Porzellanmalers, des Glaswarenhändlers Krebs, von dem bekannt war, dass er überall seinen Sarg mit sich führte. Das alles war mehr als gruselig.
*
Damals war Beleuchtung durch Gas eben aufgekommen. Mein Vater neigte zu jeder Art von Modernität, so legte man auch in der Preußischen Krone Gasröhren. Die Brenner mit der in einer Explosion sich entzündenden fächerförmigen Flamme waren primitiv. Unsere verhältnismäßig kleinen Wohnzimmer erfüllten winters an langen Abenden giftige Rückstände. Das rügte die allen Neuheiten abgeneigte Mutter. Den Stolz des Vaters auf diese Art Beleuchtung beugte das nicht.
Eines Tages nahm er mich mit in die Gasanstalt. Nun wurde mir deutlich, dass die Gasbeleuchtung von Ober-Salzbrunn überhaupt unter seiner Leitung stand und von ihm eingerichtet worden war. Die Heizung der Retorten und die Bedienung des Gasometers lag in der Hand eines Werkmeisters namens Salomon. Er, den selbst ich sofort als Lungenkranken erkennen konnte, hatte vielleicht die Salzbrunner Stellung in der Hoffnung, an den Heilquellen zu genesen, angenommen. Dieser Salomon mit seinem Ernst, seiner hohlen Stimme, seinem blauen Kittel, mit der Kohlenschaufel vor der zitternden Weißglut seiner Retorten hat mir einen tiefen Eindruck gemacht. Ich sah zum ersten Mal den modernen Arbeiter, eine Menschenart, die mir einen ganz anderen Respekt abnötigte als jede, die mir sonst vor die Augen gekommen war. Ein neuer Adel, schien mir, umgab diesen Mann, der hier seine Höllenschlünde in Brand setzte, in ihrer gefährlichen Nähe hantierte mit gelassener Selbstverständlichkeit und einem unbeirrbaren Pflichtgefühl. Er erklärte mir, wie man den Gasometer auffüllte, und mein Vater deutete an, dass ein einziger hineinverirrter Funke eine Explosion verursachen könne, die uns alle in Stäubchen zerreißen würde.
Читать дальше