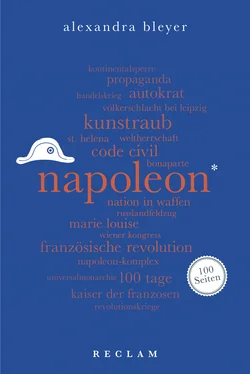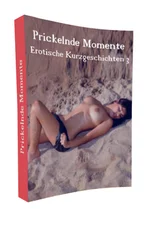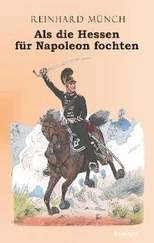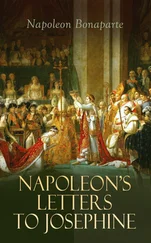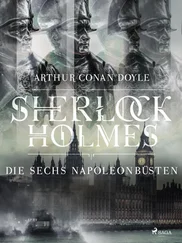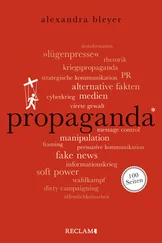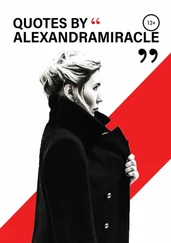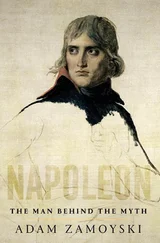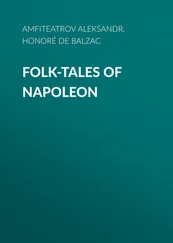In Romanen findet sich oft der Vermerk, dass Ähnlichkeiten mit lebenden Personen oder Handlungen rein zufällig und unbeabsichtigt seien. Ich will keine Diskussion auslösen, wie viel Napoleon in heutigen Staatsmännern stecken könnte, und ich weigere mich entschieden, ihn mit Donald Trump auf eine Stufe zu stellen. Allerdings gestehe ich, dass sich der 45. Präsident der Vereinigten Staaten mehr als einmal in das vor meinem inneren Auge entstehende Bild gedrängt hat. Das tat weh. Jedoch lassen sich manche Parallelen zwischen der Politik von einst und heute nicht leugnen, was besorgniserregend ist, war doch die Zeit um 1800 von Krieg, Krieg und nochmals Krieg geprägt.
Jede Geschichte beginnt mit dem ersten Satz. Entsprechend große Bedeutung wird ihm zugeschrieben, denn er soll neugierig machen und in die Erzählung hineinziehen. Der Historiker Thomas Nipperdey leitete seine Deutsche Geschichte 1800–1866 besonders elegant mit den vielzitierten Worten »Am Anfang war Napoleon« ein. Er bezog sich dabei auf die radikale Neugestaltung deutscher Verhältnisse und die Reformen zu Beginn des 19. Jahrhunderts; die Worte passen aber auch gut zur Gründung des Kaisertums Österreich. Der Faden lässt sich beliebig weiterspinnen: In welchen Bereichen stand Napoleon noch am Anfang?
Würden uns die Hieroglyphen heute noch vor ein Rätsel stellen, wenn General Napoleon Bonaparte 1798 nicht nach Ägypten gezogen wäre? Er selbst hatte, da er die Invasion Großbritanniens für wenig aussichtsreich hielt, auf das Unternehmen gedrängt, um auf den Spuren Caesars sowie Alexanders des Großen Ruhm und Ehre zu erlangen. Dabei plante er, die Briten zu schlagen und von Indien abzuschneiden sowie Ägypten als reiche Kolonie für Frankreich zu erwerben. Freilich erwies sich der Feldzug in militärischer Hinsicht als Desaster; als ihm der Boden zu heiß wurde, reiste er heimlich ab, um sich kurz darauf in Paris an die Staatsspitze zu putschen. Doch obwohl die französischen Truppen 1801 kapitulierten, gelang es Napoleon, die Expedition als großen kulturhistorischen Schritt für die Menschheit zu vermarkten. In seinem Gefolge befanden sich zahlreiche Kartografen, Wissenschaftler und Künstler, deren Eindrücke und Erkenntnisse in der mehrbändigen ›Beschreibung Ägyptens‹ ( Description de l’Égypte ) festgehalten wurden.
Die übersprudelnde Begeisterung für das Land der Pharaonen (die sogenannte Ägyptomanie) spiegelte sich in Literatur sowie Kunst und Alltagsgegenständen der damaligen Zeit wider. Eine Sphinx hier, eine Pyramide dort, und so ein Obelisk macht schon etwas her. Die österreichische Kaiserin Maria Ludovica ließ sich beispielsweise ein Ägyptisches Kabinett einrichten, das heute im Hofmobiliendepot (Möbel Museum Wien) bestaunt werden kann. 1812 ließ William Bullock für seine Sammlung in London ein Museum im ägyptischen Stil erbauen, The Egyptian Hall , in der 1821 eine große Ausstellung über das alte Ägypten eröffnet wurde.
In Kairo gründete Napoleon das Institut d’Égypte als Wissenszentrum, aber es war eine zufällige Entdeckung, die Wissenschaftsgeschichte schrieb. Als der französische Leutnant Pierre-François Xavier Bouchard mit seinen Soldaten in der Hafenstadt Rosette eine Mauer abriss, fiel ihm ein schwarzer Stein mit seltsamen Schriftzeichen auf, den er zur weiteren Untersuchung nach Kairo schickte. Der Stein selbst landete zwar im Britischen Museum in London – denn wie gesagt, die Briten zogen in Ägypten als Sieger vom Felde –, doch konnten die Franzosen davor zahlreiche Kopien der Inschriften anfertigen. Es handelte sich um ein Dekret der ägyptischen Priestersynode in Memphis aus der Regierungszeit des Königs Ptolemaios V. Epihanes, die aus dem Jahr 196 v. Chr. stammte. Durch den direkten Vergleich mit der altgriechischen und demotischen Inschrift gleichen Inhalts gelang es dem Franzosen Jean-François Champollion 1822, die Hieroglyphen zu entschlüsseln. Napoleon selbst erlebte dies bedauerlicherweise nicht mehr mit, denn er war im Jahr davor verstorben. Doch fest steht: Am Anfang der Ägyptologie, die sich um 1860 als wissenschaftliche Disziplin etablierte, war Napoleon.
Wenn fremde Kulturen – wie in diesem Fall Orient und Okzident – aufeinandertreffen, tun sich für beide Seiten neue Welten auf. So wie die Franzosen viel über Land und Leute erfuhren, lernten die Einheimischen Neues kennen. Neben den Ideen der Aufklärung und ihren Kanonen brachten die französischen Truppen Druckerpressen samt Matrizen mit lateinischen, griechischen und arabischen Schriftzeichen mit und führten den Buchdruck ein. Mehmed Ali Pascha, der 1805 als Gouverneur an die Macht kam, hatte als Offizier gegen die Franzosen gekämpft und war von deren militärischer Überlegenheit beeindruckt gewesen. Napoleon, der in Ägypten unter anderem die Verwaltung modernisiert hatte, wurde zu seinem Vorbild, da auch Mehmed Ali auf Reformen und Bildung setzte. So kann Napoleon gewissermaßen als Wegbereiter der Moderne in Ägypten und in weiterer Folge als Impulsgeber für die wenig später einsetzende arabische Renaissance ( Nahda ) gesehen werden.
Kehren wir von den Pyramiden zurück nach Europa. Schon in der Mitte des 18. Jahrhunderts hatte der preußische Chemiker Andreas Sigismund Marggraf Zucker in verschiedenen Pflanzen wie etwa in der weißen Rübe entdeckt. Sein Mitarbeiter Franz Carl Achard experimentierte mit verschiedenen Sorten und züchtete die »Weiße Schlesische Rübe«; 1802 gründete er in Niederschlesien die erste Rübenzuckerfabrik. Ob das gutgehen konnte? Der Zuckergehalt der Rüben war mit damals etwa 5 Prozent gering, und so lange es reichlich relativ günstigen Rohrzucker aus den Kolonien gab, rentierte sich das Geschäft nicht. Das änderte sich schlagartig, als Napoleon im Handelskrieg mit England 1806 die Kontinentalsperre verkündete. Kolonialgüter wie Kaffee und Kakao, Tabak und Rohrzucker wurden knapp, Ersatz war gefragt. Dank Napoleon erlebte die Rübenzuckerindustrie ihren ersten Boom, der aber nur bis zu seinem Sturz andauerte, bevor der Rübenzucker später dann doch noch seinen Siegeszug antrat.
Dankbarkeit darf Napoleon von weniger hünenhaften Männern hingegen nicht unbedingt erwarten. Sie sehen sich häufiger mit dem Vorurteil konfrontiert, sich minderwertig zu fühlen und ihre geringe Körpergröße durch egoistisches Verhalten sowie Statussymbole kompensieren zu wollen. Es war der Psychologe Alfred Adler, der den Begriff »Napoleon-Komplex« prägte – ob etwas dran ist, bleibt umstritten. Allerdings folgte Adler einer falschen Umrechnung und hielt Napoleon für kleiner, als er war. Übrigens: Donald Trump soll 1,90 Meter groß sein, sofern es sich bei den Angaben nicht um Fake News handelt. Etwaige Minderwertigkeitskomplexe, ein übersteigertes Selbstbewusstsein und Geltungsdrang hängen wohl nicht zwingend von der Körpergröße ab.
Wie groß war Napoleon also? Er maß laut Kammerdiener »fünf Fuß, zwei Zoll und drei Linien«. Man muss kein Schuhverkäufer sein, um zu wissen, dass nicht jeder Fuß gleich lang ist; dasselbe trifft auf die vom Unterarm abgeleitete Maßeinheit der Elle zu. Im 18. Jahrhundert gab es in Europa eine verwirrende Anzahl unterschiedlicher, teils regionaler Maßeinheiten, was Händler herausforderte und ellenlange Umrechnungstabellen erforderlich machte. Doch die französischen Revolutionäre waren der Meinung: Wenn schon Revolution, dann richtig, und sie führten das metrische dezimale System ein. Als Napoleon die Revolution beendete, behielt er sinnvoll erscheinende Maßnahmen bei und förderte die Verbreitung des metrischen Systems, das beispielsweise im Königreich Westphalen eingeführt wurde.
Aber wie groß war er denn nun mit seinen »fünf Fuß, zwei Zoll und drei Linien«? Nach dem französischen Maßstab waren das 1,68 Meter, womit er leicht über dem Durchschnitt seiner Zeit lag. Zöge man jedoch einen anderen, beispielsweise den englischen, Maßstab heran, wäre er viel kleiner gewesen. Wenn es um die Größe von Staatsmännern geht, zählen ohnehin weniger die tatsächlichen Maße als die Wahrnehmung. Wie sehen sie sich selbst, wie werden sie von anderen gesehen und wie wollen sie gesehen werden? Napoleon wurde von seinen Soldaten am italienischen Kriegsschauplatz 1797 liebevoll le petit caporal (kleiner Korporal) genannt; die feindlichen Briten schmähten ihn als little boney und stellten ihn in vielen Karikaturen als Winzling dar.
Читать дальше