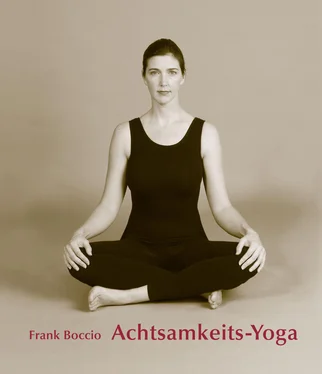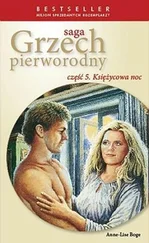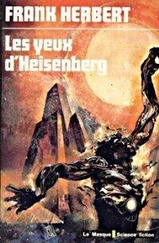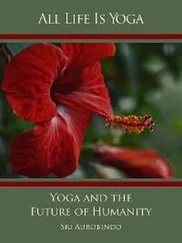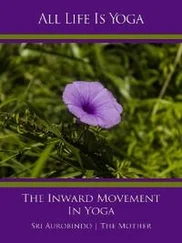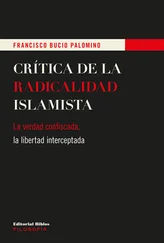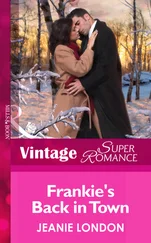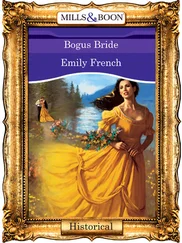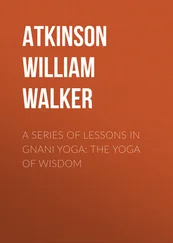Als Konsequenz des Kastensystems, in dem die Praktiken der Brahmanen immer spezialisierter und ritualisierter wurden, entfremdeten sich viele Menschen, die am unteren Ende der sozialen Leiter standen, vom brahmanischen Glauben als gelebte religiöse Erfahrung. Bereits zwischen 1500 und 1000 verwandelte sich deshalb der nach außen orientierte ritualisierte Brahmanismus, mit seiner Betonung auf Feuerzeremonien und Tieropfern, in eine eher nach innen gerichtete Form der spirituellen Praxis. Aus dieser Gegenbewegung stammen die ersten Upanischaden .
Das Wort upanishad bedeutet „nahe bei jemandem sitzen“ (etwa zu Füßen eines Lehrers), was darauf hindeutet, dass die Belehrungen der Upanischaden direkt von Lehrern zu Schülern weitergegeben wurden. Obwohl ihre Lehren sehr unterschiedlich sind, worauf Georg Feuerstein in seinem wunderbaren Buch The Yoga Tradition hingewiesen hat, können wir vier Themen erkennen, die eng miteinander verknüpft sind: (1) Der transzendente Kern der eigenen Existenz, Atman. Er ist mit dem transzendenten Grund des Seins, Brahman, identisch. (2) Die Lehre von der Reinkarnation, die manchmal auch als „wiederholte Verkörperung“ (punar-janman) oder, in den frühen Upanischaden, als „wiederholter Tod“ (punar-mrityu) bezeichnet wird. (3) Die Lehre vom Karma, ein Begriff, der „Handlung“ bedeutet und auf die moralische Qualität des eigenen Tuns und der eigenen Absichten, Gedanken und Äußerungen verweist. Dabei handelt es sich um eine Lehre der moralischen Kausalität, in der die auf Ursache und Wirkung beruhenden Konsequenzen einen ähnlichen Stellenwert haben wie die Naturgesetze in der modernen Wissenschaft. (4) Die Vorstellung, dass die karmischen Gesetze nicht fatalistisch sind: Durch spirituelle Praktiken, Entsagung und Meditation zum Beispiel, kann Karma transzendiert und die Wiedergeburt überwunden werden. Als die nach Patanjali verfassten Yoga-Upanischaden entstanden – viele von ihnen erst im 14. und 15. Jahrhundert u. Z. –, war Yoga zu einem Synonym für einen praktischen Ansatz zur Befreiung geworden.
Als Buddha zur Welt kam – sein Geburtsjahr wird meist mit 563 v. u. Z. angegeben –, war die brahmanische Priesterschaft bereits eine erstarrte, zumeist korrupte und abgesonderte Klasse. Zum Zeitpunkt von Buddhas Geburt hatten die Kasten, die ursprünglich nicht erblich gewesen waren, eine religiöse Überhöhung und Begründung erfahren. Jetzt wurden sie als Spiegel der kosmischen Ordnung betrachtet und galten deshalb als unveränderbar. Es gab keine soziale Mobilität. Den Menschen am unteren Ende der sozialen Leiter, die sich zweifelsohne nach spirituellen Lehren sehnten, die sie direkt ansprachen, wurde der Zugang zu den brahmanischen Unterweisungen verweigert und sie wurden von den höheren Kasten isoliert. Dadurch wurde die Verbindung zwischen dem brahmanischen Glauben und ihrer Lebenserfahrung abgeschnitten. Zur selben Zeit verbreiteten sich die Vorstellungen der Upanischaden in den intellektuellen Kreisen der Gesellschaft. Als Alternative zum strengen Ritualismus der Brahmanen entwickelte sich eine Bewegung umherziehender Asketen. Einige dieser Wanderasketen waren sogar brahmanischen Ursprungs. Sie wurden paribbajakas oder „Wanderer“ genannt, ganz gleich, ob ihre Praktiken orthodox waren – also auf den Veden beruhten – oder nicht. Eine weitaus größere Gruppe, die shramanas (Pali: samanas), was auf Deutsch „Suchende“ heißt, setzte sich aus den Angehörigen anderer Kasten zusammen, die unterschiedlichsten heterodoxen Praktiken folgten.
Die Shramanas, die ein asketisches Leben führten, zogen durch Städte und Dörfer und lebten außerhalb familiärer Bindungen von den Almosen, die man ihnen gab. Sie übten sich in Kontemplation und verbreiteten ihre Theorien, die sie untereinander und mit anderen Gruppen untersuchten und diskutierten. Die Jainas, die noch heute in Indien existieren, sind als religiöse Gemeinschaft aus den Shramanas hervorgegangen. Es gibt jedoch eine weitere Religion, die größer ist und ein weltweites Ansehen genießt, die ihren Anfang in einer Gruppe von Shramanas hatte: der Buddhismus.
Siddharta Gautama wurde als Sohn eines raja, eines Königs, in die Kaste der Kshatriyas geboren und genoß eine privilegierte Stellung. Trotz seines luxuriösen Lebenswandels fühlte sich der junge Siddharta unzufrieden. Das Wissen um die Unbeständigkeit des Lebens, die Tatsache, dass er Alter, Krankheit und Tod nicht entgehen würde, ließen ihn keinen geistigen Frieden finden. Doch dann sah er eines Tages einen Shramana. Diese Begegnung inspirierte ihn, einem spirituellen Pfad zu folgen. Als er die innere Ruhe, Stille und Zufriedenheit des Shramana bemerkte, überlegte der junge Prinz: „Vielleicht weiß er etwas. Vielleicht ist das der Weg. Vielleicht finde ich so eine Antwort auf die Fragen, die mich quälen.“ Von dieser Einsicht ermutigt, unternahm Siddhartha einen Schritt, den man später als die „Große Entsagung“ bezeichnen würde. Er ließ seine Familie und das luxuriöse Dasein im Palast hinter sich und brach zu einem Leben in der Hauslosigkeit auf. Der Bodhisattva (wie der Buddha vor seiner Erleuchtung genannt wurde) suchte in seinem Wunsch, die Befreiung zu finden, zuerst den Shramana-Heiligen Alara Kalama auf. Siddhartha war ein wissbegieriger Schüler, der die intellektuellen Lehren Alara Kalamas schnell begriff. Er war damit jedoch nicht zufrieden und fragte ihn nach den Meditationszuständen, in denen diese Lehren gründeten. Ihm wurde gesagt, diese seien die „Sphäre des Nichts“, ein tiefer Zustand, den man durch yogische Konzentration erreichen könne, in dem der Geist alle Objekte hinter sich lasse und im „Gedanken“ des Nichts verweile. Siddhartha lernte diesen Zustand sehr schnell zu verwirklichen, woraufhin Alara Kalama ihm anbot, seine Gemeinschaft gemeinsam zu leiten. Doch Siddhartha lehnte ab. Obwohl er einen hohen Grad an innerer Ruhe erreicht hatte, empfand er, dass dies noch nicht die Erleuchtung war, nach der er suchte; er fand, dass er das Leiden noch nicht überwunden hatte:
„Da kam mir der Gedanke: Diese Lehre führt nicht zur Befriedung der Leidenschaft, nicht zur Freiheit vom Begehren, nicht zum Verlöschen, nicht zum Frieden, nicht zur unmittelbaren Einsicht, nicht zur Erleuchtung, nicht zu Nibbana, sondern nur zum Grund des Nichts. Diese Lehre befriedigte mich nicht. So zog ich weiter, um meine Suche fortzusetzen.“
Gautama suchte einen zweiten Lehrer auf, Uddaka Ramaputta. Von dessen Lehren war er jedoch ebenfalls enttäuscht, außer dass er von Uddaka die noch höhere yogische Verwirklichung der „Sphäre, die weder Wahrnehmung noch Nichtwahrnehmung ist“ erlernte. Darüber sagte er später:
Selbst in der Sphäre, die weder Wahrnehmung noch Nichtwahrnehmung ist, in der die Befreiung von Form und Formlosigkeit verwirklicht wird, bleibt noch etwas – und zwar das, was von ihnen befreit wurde, der Betrachter „der Sphäre, die weder Wahrnehmung noch Nichtwahrnehmung ist“. Solange es diesen Betrachter gibt, den einige als die Seele bezeichnen, ist er der Samen der Wiedergeburt, auch wenn er für einige Momente vor dem Kreislauf des Leidens geschützt war. Sobald die Situation sich verändert, wird die Wiedergeburt ganz leicht von Neuem stattfinden. Dies geschieht in dem Moment, in dem ich mich aus der Meditation erhebe. Ganz gleich, wie tief meine Versenkung war, schon nach kurzer Zeit verstricke ich mich bereits wieder in die Welt der Sinneseindrücke. Die grundlegenden Ursachen und Bedingungen der Wiedergeburt wurden nämlich noch nicht ausgelöscht. Die vollständige Befreiung wurde noch nicht verwirklicht. Nach der Erleuchtung muss noch gesucht werden.
Aus zwei Gründen können diese Versenkungen, wie tief und subtil die darin erfahrenen Bewusstseinszustände auch sein mögen, nicht das Nirvana sein: Wenn Siddhartha aus diesen Versenkungen auftauchte, erkannte er, dass er trotzdem immer noch der Gier, der Abneigung und der Verblendung unterworfen war. Die meditative Erfahrung hatte zu keiner permanenten Verwandlung geführt, und er hatte durch sie keinen dauerhaften Frieden gefunden. Doch Nirvana wurde nicht als eine vorübergehende Erfahrung definiert; es sollte ewig sein.
Читать дальше