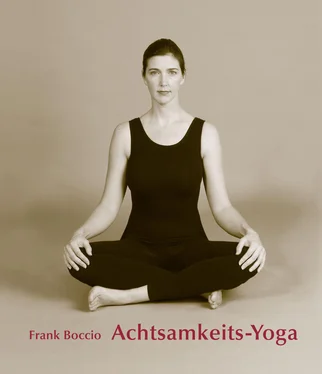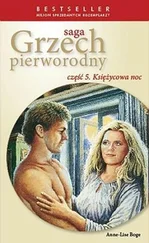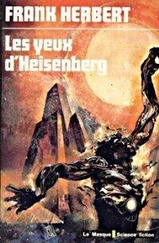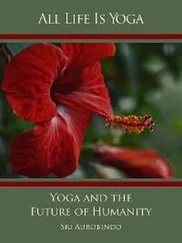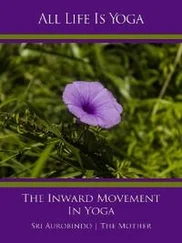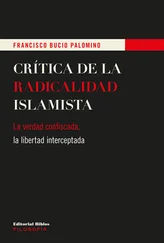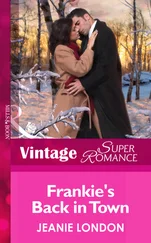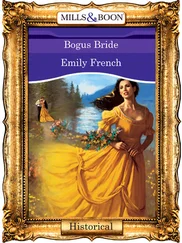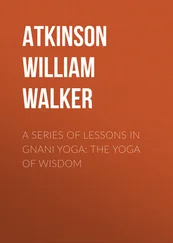Heutzutage wird der Yoga in Amerika und anderen westlichen Ländern nur allzu oft auf die Asanas reduziert. In den meisten Yoga-Klassen, die Sie besuchen, werden Sie nur wenig oder gar keine Meditation finden, ganz zu schweigen von einer Diskussion des Kontextes, in den die Praxis der Asanas eingebettet ist. Als ich mit dem Studium des Yoga begann, gab es keine wirkliche Meditationsunterweisung. Obwohl die Asanas angeblich eine Vorbereitung auf die Meditation sein sollten, schienen wir nie zum Meditieren zu kommen.
Wie Buddha lehrte, sollten wir in jeder der vier Positionen oder „Haltungen“, die alle Aktivitäten des Lebens repräsentieren – Sitzen, Stehen, Gehen und Liegen – meditative Aufmerksamkeit entwickeln. Das können wir auch, wenn wir allem, was wir tun, und allem, was auftaucht, achtsam begegnen. Dann leben wir im „ewigen Jetzt“ und halten „unsere Verabredung mit dem Leben“ ein, wie Thich Nhat Hanh es sagt, die immer im gegenwärtigen Moment stattfindet.
Buddhas ausführliche Unterweisungen zur Achtsamkeits-Meditation finden sich in zwei wichtigen Lehrreden, im Anapanasati-Sutta (Sutra des Bewussten Atmens) und im Satipatthana-Sutta (Sutra der Vier Verankerungen der Achtsamkeit). Im sechsten Kapitel, „Eine Einführung in die Sutras“, werde ich diese vorstellen und aufzeigen, wie sie sich gegenseitig ergänzen. Es wird darum gehen, wie wir durch spezielle Übungen, die Buddha lehrt, die Asanas als Achtsamkeits-Meditation praktizieren können.
Wenn wir uns in dieser Weise, wie es im dritten Teil beschrieben wird, mit den Yoga-Asanas beschäftigen, können wir Einsichten erlangen, die uns verwandeln und heilen und uns sogar von vielen unserer begrenzenden und zerstörerischen Denk- und Verhaltensmuster befreien. Buddha versichert uns, dass die Übung des bewussten Atmens uns mit Erfolg die Vier Verankerungen der Achtsamkeit praktizieren lässt. Diese wiederum, wenn sie beständig entfaltet und geübt werden, lassen uns in den Sieben Faktoren des Erwachens verweilen, die zu tiefer Einsicht und vollständiger Befreiung des Geistes führen.
Aber nehmen Sie mich (oder ihn) nicht beim Wort. Praktizieren Sie, und finden Sie es selbst heraus!
Intermezzo

Die Wurzeln des Yoga finden sich bereits in den Veden, den ältesten indischen Überlieferungen, die von gläubigen Hindus als offenbarte Schriften betrachtet werden. Die Veden, die bis in das 4. Jahrtausend v. u. Z. zurückreichen, werden als ewig, ungeschaffen und unanfechtbar angesehen – auch wenn sie Gegenstand vielfältiger Interpretationen sind. Seit seinen frühesten Anfängen ist es schon immer das Ziel des Yoga gewesen, eine Praxis der disziplinierten Introspektion oder meditativen Betrachtung zu entwickeln, die auf eine Transzendierung des egozentrischen Selbst ausgerichtet ist. Anfangs bestanden diese meditativen Praktiken hauptsächlich im Abhalten von Opferritualen. Mit dem Entstehen der Upanischaden und einer upanischadischen Yoga-Praxis, die sich über mehrere Jahrhunderte entwickelte, richteten sich die meditativen Praktiken immer stärker nach Innen, und das Opfer verwandelte sich von einer direkten, äußeren Handlung in einen metaphorischen und inneren Prozess.
Ironischerweise ist die Tradition des Yoga, wenn man an die Bedeutung des Begriffs im Sinne von „Einheit“ denkt, nie sonderlich einheitlich gewesen. Von Anfang an hat es unterschiedliche Schulen und Ansätze gegeben. Selbst Lehrer einer bestimmten Schule vertreten oft unterschiedliche Ansichten und Praktiken. Manchmal widersprechen sich die verschiedenen Lehren sogar. Wenn wir von Yoga sprechen, meinen wir deshalb eine ganze Reihe yogischer Pfade und Anschauungen – ja sogar Ziele, die auf den ersten Blick unterschiedlich erscheinen, obwohl alle davon sprechen, dass ihr Ziel die Befreiung sei. Und das ist auch gut so, denn es gibt ganz unterschiedliche Persönlichkeiten mit vielfältigen Neigungen und in verschiedenen Lebensabschnitten, die sich zur Yoga-Praxis hingezogen fühlen. Buddha selbst soll gesagt haben, dass es 84 000 Dharma-Tore gebe – Praktiken, die zur Befreiung führen.
Trotz dieser inneren Vielfalt der Yoga-Tradition stimmen alle zumindest in einem Punkt überein: Die Welt ist nicht das, was sie zu sein scheint, und es gibt ein ganz reales Bedürfnis nach „Selbst-Transzendierung“, also danach, die begrenzte menschliche Persönlichkeit mit ihren einschränkenden gewohnheitsmäßigen Handlungsmustern zu überschreiten, um zu der Wahrheit der Wirklichkeit, so wie sie ist, zu erwachen. Es ist also nur der Weg, auf dem diese Transzendierung, dieses Erwachen erreicht und wie er beschrieben wird, der sich in den einzelnen Schulen und Traditionen unterscheidet.
Innerhalb der weitläufigen Yoga-Tradition, die aus meiner Sicht auch die Lehren Buddhas, der Jainas (wie die Praktizierenden des Jainismus richtig genannt werden) und ihres Begründers, des Weisen Mahavira, sowie die verschiedenen yogischen Ansätze in der Kultur des Hinduismus umfassen, können wir diverse Hauptformen des Yoga erkennen, die sich verbreitet haben: bhakti-Yoga, karma-Yoga, jnana -Yoga, raja -Yoga, mantra -Yoga und tantra -Yoga. Außerdem zählen dazu auch hatha -Yoga, kundalini -Yoga und laya -Yoga, die alle sehr eng miteinander verwandt sind, auch wenn sie immer wieder als unterschiedliche Schulen bezeichnet werden. Alle drei sind vom Tantra-Yoga beeinflusst, von dem sie möglicherweise auch abstammen.
Bhakti-Yoga wird häufig als Pfad der Verehrung bezeichnet, dessen Anhänger das Transzendent-Absolute in einer persönlichen Gottheit erkennen. Einige Praktizierende folgen dabei einem dualistischen Ansatz und betrachten das Göttliche als das Andere. Wieder andere versuchen, das Selbst mit dem Göttlichen zu vereinen, indem sie die Illusion einer unabhängigen Ich-Persönlichkeit solange auszulöschen versuchen, bis das Göttliche als die einzig existierende Wirklichkeit erkannt wird. Es wird behauptet, dass dies ein Pfad für eher emotional geprägte Menschen sei, dessen hauptsächliche Praxis aus kirtan besteht, der Rezitation von Gesängen, die das Göttliche verehren.
Karma-Yoga ist der Yoga des Handelns, womit vor allem ein Tun gemeint ist, das einer bestimmten inneren Haltung entspringt – der Haltung der selbstlosen Hingabe –, die wiederum selbst eine geistige Handlung darstellt. („Karma“ bedeutet ganz einfach „Handlung“.) Zu handeln, seine Pflichten zu erfüllen, ohne dabei an einem Resultat festzuhalten, ist die Praxis eines Karma-Yogi. Dieses selbstlose Tun entspricht dem „nicht handelnden Handeln“ des Daoismus und wird von Krishna in der Bhagavad-Gita hoch gerühmt. In einem ganz wirklichen Sinne ist diese geistige „Haltung“ die grundlegende Asana-Praxis der Karma-Yogis.
Jnana-Yoga ist der Yoga des Wissens, der fast schon zu einem Synonym für Vedanta geworden ist, jene nichtdualistische Hindu-Tradition, in der die Verwirklichung durch die Erkenntnis des Wirklichen gegenüber dem Unwirklichen gesucht wird. Der Geist wird eingesetzt, sagt man in dieser Richtung, um über den Geist hinauszugehen. Ein moderner Vertreter dieser Tradition ist der große Weise Ramana Maharishi, der seinen Schülerinnen und Schülern lehrt, sich beständig zu fragen: „Wer bin ich?“ Diese Technik ähnelt der Koan-Praxis des Rinzai-Zen.
Raja-Yoga oder königlicher Yoga steht insbesondere für das Yoga-System Patanjalis. Ursprünglich unterschied man damit Patanjalis achtfachen Pfad, der die Meditation betont, vom relativ jüngeren Hatha-Yoga. Über diesen Yoga werde ich an anderer Stelle in diesem Buch mehr sagen.
Читать дальше