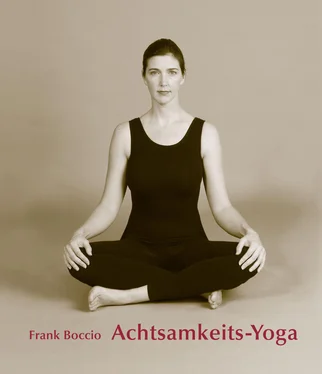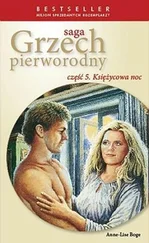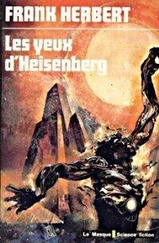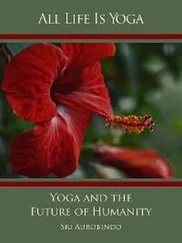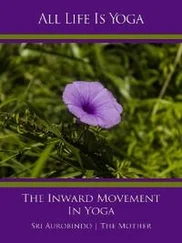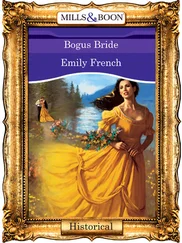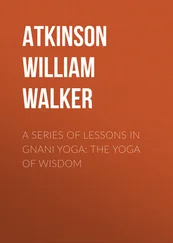Als jemand, der Naturwissenschaften studiert hatte und sich für einen Atheisten hielt, konnte ich mich mit dem Buddhismus anfreunden. Seine Religion war nichttheistisch, psychologisch durchdacht und erfrischend undogmatisch. Vor allem gefiel mir aber, dass Buddha seinen Anhängerinnen und Anhängern ausdrücklich empfahl, nichts einfach nur deshalb zu akzeptieren, weil Lehrer (einschließlich er selbst) es ihnen gesagt hatten, oder etwas nur zu glauben, weil es in den Schriften stand, solange sie es nicht selbst überprüft hatten. Stattdessen riet er ihnen, gewisse „geschickte Mittel“ zu praktizieren und selbst darauf zu achten, ob sie funktionierten. Wenn das, was sie dabei herausfanden, mit dem übereinstimmte, was die Weisen lehrten, wenn es zu einem harmonischen Leben beitrug, das frei von Leiden war, dann sollten sie diese Wahrheit annehmen und in Übereinstimmung mit ihr leben. Falls die Praktiken, die Buddha lehrte, in ihrer Erfahrung das Leiden linderten, sollten sie dabei bleiben. Wenn sie jedoch entdeckten, dass bestimmte Verhaltensweisen zu Unheil und Ungemach führten, dann sollten sie von diesem Verhalten ablassen.
Doch erst als ich Zen-Geist, Anfänger-Geist entdeckte, als ich Suzuki Roshis offenes, direktes und warmherzig-ehrliches Gesicht auf dem Buchumschlag sah und mir seine klaren Worte begegneten, wurde ich dazu angeregt, mit der Dharma-Praxis zu beginnen. Meine ersten Studien des Buddhadharma fanden in der japanischen Soto-Tradition statt. Was ich im Zendo lernte, anfangs durch Vorträge und Dharma-Unterweisungen, später in meiner eigenen Zazen-Praxis, leitete allmählich einen Prozess der Verwandlung ein, der mir heute fast wie ein Wunder vorkommt.
Damals befand ich mich jedoch in einer zwiespältigen Situation. Meine Mitschüler im Ashram, in dem ich Yoga studierte und praktizierte, waren über meiner Begeisterung für den Buddhismus verwundert, denn „diese sauertöpfischen Buddhisten reden doch über nichts anderes als das Leiden“, während meine Dharma-Brüder und -Schwestern misstrauisch meine Yoga-Praxis beäugten und alle Yogis und Yoginis als „Ekstase-Süchtige“ und „Rauschköpfe“ bezeichneten oder mit anderen abschätzigen Begriffen belegten.
Ich konnte sehen, wieso jede Gruppe die andere so beurteilte, wie sie es tat, aber das war nicht die ganze Wahrheit. In meinem Innern verstand ich, dass beide Traditionen einander nicht nur ergänzten, sondern dass sie sich auf einer grundlegenden Ebene gar nicht so sehr voneinander unterschieden.
Dreizehn Jahre lang war ich einfach nur ein Dilettant. Aber dann, nach all dem Schmerz und Leiden, als schon wieder eine Beziehung an ihr schreckliches Ende gekommen war, ließ ich mich erneut und tiefer auf die Praxis und das Studium des Yoga und Dharma ein. Nach weiteren sechs Jahren machte ich meinen Abschluss als Yoga-Lehrer und -therapeut, und im selben Jahr nahm ich bei dem vietnamesischen Zen-Meister Thich Nhat Hanh formal Zuflucht zu den fünf Gelübden.
Um 1995 hatte ich andere buddhistische Praktizierende kennen gelernt, die „Yoga machten“, und zugleich blickten damals viele in der Yoga-Welt auf den Buddhismus, dessen Meditationslehren und -praktiken sie interessierten. Mir schien es jedoch, als würde etwas mit dem Bild, das die meisten von der Praxis hatten, nicht stimmen. Anstatt zu erkennen, dass beide Traditionen in eine umfassende Praxis integriert werden können, wurden Yoga und Buddhadharma von vielen als getrennte Bereiche betrachtet. Sie meinten, Yoga sei nichts weiter als eine Vorbereitung auf die „wirkliche Arbeit“ der Meditation, oder aber, dass es in der Meditation nur um den Geist gehe und sie keinerlei Bedeutung dafür habe, wie wir im Yoga mit dem Körper arbeiten.
Das Problem lag natürlich in dem weit verbreiteten Missverständnis darüber, was Yoga eigentlich ist. Im Westen verbinden wir Yoga mit der Praxis der Haltungen (Asanas), die in den Yoga-Klassen gelehrt werden. Haltungen sind jedoch nur ein Teil der Yoga-Tradition – und ironischerweise nur ein sehr kleiner! Selbst Gemeinschaften, von denen man annehmen könnte, dass sie es besser wüssten, tragen zur Verbreitung dieses Missverständnisses bei. Kürzlich erhielt ich das Programm eines großen und bekannten Yogazentrums. Unter den Angeboten fand ich Kurse, die „Yoga und Zen“ und „Yoga und Meditation“ hießen. Zwar mag es noch angehen, einen Kurs „Yoga und Zen“ zu nennen, da es sich dabei um zwei unterschiedliche kulturelle Traditionen handelt (obwohl Zazen nach meinem Verständnis eine Form des buddhistischen Yoga ist), doch wenn man einen Unterschied zwischen Yoga und Meditation macht, wird verkannt, was Yoga in Wirklichkeit ist. In den Kursangaben wurde Yoga schlicht und einfach als Asana-Praxis beschrieben, die „den Körper öffnet und stärkt“, während die meditative Aufmerksamkeit „Ihre Yoga-Praxis verbessern kann“. Nach meiner Ansicht, die auf meinen direkten Erfahrungen und Studien beruht, wird ohne meditative Achtsamkeit vielleicht der Körper trainiert, aber es handelt sich dabei nicht um die wirkliche Praxis des Yoga. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass wir in Wirklichkeit, dass wir letztendlich niemals „Yoga machen“, sondern dass wir Yoga sind oder in Yoga sind – oder eben nicht.
Aus diesem Grund gebe ich im ersten Kapitel, „Buddhas Yoga“, einen kurzen Abriss über den historischen Kontext, in dem Yoga und Buddhadharma sich entwickelt haben. An dieser Stelle möchte ich aber schon zwei zentrale Punkte erwähnen. Erstens meine Auffassung, derzufolge buddhistische Praxis selbst eine Form oder kulturelle Tradition des Yoga ist. Zweitens meine Darstellung eines buddhistisch-meditativen Ansatzes für die Praxis der Yoga-Asanas.
Lassen Sie uns zu Beginn einen Blick auf das Wort „Yoga“ werfen. Wie so viele Begriffe aus dem Sanskrit ist es reich an Bedeutungen und Assoziationen. Seine Wurzel ist yuj, was „aufzäumen“ oder „ins Joch einspannen“ bedeutet. Tatsächlich geht das deutsche Wort „Joch“ auf das Sanskrit zurück, wobei die mit ihm assoziierte „Verbundenheit“ auch in der Bedeutung des Wortes „Yoga“ existiert. „Yoga“ wurde benutzt, um eine Verbindung oder Einheit zu bezeichnen, und es bedeutet „Summe“ und „Zusammentreffen“ im Sinne eines Zusammenfügens. In einer Bedeutungserweiterung wurde „Yoga“ schließlich zu einem Begriff, der das spirituelle Streben, insbesondere als eine Disziplinierung des Geistes und der Sinne, bezeichnete. Diese spezielle Bedeutung reicht bis in das 2. Jahrtausend v. u. Z. zurück.
Bereits nach dieser etymologischen Betrachtung können wir vorläufig feststellen, dass Yoga ein spirituelles Bemühen bezeichnet, in dem etwas zur Einheit zusammengefügt wird, und es bezeichnet zugleich diesen Zustand der Einheit selbst. Das führt uns zu der offensichtlichen und vielleicht grundlegenderen Frage: Die Einheit von was und mit wem? Was ist es, das vereint werden muss?
Laut einigen der frühesten yogischen Texte sind es das bewusste Subjekt und seine geistigen Objekte, die vereint werden. Dieses (anscheinende) Zusammenführen von Subjekt und Objekt wird in der yogischen Literatur (aber auch in den Schriften des Buddhismus) als Zustand des samadhi bezeichnet, ein Begriff, der im wörtlichen Sinne selbst wiederum „zusammenführen, zusammenlegen“ bedeutet. Wenn wir diese Erklärung tief auf uns wirken lassen, werden wir erkennen, dass es im Yoga oder Samadhi letztlich um die Transzendierung der (wahrgenommenen) Trennung von Subjekt und Objekt geht. Yoga ist beides zugleich: die Technik und der Zustand der Selbst-Transzendierung. Wie diese Transzendierung im Einzelnen gedeutet wird und welche Techniken zu ihrer Verwirklichung eingesetzt werden, hat zu der Vielfalt von Schulen, Übertragungslinien und Formen geführt, die es in der Yoga-Tradition als Ganzes gibt.
Читать дальше