„Die Leitsätze der OECD für multinationale UnternehmenLeitsätze der OECD für multinationale Unternehmen(kurz OECD-Leitsätze) bilden einen internationalen CSR-Verhaltenskodex. Gemeinsam mit den ILO-Kernarbeitsnormen und dem UN Global Compact gehören die OECD-Leitsätze zu den wichtigsten Instrumenten zur Förderung einer weltweiten verantwortungsvollen Unternehmensführung. Die Leitsätze sind nicht bindend, allerdings basieren sie auf völkerrechtlich bindenden Übereinkommen von 1976 und werden regelmäßig aktualisiert. (vgl. BMBU 2014, S. 23). Den OECD-Leitsätzen liegen die UN-Menschenrechtscharta, die ILO Kernarbeitsnormen und die Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung zugrunde. Die Leitsätze beinhalten Handlungsempfehlungen der 34 OECD-Mitgliedsstaaten und acht weiterer Staaten für die dort ansässigen und international tätigen Unternehmen bei Auslandsinvestitionen sowie für die Zusammenarbeit mit ausländischen Zulieferern und Zulieferketten. Inhaltlich formulieren die Leitlinien Erwartungen an den Umweltschutz, die Zusammenarbeit mit Gewerkschaften, an die Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen, an die Einhaltung von Umwelt- und Arbeitsstandards, an die Korruptionsbekämpfung und die Sicherstellung der Verbraucherinteressen. (vgl. BMBU 2014, S. 23; OECD.org.de 2011). In jedem teilnehmenden Land muss eine Nationale Kontaktstelle eingerichtet werden, um die Umsetzung der Leitsätze zu fördern, aber auch Beschwerden (z.B. von Arbeitnehmerverbänden, Umweltorganisationen) über Verstöße von Unternehmen gegen die Leitlinien entgegenzunehmen und zu bearbeiten. (BMUB 2014, S. 23; OECD.org 2011; OECD 2011).
Die Global Reporting Initiative (GRI)Global Reporting Initiative (GRI)wurde im Jahr 1997 von der Coalition of Environmentally Responsible Economies (CERES) und dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) in den USA gegründet (vgl. GRI 2020). Die GRI hat gemeinsam mit Anspruchsgruppen, Zielgruppen und Experten einen umfassenden Berichtsrahmen und Leitfaden für die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Organisationen (Unternehmen, Regierungen, Nichtregierungsorganisationen) erarbeitet, die Prinzipien und Indikatoren für die Messung ökologischer, sozialer und ökonomischer Leistungen und der Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf die Umwelt und Gesellschaft bereitstellen. U.a. enthält der Leitfaden Anforderungen zu Managementansätzen und Indikatoren in verschiedenen organisationalen Handlungsfeldern (vgl. GRI 2020, BMUB 2014, S. 19). Der Leitfaden steht der Öffentlichkeit zur Verfügung und wird kontinuierlich verbessert. Er dient dazu, die Nachhaltigkeitsberichterstattung transparenter und vergleichbarer zu gestalten und gleichzeitig die Qualität der Nachhaltigkeitsberichterstattung zu verbessern. Dazu dient auch die Registrierung der nach den GRI-Leitlinien erstellten Berichte sowie das freiwillige Angebot zur formalen Überprüfung der Nachhaltigkeitsberichte durch externe Begutachtung (Prüfstellen). (vgl. GRI 2020; BMUB 2014, S. 19; Lexikon der Nachhaltigkeit (2015).
Für ein transparentes Nachhaltigkeitsmanagement von Unternehmen wurde der Deutsche Nachhaltigkeitskodex (DNK)Deutsche Nachhaltigkeitskodex (DNK)im Jahr 2011 beschlossen. Entwickelt wurde der Deutsche Nachhaltigkeitskodex vom Rat für Nachhaltige Entwicklung, einem Beratungsgremium der deutschen Bundesregierung,) im Dialog mit Vertretern der Unternehmen, Finanzmärkte und der Zivilgesellschaft. Er dient als Instrument zur Bewertung der Nachhaltigkeitsleistungen von Unternehmen und orientiert sich an der DIN ISO 26000, am Global Compact und an den OECD-Leitsätzen. Der DNK unterstützt Unternehmen bei der Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie und bietet Hilfestellungen für die Nachhaltigkeitsberichterstattung. (vgl. Deutscher Nachhaltigkeitskodex 2020).
Der Deutsche Nachhaltigkeitskodex umfasst zwanzig Kriterien, in denen ökologische, soziale und ökonomische Anforderungen beschrieben werden. Zusätzlich ist er in die vier Hauptthemen Strategie, Prozessmanagement, Umwelt und Gesellschaft gegliedert sowie in elf Unterthemen (z.B. Stakeholderengagement, Regeln und Prozesse, Menschenrechte, Korruption, Inanspruchnahme natürlicher Ressourcen). Um den Deutschen Nachhaltigkeitskodex zu erfüllen müssen Unternehmen eine Erklärung zu den zwanzig DNK-Kriterien sowie zu ergänzenden nichtfinanziellen Leistungsindikatoren erarbeiten. (vgl. Deutscher Nachhaltigkeitskodex 2020). Dabei können die Unternehmen selbst entscheiden, wie detailliert sie den Deutschen Nachhaltigkeitskodex umsetzen möchten und ob sie einen entsprechenden Bericht durch einen unabhängigen Experten überprüfen lassen möchten und dafür eine sog. Entsprechungserklärung erhalten. (vgl. BMUB 2014, S. 26). Die Entwicklung des Nachhaltigkeitsmanagements von Unternehmen kann durch eine kontinuierliche DNK-Berichterstattung dokumentiert und überprüft werden.
Wesentliche Vorteile des Deutschen Nachhaltigkeitskodexbestehen insbesondere in folgenden Aspekten:
| Vorteile des Deutschen Nachhaltigkeitskodex„Er unterstützt den Aufbau einer Nachhaltigkeitsstrategie und bietet einen Einstieg in die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Regelmäßig zu berichten, macht die Entwicklung des Unternehmens im Zeitverlauf sichtbar. Er gibt Orientierung, wie die CSR-Berichtspflicht sowie der Nationale Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte praktisch umgesetzt werden kann. Das Büro Deutscher Nachhaltigkeitskodex prüft die DNK-Erklärungen auf formale Vollständigkeit, Anwender erhalten qualifiziertes Feedback. Die allgemein zugängliche DNK-Datenbank erzeugt Sichtbarkeit. Die veröffentlichten Berichte können miteinander verglichen werden. Der DNK ist kostenlos. Das Büro Deutscher Nachhaltigkeitskodex, die DNK-Schulungspartner und DNK-Mentoren unterstützen bei der Berichterstattung.“ (Quelle: Deutscher Nachhaltigkeitskodex 2020.) |
Abbildung 21:
Vorteile des Deutschen Nachhaltigkeitskodex. Eigene Darstellung.
Alle vorgestellten Initiativen und Kodices ermöglichen Unternehmen und Organisationen, ihre gesellschaftliche Verantwortung und ihr Nachhaltigkeitsmanagement systematisch aufzubauen, umzusetzen und zu überprüfen. Die Angebote zur Nachhaltigkeitsberichterstattung stellen einerseits Hilfestellungen für die Unternehmen bzw. Organisationen bei der Erarbeitung und Dokumentation der wesentlichen Tätigkeitsfelder und Auswirkungen auf Natur, Umwelt und Gesellschaft dar. Andererseits informieren veröffentlichte Nachhaltigkeitsberichte die Anspruchsgruppen der Unternehmen über ihre Ziele, Maßnahmen und Erfolge und ermöglichen so einen akteursübergreifenden Dialog über die Inhalte des Nachhaltigkeitsmanagements in Unternehmen.
Bezug des Nachhaltigkeitsmanagements zur Work-Life-Balance
Die Implementierung eines Nachhaltigkeitsmanagements in Unternehmen leistet auch positive Beiträge zu einer besseren Vereinbarkeit des Arbeitslebens mit dem Privatleben. Vor allem durch die systematische Berücksichtigung sozialer Gerechtigkeit, aber auch im Rahmen von Maßnahmen zur ökologischen Verträglichkeit sowie zur ökonomischen Leistungsfähigkeit und Verantwortung im Unternehmen können vielfältige Ansatzpunkte für die Einführung oder auch Intensivierung von Work-Life-Balance-Maßnahmen im Unternehmen identifiziert und umgesetzt werden. Insofern ist auch das Nachhaltigkeitsmanagement ein wesentlicher positiver Einflussfaktor zur Verbesserung der Work-Life-Balance der Mitarbeitenden.
2.1.3 Veränderungen von Familienstrukturen und Geschlechterrollen
Die FamilienstrukturenFamilienstrukturen und RollenverteilungenRollenverteilungen zwischen Mann und Frau haben sich in den letzten Jahrzehnten aufgrund der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen sowie neuer Arbeits- und Lebensmodelle erheblich gewandelt.
Читать дальше
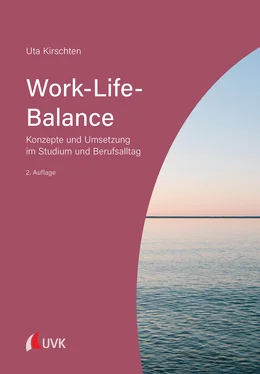
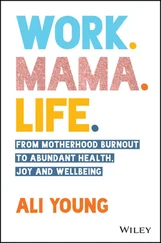
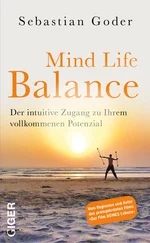

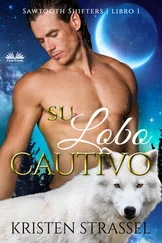
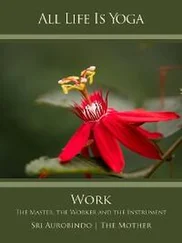
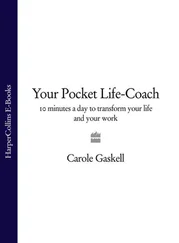
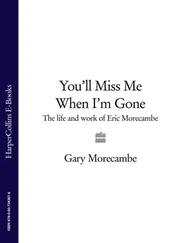
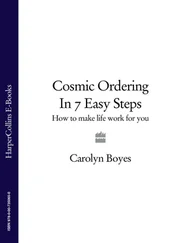

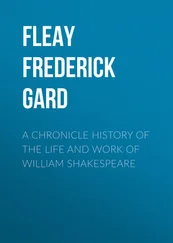
![William Frith - John Leech, His Life and Work, Vol. 2 [of 2]](/books/748201/william-frith-john-leech-his-life-and-work-vol-thumb.webp)
