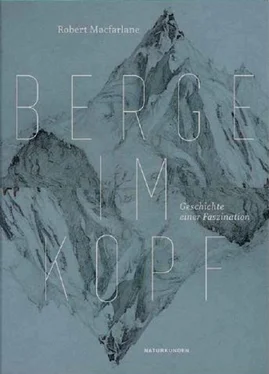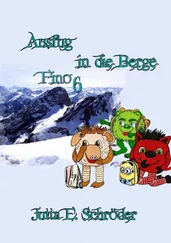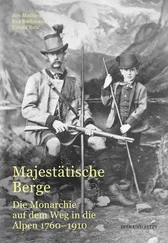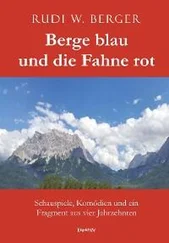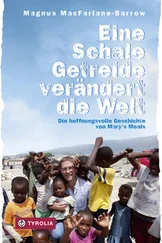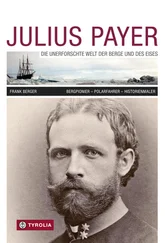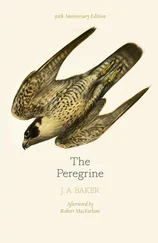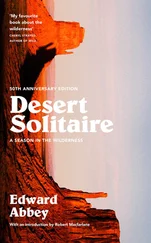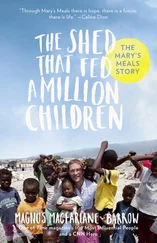Was wir einen Berg nennen, ist also in Wirklichkeit das Zusammenspiel der physischen Erscheinungsformen der Welt und der menschlichen Vorstellungskraft – ein Berg in unserem Kopf. Und wie sich der Mensch gegenüber den Bergen verhält, hat kaum etwas mit den tatsächlichen Objekten aus Fels und Eis zu tun. Berge sind nur geologische Zufallsprodukte. Sie töten nicht absichtlich und wollen auch nicht gefallen. Alle emotional besetzten Eigenschaften, die sie besitzen, werden ihnen von der menschlichen Fantasie zugeschrieben. Wie Wüsten, die arktische Tundra, tiefe Ozeane, Dschungel und all die anderen wilden Landschaften, die wir uns zu Lebewesen romantisiert haben, sind Berge einfach da. Und sie bleiben da, wenn auch ihre physische Form durch die Kräfte der Geologie und der Witterung nach und nach verändert wird, denn sie bestehen jenseits der Wahrnehmung durch den Menschen weiter. Sie sind jedoch auch das Produkt der menschlichen Wahrnehmung; über Jahrhunderte hinweg hat man sich ein Bild von ihnen gemacht. Dieses Buch versucht aufzuzeichnen, wie sich diese Vorstellungen von den Bergen im Lauf der Zeit verändert haben.
Eine Kluft zwischen Vorstellung und Wirklichkeit zeichnet alles menschliche Tun aus, in Bezug auf die Berge ist diese aber besonders stark ausgeprägt. Stein, Fels und Eis fassen sich wesentlich unangenehmer an, als es das geistige Auge erwartet, und die Berge der Welt stellten sich oft als widerspenstiger, auf verhängnisvolle Art realer heraus als die Berge im Kopf. Wie Herzog an der Annapurna und ich am Lagginhorn begriff, sind die Berge, die man bestaunt, über die man liest, von denen man träumt und die man begehrt, nicht diejenigen, die man besteigt. Letztere bedeuten harter, steiler, scharfkantiger Fels und eisiger Schnee, extreme Kälte und eine intensive Ausgesetztheit, die einem den Magen zusammenkrampfen kann und in den Eingeweiden spürbar wird. Sie bedeuten Bluthochdruck, Übelkeit und Erfrierungen – und unbeschreibliche Schönheit.

Es gibt einen Brief von George Mallory, den er während der Erkundungsexpedition zum Everest im Jahr 1921 an seine Frau Ruth schrieb. Die Vorhut der Expedition lagerte mehr als 100 Kilometer vom Berg entfernt, zwischen einem tibetischen Kloster und der Zunge des Gletschers, der vom Fuß des Everest herabzog. Hier brach das Eis, beschrieb Mallory, »wie die riesigen Wellen eines braunen, wütenden Meeres«. Es war ein unwirtlicher Ort, kalt, hoch gelegen und dem Wind ausgesetzt, der sich durch den mitgeführten Schnee und Staub materialisierte und in schmutzigen Wirbeln durch die Felsen fegte. Mallory hatte diesen Tag, den 28. Juni, mit einer ersten Annäherung an den Berg verbracht, an dem er drei Jahre später sterben würde. Es war ein anstrengender Tag für ihn gewesen: Morgens um Viertel nach drei war er aufgestanden und erst nach 8 Uhr abends zurückgekehrt. Nach einem kilometerlangen Marsch über Gletschereis, Moränen und Fels. Zweimal war er in Gletschertümpel gestürzt.
Am Ende dieses Tages lag Mallory erschöpft in seinem beengten, durchhängenden Zelt und schrieb im fleckigen Licht einer Sturmlampe einen Brief nach Hause. Er wusste, dass seine Arbeit am Berg für dieses Jahr wahrscheinlich beendet sein würde, wenn der Brief einen Monat später bei ihr in England eintraf. Den größten Teil nahm der Bericht über die Anstrengungen des vergangenen Tages ein, aber in den letzten Absätzen versuchte Mallory, Ruth zu vermitteln, wie er sich dabei fühlte, an einem solchen Ort zu sein und eine solche Tat in Angriff zu nehmen. »Der Everest hat die steilsten Grate und die furchtbarsten Abgründe, die ich je gesehen habe«, schrieb er. »Liebling – ich kann dir nicht beschreiben, wie sehr er Besitz von mir ergriffen hat.«
Dieses Buch versucht zu erklären, wie das möglich ist: Wie ein Berg so vehement Besitz von einem Menschen ergreifen kann. Wie etwas, das letztendlich nur eine Fels- und Eismasse ist, solch eine außergewöhnliche Anziehungskraft ausüben kann. Aus diesem Grund untersucht es nicht, auf welche Weise die Menschen die Berge bestiegen haben, sondern was sie sich darunter vorgestellt haben, was sie für die Berge empfunden und wie sie die Berge wahrgenommen haben. Daher geht es weniger um Namen, Daten, Gipfel und Höhenangaben, wie in den Standardgeschichten vom Bergsteigen, sondern eher um Eindrücke, Gefühle und Vorstellungen. Es ist eigentlich auch keine Geschichte des Bergsteigens, sondern eine Geschichte der Vorstellungen davon.
»Hohe Berge sind – für mich – eine Empfindung«, erklärt Junker Harold in Lord Byrons Prosagedicht Childe Harold’s Pilgrimage , während er nachdenklich in das ruhige Wasser des Genfer Sees schaut. Die folgenden Kapitel zeichnen in Form einer Genealogie nach, welche emotionalen Beziehungen zu den Bergen aufeinander folgten, wie diese Gefühle jeweils entstanden sind, übernommen wurden, sich veränderten und weitergegeben wurden, bis sie der Einzelne oder ein ganzes Zeitalter annahm. Das Schlusskapitel erörtert, was dazu führte, dass George Mallory so besessen vom Everest war, dass er wegen dieses Berges seine Frau und seine Familie verließ und schließlich von ihm getötet wurde. Mallory ist ein Paradebeispiel für die Themen dieses Buches, da sich in ihm die verschiedenen Empfindungen für die Berge mit ungewohnter und tödlicher Vehemenz vereinigten. Für dieses Kapitel habe ich Mallorys Briefe und Tagebücher um meine eigenen Vermutungen ergänzt, um die drei Everest-Expeditionen der 1920er-Jahre, an denen Mallory teilnahm, spekulativ zu rekonstruieren.
Um einen historischen Abriss der Gefühlsempfindungen zu den Bergen zu entwerfen, müssen wir in der Zeit weit zurückgehen – vor meine ängstliche Querung des steilen Schneehangs in den Alpen, noch vor Herzog, dem auf dem Gipfel der Annapurna die Namen seiner illustren Vorgänger durch den Kopf gehen, noch vor Mallory, der am Fuß des Everest auf seinem Lager einen Brief an Ruth kritzelt, während in der Ecke die Sturmlampe leise surrt. Sogar noch vor jene vier Männer, die im Jahr 1865 von den Felsen des Matterhorns stürzen. Wir müssen zurück in jene Zeit, in der das moderne Repertoire an Empfindungen für die Berge zu entstehen begann. Also zurück in den Sommer 1672. In die für die Jahreszeit ungewöhnliche Kälte auf einem Pass, über den der Philosoph und Geistliche Thomas Burnet seinen jungen aristokratischen Zögling, den Earl of Wiltshire, über die Alpen und hinab in die Lombardei führt. Denn bevor die Berge geliebt werden konnten, musste ihre Entstehung geklärt werden, und dafür stellte sich Burnet als unentbehrlich heraus.

2
DAS GROSSE BUCH AUS STEIN
»Unsere Phantasien können beeindruckt werden, wenn wir die Berge als Monumente der langsamen Arbeit gewaltiger Naturkräfte durch unzählige Jahrhunderte betrachten.«
LESLIE STEPHEN, 1871
August 1672 – Hochsommer auf dem europäischen Kontinent. In Mailand und Genua schwitzten die Bürger unter der starken europäischen Sonne. Fast 2000 Meter höher fröstelt Thomas Burnet am Simplon-Pass, einem der wichtigsten Übergänge der Alpen. Mit ihm friert der junge Graf von Wiltshire, ein Ur-Ur-Enkel von Thomas Boleyn, dem Vater der unglücklichen Anne, der zweiten Frau König Heinrichs VIII., die er hinrichten ließ. Der Junge brauchte eine Ausbildung, hatte seine Familie entschieden, und Burnet, ein anglikanischer Geistlicher mit außergewöhnlich reicher Vorstellungskraft, hat diese Aufgabe übernommen. Sie sollte zu einem zehnjährigen Bildungsurlaub von seinem Lehrstuhl am Christ’s College in Cambridge führen. Er wird zum Beschützer und Reiseleiter einer ganzen Reihe heranwachsender Aristokraten; der junge Graf ist der Erste von ihnen.
Читать дальше