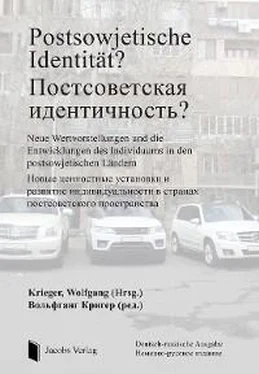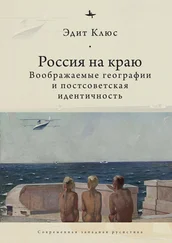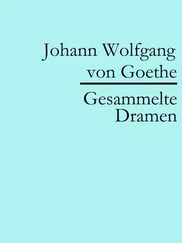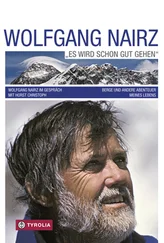Список литературы
Абрамян, Л. А. (2004): О кантовском понятии практического разума. Философские рефлексии (сборник научных статей под редакцией С. Г. Оганесяна), Ереван, сс. 3-15.
Берлин, Исайя (2001): Философия свободы. Европа, Москва: Новое литературное обозрение.
Dijkzeul, Dennis (2008): Towards a Framework for the Study of "No War, No Peace" Societies. Working Papers, No. 2, Swisspeace Publications.
Франгян, Ерванд (1911): Философ пессимизма. Ереван (на арм.).
Fromm, Erich (1941): Escape from Freedom. New York.
Ishkanian, Armine (2015): Self-Determined Citizens? New Forms of Civic Activism and Citizenship in Armenia. Europe-Asia Studies , 67 (8).
Marga, Andrei (1997): Grenzen und Dilemmata der Transformation: In: Nassehi, Armin (Hrsg.): Nation, Ethnie, Minderheit: Beitrage zur Aktualität ethnischer Konflikte; Georg Weber zum 65. Geburtstag. Köln; Weimar; Wien: Böhlau, S. 409-426.
Merton, Robert (1957): Social theory and social structure. New York.
Mkrtichyan, Artur (2005): Human Rights as an “Attractor” of Europeanization Processes of Transcaucasia “Neither War No Peace” Societies. In: Mihr, Anja/Mkrtichyan Artur/Mahler, Claudia/Toivanen, Reetta (eds.): Armenia: A Human Rights Perspective for Peace and Democracy. Potsdam: Universitätsverlag Potsdam, pp. 10-16.
Mkrtichyan, Artur (2007): Armenian Statehood and the Problems of European Integration as Reflected in School Education. In: Darieva, T. / Kaschuba, W. (eds.): Representations on the Margins of Europe. Frankfurt am Main, New York: Campus, pp. 190-204.
Mkrtichyan, Artur (2015): Towards the New Armenian Networks: Theoretical Considerations. In: Mkrtichyan, A. (ed.): Armenians around the World: Migration and Transnationality. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, pp. 11-20.
Mkrtichyan, Artur/Vermishyan, Harutyun/Balasanyan, Sona (2016): Independence Generation: Youth Study 2016 – Armenia. Yerevan: Friedrich Ebert Stiftung.
Погосян, Г. А. (2003): Армянское общество в трансформации. Ереван.
Самохвалова, В. И. (2001): Масскульт и маленький человек. Философские науки, No. 1, сс. 55-66.
Die paradoxe Natur
des postsowjetischen Menschen
als soziologischer Untersuchungsgegenstand
Bakitbek A. Maltabarov
Die Forschung der Soziologie soll zeigen, wie man sich selbst einschätzen sollte – nicht als isolierte Person, sondern als Person im Meer der Menschheit; sie soll uns dabei helfen, uns in der Geschichte und in ihrer Perspektive zu positionieren, um die Faktoren besser verstehen und bewerten zu können, die sowohl unser Verhalten als auch das Verhalten anderer Leute beeinflussen.
C. W. Mills (1916 – 1962) – Amerikanischer Soziologe
Der Begriff des „Menschen“ wird in der Soziologie als eine Einheit von Biologischem und Sozialem verstanden. Er wird deshalb in vielen Theorien und Teildisziplinen der Sozialwissenschaft verwendet, wie etwa in der Soziologie der Persönlichkeit. Der Begriff „Individuum“ wird eher in der Psychologie verwendet, obwohl auch die Soziologie nicht selten darauf zurückgreift, insbesondere wenn Identitäts- oder Interaktionsprobleme in kleinen Gruppen analysiert werden [10, 201].
Die heutige Soziologie arbeitet mit den Begriffen „Mensch“, „Individuum“, „Persönlichkeit“, „Gesellschaft“ und dem Grundgehalt nach ähnlichen, aber unterschiedlich interpretierten Begriffen, die oft als Synonyme betrachtet werden: „Bildung“, „Entwicklung“, „Erziehung“, „Sozialisation“. Wird die Person jedoch nur aus sozialer Sicht betrachtet, ist der Begriff „Persönlichkeit“ am gebräuchlichsten. In den Fällen also, in denen die Person als Subjekt sozialer Beziehungen betrachtet wird, beschäftigt sich mit der Person diejenige Teildisziplin der Soziologie, die als Soziologie der Persönlichkeit bezeichnet wird [9, 321].
Der gegenwärtige Zustand des kollektiven Bewusstseins sowohl in der GUS als auch in Kirgisistan selbst ist dadurch gekennzeichnet, dass dieses nicht nur gespalten, fragmentiert und widersprüchlich, sondern oft auch paradox ist. Im kollektiven Bewusstsein koexistieren weiterhin miteinander unvereinbare Einstellungen und reifen weiter heran. Diese stehen einander konfrontativ gegenüber und beanspruchen oftmals für sich, die einzige sich bietende Rettungsmöglichkeit zur Über-windung der Krise zu sein, in der sich sowohl Kirgisistan als auch die GUS befinden. Sinn einer soziologischen Analyse kann es nicht sein, sich auf diese Debatte einzulassen, sondern Klarheit darüber zu erlangen, dass diese Debatte perspektivlos ist, bis nicht eine Antwort auf eines der grundlegenden Probleme unserer Zeit gefunden ist: Die Frage, warum nämlich nicht nur die Gesellschaft, nicht nur viele soziale Gruppen und Schichten, sondern auch der Mensch selbst als Persönlichkeit bewusstseinsmäßig gespalten ist, stellt ein einzigartig widersprüchliches Phänomen dar, das in vielerlei Hinsicht das gegenwärtige Erscheinungsbild des Landes verkörpert.
Das Paradoxe an der Situation liegt darin, dass dieser Widerspruch gerade in einer Person, in einem bestimmten Individuum konzentriert ist, wenn dieses gleichzeitig sich gegenseitig ausschließenden Überzeugungen vertraut und an deren Wert für sein eigenes und für das gesellschaftliche Leben glaubt. Ein solcher Ansatz ermöglicht es, das Bewusstsein und das Verhalten eines Individuums zu charakterisieren, das sich in der Konfrontation, ja im Kampf mit sich selbst befindet und dies auf die öffentliche Bühne überträgt.
Der Zerfall der UdSSR führte zum Zusammenbruch einer etablierten Lebensweise und zum Überdenken der Einstellungen und Werte von Hunderten von Millionen Menschen. Verschwunden ist nicht nur das riesige Land, das ein Sechstel des Erdoberfläche einnahm, sondern auch die Grundlage der Weltanschauung, auf die sich die Menschen in ihrer Interaktion mit der Gesellschaft, mit staatlichen und industriellen Organisationen, mit ihren Kollegen, Freunden, Nachbarn am jeweiligen Wohnort, kurz mit ihrem gesamten Umfeld verlassen haben. Die Erkenntnis, dass es notwendig war, den Zustand der sowjetischen Gesellschaft zu verändern, war nicht nur für die Perestroika charakteristisch, sondern auch schon davor. Denn gerade die Erwartung von Veränderungen, das Streben nach diesen, waren es doch, welche die gesellschaftlichen Bewegungen hervorriefen, die sich in der zweiten Hälfte der 80er Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts deutlich zeigten.
All dies führte zu einem Bewusstseinswandel bei den Menschen, zu einer offensichtlichen oder auch versteckten Abkehr von vielen Werten und Einstellungen, mit denen die Menschen zuvor ihr ganzes Leben lang gelebt hatten. Aber ihre Weltanschauung als Kern ihres Bewusstseins blieb eher konservativ: Sie sammelte und vereinte weiterhin zugleich ein Bekenntnis zur Vergangenheit wie auch eine Zustimmung zur Gegenwart und wiederum Kritik an ihr sowie Verunsicherung hinsichtlich der Zukunft beziehungsweise an den Möglichkeiten zur Verwirklichung von Zielen, Absichten und Interessen.
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist der ethnische, nationale Faktor einer der bestimmenden im modernen Leben der gesamten Menschheit. Der ethnische Faktor manifestiert sich immer stärker in der Aktivierung von Forderungen nach nationalstaatlicher Souveränität, die nach Ansicht vieler nationaler Führungspersönlich-keiten die Bestrebungen und Erwartungen vieler Nationen und Völker widerspiegeln. Auf den ersten Blick klingt das recht plausibel. Seit mehr als 30 Jahren kommt es in Nordirland zu Auseinandersetzungen auf ethno-konfessioneller Basis und Großbritannien ist es bis zum heutigen Tag nicht gelungen, eine zufriedenstellende Lösung für diese Konflikte zu finden. Gleichzeitig erhielt Schottland in diesem Land durch die Bemühungen der nationalistischen Kräfte sein Parlament und das gleiche Problem ist in Wales noch immer aktuell. In Spanien behaupten sich seit Jahren nationale Minderheiten – Basken und ein Teil der Katalanen. Erstere fordern die Schaffung eines unabhängigen Staates auf Teilen des spanischen und französischen Hoheitsgebiets, letztere eine größere Unabhängigkeit von der Zentral-regierung. Unruhig ist es auch in Rumänien und in Transsilvanien, wo Autonomie weniger von Ungarn gefordert wird (deren Anzahl auf diesem Gebiet recht hoch ist), sondern von den dort lebenden Rumänen, die glauben, dass ihre Zugehörigkeit zum Habsburger-Reich bis zum Jahr 1918 sie grundlegend von der Bevölkerung Moldawiens und der Walachei unterscheide. In Sri Lanka, wo Tamilen um die Unabhängigkeit gegen die sri-lankische Regierung kämpfen, dauert der blutige Konflikt bereits seit einem Vierteljahrhundert an. Wie eine offene Wunde ist für die Kurden ihr Kampf für die Unabhängigkeit (das 37 Millionen Menschen umfassende Volk verteilt sich auf mehrere Staaten – Türkei, Iran, Syrien, Irak). Der Konflikt zwischen den beiden Atommächten Indien und Pakistan hat die Aufmerksamkeit der gesamten Weltgemeinschaft und sämtlicher Weltmächte erregt.
Читать дальше