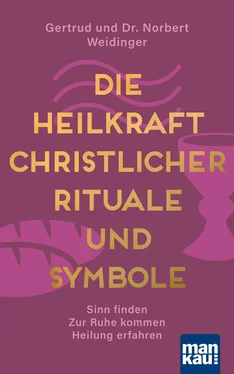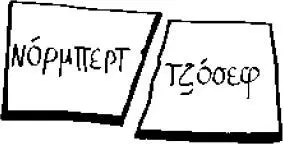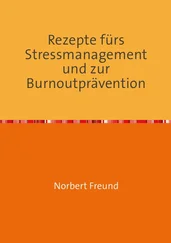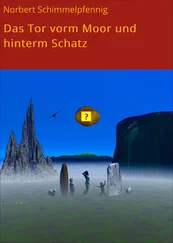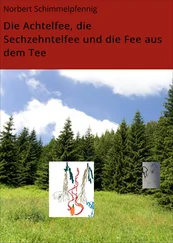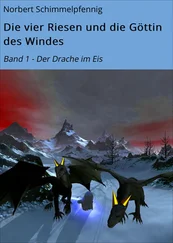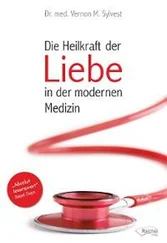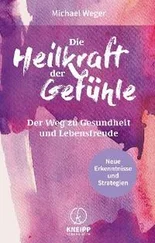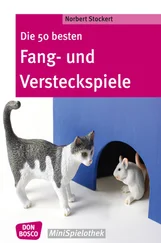Erst am Ende der Grundschulzeit durchschauen Kinder die Mehrschichtigkeit der Symbolsprache und Redewendungen. Dann regen sich Zweifel, werden Rituale und Symbole als erklärungsbedürftige Gebilde erkannt und mithilfe der wachsenden Vernunft erst infrage gestellt, dann allmählich durchschaut. Das ist der kritische Punkt, der zunächst zu Irritationen, dann über Lerneffekte zum mehrschichtigen Symbolverständnis führt. Dieser Entwicklungsprozess braucht die Unterstützung von Menschen, die dem Kind Geschichten, Märchen und Mythen vorlesen, sie nachspielen bzw. mit Imaginationsübungen und Fantasiereisen sein Symbolverständnis anregen und es den Doppelsinn und die Brückenfunktion der Symbole entdecken lassen. In dieser Phase lernen die Kinder allmählich auch, verstandesmäßig den Sinn und die Kraft von Ritualen und Symbolen zu durchschauen. Sie werden zu Entwicklungshelfern für die eigene Person und zu Verbindungselementen zwischen dem Kind und anderen Menschen.
In der Pubertät entscheidet sich, welche Funktion den Ritualen und Symbolen zukünftig beigemessen wird. Nun müssen sie auf ihre Zukunftstauglichkeit untersucht werden. Probehandeln ist angesagt, um die eigene Rolle und Wirkung in Abgrenzung zu den Eltern auszutesten: Was passt zu mir? Was nicht? Altes wird zunächst über Bord geworfen, Neues (etwa Stars und Idole) imitiert – ihre Frisur, Tattoos und Kleidung. Darin steckt aber auch eine ernsthafte Suche nach Werten und Menschen, die diese Werte verkörpern und ihnen einen Weg zeigen können. Dann ist die Frage: Setzt man sich also mit Ritualen und Symbolen auseinander, hinterfragt man sie kritisch oder ist das alles zu anstrengend? Der einfachste Weg ist, den herkömmlichen, beobachteten und gelernten Ritualen blindlings zu folgen, völlig unreflektiert. Ein anderer Weg ist, dies alles, genauso unreflektiert, aus reiner Opposition über Bord zu werfen. Der sinnvollste Weg ist, sich mit ihnen auseinanderzusetzen und sie als Chance zur Persönlichkeitsbildung zu erkennen: Rituale und Symbole bieten Hilfen zur Lebensbewältigung an, zu einem neuen Selbstbewusstsein, sie sind Halt und Geländer in Krisensituationen, sind Verbindung vom Suchenden zum Ratgeber.
Rituale und Symbole erschließen
Gute Erfahrungen haben wir mit einem Modell des Philosophen und Theologen Heinrich Ott gemacht, das wir durchgängig in diesem Buch verwenden. Den Ausgangspunkt bildet die Mehrschichtigkeit von Sprache und Wirklichkeit. Sie spiegelt sich in drei Bedeutungsebenen.
Das Beispiel Brot
• Die alltäglich-reale Bedeutungsebene erschließt sich uns, indem wir Brot mit allen Sinnen betasten, sehen, riechen, schmecken, also wahrnehmen und es entdecken als Grundnahrungsmittel, das uns stärkt und gesund erhält.
• Die übertragene Bedeutungsebene begegnet uns in Sprichwörtern, Märchen, Bildworten (Metaphern). In ihnen verdichtet sich die Erfahrung vieler Menschen über einen langen Zeitraum hinweg. Nehmen Sie als Beispiel »Wess’ Brot ich ess’, dess’ Lied ich sing’.« Es verweist auf die riskante Abhängigkeit des Brot-Nehmers vom Brot-Geber und bietet dazu eine Lösung: Rede/singe ihm nach dem Mund. Alles andere ist gefährlich.
• Die religiöse Bedeutungsebene finden wir in biblischen Erzählungen vom Manna (Brot, das vom Himmel fällt) oder in der Erzählung vom Letzten Abendmahl Jesu (Brotteilen zum Abschied – ein dauerhaftes Erinnerungszeichen). Alle drei Ebenen ergänzen und durchdringen sich gegenseitig und lassen über den Entstehungsund Verwendungszusammenhang den Sinn erkennen. In der Vaterunser-Bitte um das tägliche Brot bilden alle drei Ebenen ein Ganzes. Mit den Worten Jesu dürfen wir von Gott alles Lebensnotwendige erhoffen.
Ein zweites Modell zur Erschließung haben Sie beim Märchen Die drei Sprachen kennengelernt. Es lädt ein, alle äußeren Gegebenheiten und Gestalten des Textes so zu interpretieren, dass sie die eigenen inneren Kräfte, Zustände und schicksalhaften Verknüpfungen (subjektive Variante) oder die der anderen Menschen (objektive Variante) widerspiegeln. Ich kann probehalber mich selbst oder andere Menschen damit identifizieren und so eine heilsame, neue Sicht über mich selbst oder über andere gewinnen.
Der französische Sprachphilosoph Paul Ricœur nennt dieses Vorgehen auch den Weg vom ersten zum zweiten Sinn. Dieser Weg bildet in seiner Theorie zugleich die Brücke von der ersten zur zweiten Naivität. Auch für ihn gilt: Der erste Sinn, vergleichbar der natürlichen Bedeutungsebene, ist durch möglichst eingehende Wahrnehmung sowie mehrfachen Perspektivwechsel freizulegen. Denn der zweite Sinn wohnt dem ersten inne. Das ist der springende Punkt, damit Märchen und Träume ihre heilenden Kräfte im Menschen wecken und den inneren Heiler aktivieren können. Rituale und Symbole können ihre Heilkraft entfalten, wenn sich der Mensch mit ihnen auseinandersetzt und so ihren Sinngehalt, den inneren Bedeutungsgehalt freilegt.
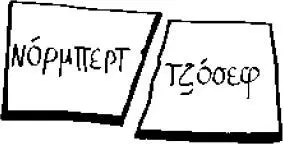
Was ist ein Symbol, ein Ritual?
Das erzählt uns eine alte Sage zur Erklärung des Wortes Sym-bol (griech. sym-balein = zusammenfügen): Zwei Freunde im alten Griechenland nehmen Abschied voneinander. Sie ritzen ihre Namen auf eine Tonscherbe und brechen sie in zwei Stücke. Jeder nimmt eine Hälfte mit; er weiß, dass er den Freund lange nicht sehen wird. Das Brechen von Ton und Namen drückt den Schmerz des Abschieds aus. Das sorgfältige Bewahren bringt Treue zum Ausdruck. Jede Hälfte verweist auf die Freundschaft, die gestern erlebt wurde, und ist zugleich ein Zeichen der Hoffnung auf die Freundschaft, die morgen neu erfahren werden kann. Der zerbrochene Teil der Tonscherbe (des Rings oder der Schale) ist zwar selbst nicht Freundschaft, aber er ist ein sinnliches Erkennungszeichen, das abwesende Freundschaft vergegenwärtigen, in die Gegenwart hineinziehen kann. Nach langer Zeit treffen sich die Freunde wieder: Bei einer Schale Wein setzen sie die Tonstücke zusammen. Ton und Namen ergänzen sich wieder. Sie feiern das Glück der Wiedervereinigung des Getrennten. 7
Das Symbol birgt und entbirgt seinen Sinn in einem Gegenstand (Ring, Tonscherbe, Freundschafts- oder Ehering). Das Ritual übermittelt seinen Sinn in einer Handlung mit dem Symbol (Ring bzw. Tonscherbe wieder zusammenfügen, Ehering anstecken in einer Feier). Deshalb sprechen manche von Gegenstands- und Handlungssymbol (= Ritual). Ein Ritual braucht einen definierten Anfang und Schluss, eine klare Abfolge von Teilelementen und festgelegte Deute-Worte/Formeln, die den Sinn eingrenzen und festlegen. Rituale entfalten ihre Wirkung aus der Spannung zwischen Wiedererkennen und Überraschung. Ohne Überraschungsmomente, ohne Aktualisierung auf unsere Lebenssituation heute werden sie allmählich stumm, verlieren ihre (Heil-)Kraft und erstarren in totem Ritualismus.
Quellen der Heilkraft
Diese Quellen zu erkunden, verlangt nun tatsächlich etwas Zeit zum Nachdenken. Vielleicht bringt uns der Rückblick Lorenz Wachingers unter dem Motto Wie Wunden heilen auf die richtige Spur. Er resümiert: Rituale und Symbole, mit viel Fingerspitzengefühl und großer Erfahrung vom Therapeuten gezielt in den Heilungsprozess eingebracht, wirken wie ein überraschender Energiestoß. Wenn die Therapie positiv verläuft, weckt ein energetischer Impuls den inneren Heiler, setzt die gefesselten Selbstheilungskräfte, die zuvor erblindete Selbsterkenntnis frei, und bringt Erstarrtes wieder in Bewegung. Der Prozess der Verwandlung, der Heilung nimmt seinen Lauf. Und woher kommt sie? Wachinger meint, sie kommt aus der Mitte des an seiner Situation leidenden oder von Begeisterung erfassten Menschen, aus der Leben erhaltenden und fördernden Bündelung all seiner Kräfte, seiner Emotionen, seiner Vernunft und seines Geistes. Sie verbünden sich mit den Kräften des Therapeuten. Aber der Leidende oder Über-Begeisterte selbst gibt also den Ausschlag mit seiner Bereitschaft, sich der Kraft der Rituale, der Heilungsmethoden und Symbole anzuvertrauen. Aus unserer Sicht ist das jedoch noch nicht alles. Wir fragen weiter: Sind bei unseren Brückenbauern, den Ritualen und Symbolen, auch noch spirituelle Kräfte am Werk? Hier kommen Humanwissenschaften und Theologie ins Spiel.
Читать дальше