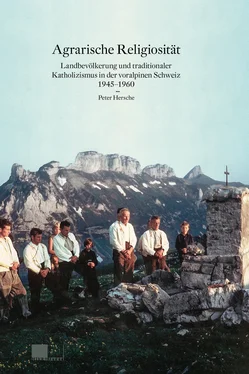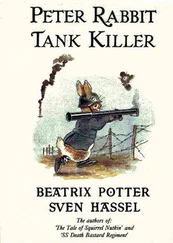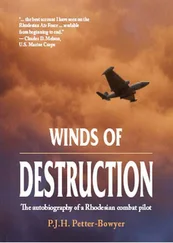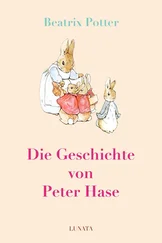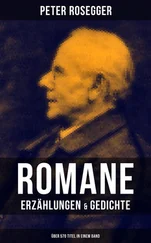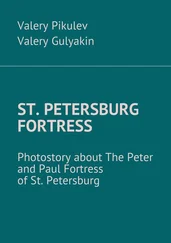Peter Hersche - Agrarische Religiosität
Здесь есть возможность читать онлайн «Peter Hersche - Agrarische Religiosität» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Agrarische Religiosität
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Agrarische Religiosität: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Agrarische Religiosität»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Agrarische Religiosität — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Agrarische Religiosität», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Die Absicht, auch das katholische Schweizer Mittelland zu berücksichtigen, gab ich bald auf. Nicht nur die politische (katholischer Liberalismus), sondern auch die wirtschaftliche Situation (vorwiegend Ackerbau, neben der ausgedehnten Industrie) war ganz anders als in den Voralpen, der Druck zur Modernisierung stärker und die mächtigen protestantischen Städte näher gelegen. Auch war es schwierig, Vermittler zu möglichen Interviewpartnern zu finden. Ergänzend habe ich jedoch anhand der reichhaltigen Materialsammlungen von Josef Zihlmann das luzernische Hinterland, geografisch zwischen dem Mittelland und den Voralpen liegend, mitberücksichtigt. 16Das Alpengebiet könnte man bei oberflächlicher Betrachtung zwar als ausgesprochenes Refugium der Tradition sehen. Das ist es sicherlich auch auf einigen Gebieten, aber gleichzeitig ist es durch Passverkehr und Tourismus äusseren Einflüssen stärker ausgesetzt als das mehr im Windschatten des Verkehrs liegende Voralpengebiet. 17Das schweizerische Alpengebiet ist etwa zur Hälfte protestantisch und fällt damit zu einem grossen Teil zum vorneherein aus. In Graubünden sind nur wenige Talschaften katholisch. 18Als grösstes zusammenhängendes katholisches Gebiet zeichnet sich das Wallis aus. Es ist eine Lieblingslandschaft der Volkskundler, und das Lötschental etwa geniesst eine gewisse Berühmtheit als Forschungsfeld für traditionelle Kulturen. Gerade auch deswegen habe ich das Wallis als mögliches Untersuchungsgebiet weggelassen, allerdings die verhältnismässig reiche volkskundlich-historische Literatur, soweit sie etwas zu meinen Fragestellungen beitragen konnte, berücksichtigt. 19Im Übrigen sei daran erinnert, dass gerade im Oberwallis der Passverkehr (Grimsel, Simplon, Gries) eine grosse Rolle spielt und schon früh auch eine spezifisch auf die Elektrizität aus Wasserkraft basierende Industrie entstand (Lonza, Aluminiumwerke Chippis). Die Landwirtschaft hat ebenfalls einen ganz anderen Charakter als am Nordabhang der Alpen. Schliesslich kommt man im Wallis auch an die Sprachgrenze, die eine direkte Vergleichbarkeit weiter reduziert. Dies war übrigens der Hauptgrund, den ganz klar dem italienischen (genauer lombardischen) Kulturkreis zugehörigen Tessin wegzulassen. Der am Rande erfolgte Einbezug des protestantischen Berner Oberlandes hat mehr persönliche als sachliche Gründe. Es diente mir, wie Ausserrhoden, als Folie, um zusätzlich einen Blick von «auswärts» zu bekommen. 20
Der zeitliche Rahmen der Untersuchung ergab sich eigentlich von selbst. Das Problem war eher, die Interviewpartner darauf festzulegen und ausserdem da und dort eine offensichtlich falsche Chronologie zu korrigieren. Etwas ungenaue Datierungen blieben fast unvermeidlich, wie man auch aus eigener Erfahrung weiss. Das Jahr 1945 als Ausgangspunkt zu nehmen war selbstverständlich, weil der vorangehende Zweite Weltkrieg auch für die Schweiz eine Ausnahmesituation darstellte, die mich bei meinem Interesse für den «gewöhnlichen» Alltag nur gestört hätte. Auch war so die Gefahr gebannt, dass die älteren Männer ihnen liebgewordene Erinnerungen aus ihrem Aktivdienst auftischten. Nur ganz selten liess ich zeitlich vorangehende Entwicklungen, welche langzeitige Folgen hatten, in die Gespräche miteinfliessen. Den Zeitraum von 1955–1960 als Schlusspunkt zu wählen, fiel ebenfalls leicht. Nicht nur meine eigenen Erinnerungen (Jahrgang 1941), deren erste noch in die Kriegszeit hineinreichen, lassen mir die Dekade nach dem Waffenstillstand als eine verhältnismässig ruhige Zeit erscheinen, in der man zunächst noch mit den Folgen der vorangegangenen Auseinandersetzung fertig werden musste, ohne an viel Neues zu denken, das Leben somit ohne grössere Veränderungen wie bis anhin weiterging. Dieselbe Schlussfolgerung kann man chronikalischen Darstellungen, wie sie es für beide Untersuchungsgebiete gibt, entnehmen. 21Erst seit der Mitte der 1950er- Jahre zeigen sich dann die typischen Erscheinungen der Moderne gehäufter auch in den bis dahin relativ zurückgebliebenen Voralpenkantonen. Hier habe ich selber noch lebhafte Erinnerungen etwa an den ersten Einsatz eines Baggers für Aushubarbeiten (bezeichnenderweise für eine Fabrik), an die ersten Waschmaschinen (Marke Hoover) vor einem Elektroladen, an neue Produkte der aufkommenden Lebensmittelindustrie, an den zunehmenden Autoverkehr mit allen seinen Folgen, schliesslich an die ersten, in zwei Wirtshäusern als Sensation und Publikumsmagnet aufgestellten Fernsehgeräte. Speziell für die Religiosität bedeuten der Beginn des Pontifikats von Johannes XXIII. (1958) und das bald von ihm einberufene Zweite Vatikanische Konzil einen Einschnitt, auch wenn sich die Folgen erst in den 1960er-Jahren massiv bemerkbar machten. Allerdings gab es, wenn man genauer hinschaut, bereits zur Zeit Pius XII. unterschwellig einige kirchliche Neuerungen. 22Diese vorläufigen Feststellungen zum zeitlichen Rahmen werden im Folgenden noch an einigen Beispielen zu präzisieren sein.
Anmerkungen
1Z. B. Fuchs; Vogler.
2Dies ist die spezifisch volkskundliche Perspektive. Für meine Fragestellung sei in dieser Hinsicht exemplarisch auf das Werk von Hartinger verwiesen, das die Verschränkung von Religion und Brauch thematisiert.
3Zu diesem Problem noch Bärsch; Forstner.
4Teilweise sind die entsprechenden Erfahrungen der Geistlichen wohl in ihre Predigten, Schriften und Rechenschaftsberichte eingeflossen.
5Zur Theorie und Methode der qualitativen Sozialforschung und der «oral history»: Forstner (für Geistliche); Girtler, Methoden; Göttsch; Lamnek; traverse; Vorländer; Wierling.
6Für Appenzell: Bräuninger; Dörig; Inauen R., Charesalb; Lüthold; Neff A.; Weigum; Wyss, Potztusig; Zilligen. Für Obwalden nur Furrer und Ming H.; allerdings basieren die Werke von Imfeld auch auf einem reichen persönlichen Erinnerungsschatz. Für andere Gebiete (in Auswahl): Britsch (Wallis); Galli (Tessin); Jaggi (Berner Oberland); Witzig (Deutschfreiburg, Wallis, Tessin).
7Appenzeller Volksfreund (zugleich amtliches Publikationsorgan). Systematisch durchgesehen wurden die beiden Eckjahrgänge 1946 und 1960. Die pfarrlichen Ankündigungen umfassen für das erste Jahr nur das Dorf Appenzell und Haslen, sowie teilweise Gonten. Die übrigen Pfarreien informierten damals noch durch Anschlag oder mündliche Mitteilung. Die Obwaldner Presse wurde ausgiebig von Imfeld benutzt, sodass ich hier auf weitere Recherchen verzichten konnte. Die in Frage kommenden diözesanen Amtsblätter sind: Diözesanblatt für das Bistum St. Gallen; Folia officiosa ab ordinariatu episcopali diocesis curiensis edita.
8Vgl. Diözesanblatt 2. Folge, 151–153 (7. 4. 1941), dort auch die Liste der Fragepunkte. Ferner Bischof, 123.
9In den appenzellischen Landpfarreien war dies häufig ein Einheimischer, nämlich Dr. Edmund Locher, bis 1943 Pfarrer in Appenzell, dann Domkustos und Professor in St. Gallen. Vgl. zur Person Stark, 113f.; IGfr 30 (1986/87), 177.
10Die Frageliste publiziert in: SAVk 31 (1931) 101–142. Vgl. dazu auch Inauen R., Hitz, 48. Der Rücklauf der Fragebogen war offenbar enttäuschend gering und generell blieb wenig davon erhalten (so fehlt etwa OW). Zur Erarbeitung des Grundlagenmaterials für den in Aussicht genommenen Atlas der schweizerischen Volkskunde wurde deshalb ein stark reduzierter zweiter Fragebogen (Enquete II) erstellt. Einschränkend ist zu bemerken, dass der Fragenkatalog selbstverständlich die damaligen Forschungsinteressen der Volkskunde widerspiegelt und damit der christlichen Religiosität wenig Platz einräumt. Die spezifisch «Religiöse Volkskunde» steckte damals noch in ihren Anfängen.
11Vgl. etwa Ebel; Deutsch (Zinzendorf); Hartmann.
12Hersche, bes. 446ff., 474ff., 722f., 893f.
13Allg. zu Ausserrhoden Schläpfer, für die Gemeinde Urnäsch Hürlemann.
14Vgl. für das «traditionelle» Uri aber noch das 1946 erschienene Werk von L. von Matt.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Agrarische Religiosität»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Agrarische Religiosität» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Agrarische Religiosität» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.