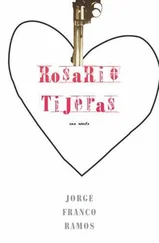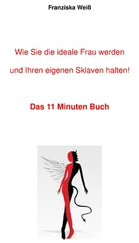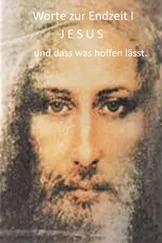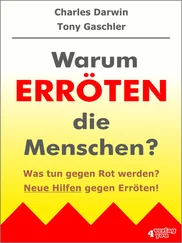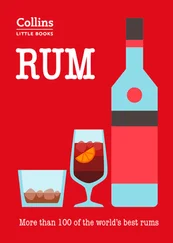2.6.2 In der Bevölkerung kein einheitliches Verständnis von Spiritualität
Viele Autoren bemerken kritisch, dass sich bei Befragungen in der Bevölkerung kein gemeinsames Verständnis von Spiritualität zeige. Daniel E. Hall, Keith G. Meador und Harold G. Koenig unterstreichen, dass eine generische Religiosität bzw. kontext-freie Spiritualität nicht existiere, sie stünden immer in einem Kontext von Kultur, Tradition etc. Es sei deshalb auch unmöglich, Religiosität oder Spiritualität ohne diesen jeweiligen spezifischen Kontext zu erforschen (vgl. Hall et al. 2008, S. 155). Die Autoren schlagen einen Vergleich mit Sprachen und Linguistik vor:
However, the recognition that people are all“spiritual” in their human search for meaning is like recognizing that all languages use similar patterns of grammar and syntax. There is much to learn from the study of linguistics, but the dry text of linguistic theory can never replace the living verse of Shakespeare. Language does not exist“in-general” because it is always encountered in particular forms (ebd.).
Insofern könne Spiritualität eine Art Linguistik für konkrete Formen von Glaube bzw. Praxis sein, aber keine universale Sprache des Glaubens (vgl. ebd., S. 156).
Peter La Cour, Najda H. Ausker und Niels C. Hvidt befragten in Dänemark 514 Erwachsene (Studierende, sowie Teilnehmer versch. Kurse) nach ihrem Verständnis von Spiritualität, indem sie bei 115 von Experten genannten Items ankreuzen sollten, was zu Spiritualität gehöre(vgl. La Cour et al. 2012, S. 66). Eine Faktorenanalyse der Antworten ergab kein gemeinsames Verständnis, sondern sechs Faktoren, die sich nicht aufeinander reduzieren ließen. Daher stellten sich Probleme, den Begriff Spiritualität in der Forschung oder im klinischen Setting zu verwenden, wenn existentielle oder religiöse Fragen angesprochen werden sollen – auf jeden Fall sollten einige erklärende Schlüsselworte angegeben werden (vgl. ebd., S. 77). Als solche schlagen die Autoren für Forschungszwecke folgendes vor: „A coherent use of the term spirituality in future research might therefore comprise spirituality understood as a context-bound experience of relatedness to a vertical transcendent reality .“ (ebd., S. 80) 112
In den Niederlanden erfragten Joantine Berghuijs, Cok Bakker und Jos Pieper in einem repräsentativen Bevölkerungssample ( N = 4402) ohne Vorgaben das persönliche Verständnis von Spiritualität und untersuchten die gegebenen Beschreibungen mit einer Hauptkomponentenanalyse (vgl. Berghuijs et al. 2013, S. 377). Es fand sich eine große Bandbreite, aus der keine einheitliche Definition möglich war. In der Analyse ergaben sich acht Komponenten, 113von denen „Spiritualität als der transzendente Gott“, „Spiritualität als Innerlichkeit“ und „Spiritualität als Streben nach seelischer Gesundheit und Wohlbefinden“ die höchsten Werte aufwiesen (vgl. ebd., S. 386). Dieses weite Spektrum von Antwortmustern zeigt eine Überschneidung des Verständnisses von Spiritualität mit Konzepten aus Psychologie, Religion und Philosophie, die sich mit keiner Definition auflösen ließe (vgl. ebd., S. 392). Außerdem habe sich in der holländischen Bevölkerung das Konzept Spiritualität weithin von Religion getrennt (vgl. Zinnbauer et al. 1997), auch Bezugnahme auf das „Heilige“ ( sacred im Sinne von Hill et al. 2000) sei nicht stark (Berghuijs et al. 2013, S. 392). Auffällig war der Einfluss des Bildungsniveaus: Personen mit niedrigerer Bildung distanzierten sich weit häufiger von Spiritualität bzw. konnten weniger damit anfangen als Personen mit höherer Bildung – so dass der Begriff scheinbar eher Sache einer „Elite“-Welt sei (vgl. ebd., S. 389).
Aus letzterem Grund hält Bernhard Grom den Begriff Spiritualität im deutschsprachigen Raum bei Befragungen oder in der Krankenbegleitung nur bedingt für geeignet: „Denn während Englischsprachige die Begriffe spiritual/spirituality nicht als Fremdwörter oder Fachbegriffe empfinden, dürften Deutschsprachige aus bildungsfernen Schichten die Vokabeln ‚spirituell/Spiritualität‘ kaum verstehen.“ (Grom 2009, S. 14)
Heinz Streib und Barbara Keller (2015) untersuchten die Semantik und Psychologie von „Spiritualität“ in Deutschland, 114u. a. in einer Online-Befragung mit 773 Teilnehmern. 740 von ihnen gaben eine Definition von „Spiritualität“ als freie Eintragung: Eine Hauptkomponentenanalyse der Inhalte erbrachte zehn semantische Komponenten (ebd., S. 40) f.). 115Es sei große Zurückhaltung angebracht, „das, was die Menschen auf der Straße ‚Spiritualität‘ nennen, auf einen Begriff bringen zu wollen.“ (ebd., S. 52)
2.6.3 Kritisches zum Konzept Spiritualität im Gesundheitsbereich
Neil Scheurich, Assistenzprofessor für Psychiatrie, hält in der Medizin die Verwendung philosophischer Werttheorie für umfassender und weniger tendenziös als den Begriff Spiritualität . Nicht jeder Mensch sei spirituell , aber jeder habe ein zugrundeliegendes (oft unbewusstes und unhinterfragtes) Wertesystem , das auch die – für die Medizin oft relevanten – tiefsten Anliegen ( ultimate concerns) der Person beinhalte. Der philosophische Begriff Wert bedeute eine persönliche Bindung an das jeweils Intendierte und sei gegenüber dem unklareren Konzept Sinn (meaning) zu bevorzugen: Werte bezeichneten, was letztlich im Leben zähle (vgl. Scheurich 2003, S. 357) f.). Solch ein philosophisches Wertekonzept und eine entsprechende Anamnese sei sorgsam neutral gegenüber religiösen wie säkularen Weltanschauungen, während Spiritualität unweigerlich einen Einschlag Richtung übernatürlichem Glauben habe. Religiöser Glaube sei weder zu überhöhen noch abzuwerten, sondern schlicht unter den zahllosen persönlichen Werten einer Person einzuordnen (vgl. ebd., S. 356) f.). Eine säkulare Medizinphilosophie bedeute Neutralität, aber nicht Ignoranz gegenüber persönlichen Werten und Weltanschauungen: „It has been argued, convincingly I think, that respecting the full humanity of patients calls for some inquiry into their ultimate concerns, religious or otherwise.“ (ebd., S. 358) 116
Ähnlich plädiert der emeritierte Philosophieprofessor Trevor Hussey (2009, 2011) für eine „naturalistische Sicht“ in der Krankenpflege. Naturalismus verbinde eine metaphysische und eine epistemologische Behauptung: Es existiere nur die natürliche Welt und nichts Über- oder Nicht-Natürliches. Von der natürlichen Welt könnten wir nur durch Wissenschaft und Alltagsverstand Kenntnis erlangen (vgl. Hussey 2009, S. 72). Die Vokabel Spiritualität sei vage und nicht hilfreich und deshalb zu vermeiden: Wenn sie als Abkürzung für alle Erfahrungen, Gedanken und Aktivitäten gebraucht würde, die wertbezogen große persönliche Bedeutung hätten, sei die Gefahr eines – unnötigen – übernatürlichen Anklangs unvermeidlich (vgl. ebd., S. 74), 79). Die Vielfalt religiöser und spiritueller Annahmen (bei Patienten wie Pflegenden) sowie die Intensität, mit der diese häufig vertreten würden, bildeten ein Rezept für Missverständnisse, wenn beide Seiten eine Situation durch das gefärbte Glas ihres eigenen Glaubenssystems betrachten würden (vgl. ebd., S. 78). Glaubensvorstellungen anderer ließen sich jedoch – wie Märchen – verstehen , ohne ihrem Realitätsgehalt zustimmen zu müssen, und man könne sie als Aspekt des Natürlichen einordnen (vgl. Hussey 2011, S. 47), 50). Man müsse aber zu unterscheiden vermögen, wann eine Ansicht ernsten Schaden anrichten könnte (vgl. ebd., S. 50).
Auch der Pflegewissenschaftler John Paley (2008a, 2008b) votiert scharf für eine „atheistische“ bzw. „naturalistische“ Perspektive: Das Konzept Spiritualität sei nicht nur künstlich und unnötig, sondern auch verdunkelnd, es verdecke andere, evtl. effektivere Zugänge zur Unterstützung von belasteten Patienten, und verwirre Patienten wie klinisches Personal (vgl. Paley 2008a, S. 9). Die Literatur zu Spiritualität-in-der-Pflege habe oft einen nicht-naturalistischen Einschlag ( bias), der weithin unhinterfragt bleibe – existentielle Fragen sollten aber in einem ausschließlich naturalistischen und wissenschaftlichen Rahmen erforscht werden (vgl. ebd., S. 14). Religiöser/spiritueller Glaube etwa stelle schlicht einen speziellen Fall von positiver Illusion dar, nachweisbare gesundheitsgünstige Wirkungen ließen sich naturalistisch erklären (vgl. ebd., S. 11). 117Paley meint, dass unter dem Begriff Spiritualität ganz verschiedene Dinge zusammengeworfen würden (vgl. Paley 2008b, S. 177), um äquivalent zur sogenannten Medikalisierung (wenn nicht-medizinische Probleme als medizinische behandelt werden) durch eine „Nursification“ den Pflegenden einen eigenen Einflussbereich zu sichern, indem aus unvermeidlichen Konsequenzen des Patientseins pflegerisch zu versorgende psycho-soziale Bedürfnisse und nun auch spirituelle Bedürfnisse ( spiritual needs) gemacht würden (vgl. ebd., S. 180 f.).
Читать дальше