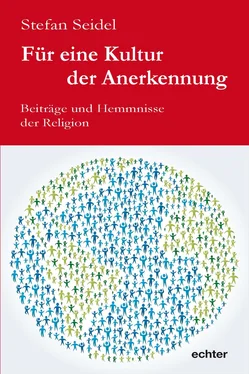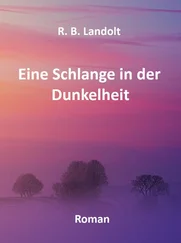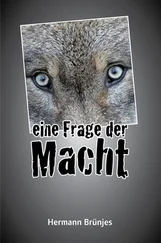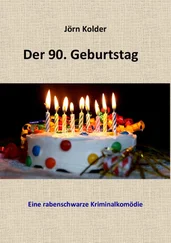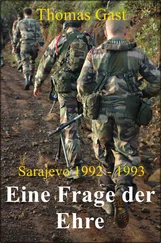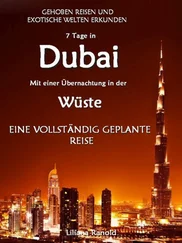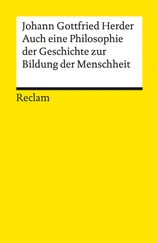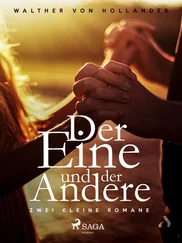STEFAN SEIDEL
Für eine Kultur der Anerkennung
Beiträge und Hemmnisse
der Religion
STEFAN SEIDEL
Für eine Kultur
der Anerkennung
Beiträge und Hemmnisse
der Religion

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über ‹ http://dnb.d-nb.de› abrufbar.
1. Auflage 2018
© 2018 Echter Verlag GmbH, Würzburg
www.echter.de
Umschlag: wunderlichundweigand
Gestaltung: Hain-Team ( www.hain-team.de)
eBook-Herstellung und Auslieferung: Brockhaus Commission, Kornwestheim, www.brocom.de
ISBN
978-3-429-04440-4
978-3-429-04963-8 (PDF)
978-3-429-06383-2 (ePub)
Inhalt
I. „Uns gibt’s auch noch”: Der Kampf um Anerkennung heute
II. Anerkennung aus sozialphilosophischer Sicht
1. Anerkennung als Grundbedürfnis und Ziel sozialer Bestrebungen: Axel Honneth
2. Die fatale Unterscheidung zwischen betrauerbarem und unbetrauerbarem Leben: Judith Butler
3. Die Anerkennung der Würde der Tiere als nächster Schritt: Birgit Mütherich
4. Achsen einer anständigen Gesellschaft – Achtung, Würde und Nichtdemütigung: Avishai Margalit
4.1. Ernstfall der Anerkennung I: Homosexualität und Kirche
5. Das Prinzip der Gleichberechtigung und eine Politik der Anerkennung: Charles Taylor
5.1. Ernstfall der Anerkennung II: Umgang mit dem Islam
6. „Es gibt kein Glück außerhalb der Liebe“: Tzvetan Todorov
III. Anerkennung aus psychoanalytischer Sicht
1. Anerkennung als psychische Geburt: Donald W. Winnicott
2. Vom Glanz in den Augen der Mutter – die psychische Notwendigkeit der Anerkennung: Martin Dornes
3. Perversion als Folge gescheiterter Anerkennung: Jessica Benjamin
4. Das Eigene im Anderen und das Andere im Eigenen: Joachim Küchenhoff
5. Lob der Differenz – Grenzen als Schutz und Begegnungsorte: Martin Teising und Bernhard Waldenfels
6. Sein oder Idealsein – Zur Anerkennung eigener Begrenztheit: Janine Chasseguet-Smirgel
7. Die Anerkennung einer „letzten Realität“ als Zähmung der Angst: Wilfred R. Bion
8. Mutter Staat? Zur Anwendung des Konzepts der Fürsorglichkeit (concern) auf soziale Zusammenhänge: Reinhold Bianchi
IV. Anerkennung aus theologischer Sicht
1. Anerkennung als Ort religiöser Erfahrung: Tobias Braune-Krickau
2. Die Religion als Anerkennungsverhältnis und Sinnressource der Gesellschaft: Markus Knapp
3. „Von der Vollendung her leben“ – Die unbedingte und unauflösliche Anerkennung des Gläubigen durch Gott: Andreas Rohde
V. Die Beiträge und Hemmnisse der Religion für eine Kultur der Anerkennung
1. Erfüllt leben und Leben teilen – Die Beiträge der Religion für eine Kultur der Anerkennung: Elisabeth Moltmann-Wendel und Theo Sundermeier
2. „Apokalypse now“ – Die Hemmnisse der Religion für eine Kultur der Anerkennung: Friedrich-Wilhelm Graf und Reiner Anselm
VI. Der Mensch braucht mehr als nur sich selbst – Schlussüberlegungen
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
I. „Uns gibt’s auch noch“:Der Kampf um Anerkennung heute
Wir leben in einer Zeit immer härter werdender Kämpfe um Anerkennung. Insbesondere die große Migration stellt die westlichen Gesellschaften vor neue Herausforderungen, die im Kern die Frage nach Anerkennung und Abgrenzung betreffen. Die Entwicklungen der letzten Jahre haben dabei gezeigt, dass die Umsetzung der Idealvorstellung einer Kultur der Anerkennung alles andere als einfach ist. Herbe Widerstände formieren sich gegen die Anerkennung anderer als Gleichberechtigte. Verzweifelt begibt man sich dabei gleichzeitig auf die Suche nach dem Eigenen – jedoch meistens nur auf dem Weg der scharfen Ablehnung anderer. Die Angst vor dem Islam erscheint dabei als die am meisten verdichtete Form dieses Ringens um das Eigene in Abgrenzung von Fremdem.
Es zeigt sich, dass jene, die am lautesten die Abweisung des Fremden fordern, selbst dringend der eigenen Anerkennung bedürfen. Der Historiker Timothy Garton Ash bemerkte kürzlich, dass das Aufkommen des Rechtspopulismus nicht nur aus der sozialen Frage wirtschaftlicher Benachteiligungen heraus zu erklären sei. Sondern dass er auch als eine Antwort der „Abgehängten“ gedeutet werden müsse: eine Antwort auf die erlittene „Ungleichheit der Aufmerksamkeit“, die übergeht in eine „Ungleichheit an Respekt“: „Bei allen Unterschieden findet man in den populistisch wählenden Regionen ein gemeinsames Ressentiment: ‚Uns gibt’s auch – ihr habt uns aber ignoriert und als Landesteile zweiter Klasse behandelt.“ So sei ein Grund für den Erfolg der rechtskonservativen „PiS“-Partei in Polen deren Versprechen, „das Ansehen“ umzuverteilen. Im Grunde sei das, so Ash, die Kapitulation des Liberalismus, der sein zentrales Versprechen nicht eingelöst habe: nämlich gleichen Respekt und gleiche Sorge für jedes einzelne Mitglied der Gesellschaft zu gewähren (Ronald Dworkin). 1
Um diesen Kampf um Aufmerksamkeit und Respekt zu führen, bedienen sich die Wortführer des rechtspopulistischen Protests kultureller Codes, die sie als Kampfbegriffe zur Verteidigung des Eigenen benutzen. Und plötzlich werden auch wieder religiöse Kategorien wie das „christliche Abendland“ oder die Zurückweisung der Religion des Islam virulent. Damit, so könnte man meinen, trifft die düstere Prophezeiung des amerikanischen Politikwissenschaftlers Samuel P. Huntington ein, der bereits vor über 20 Jahren einen „Zusammenprall der Kulturen“ heraufziehen sah – ein Zeitalter religiös bemäntelter Konflikte um Vorherrschaft. Die Religion bekomme dabei die Funktion eines Artikulators jener Kämpfe um Anerkennung und Teilhabe, um die es eigentlich geht. 2
Und tatsächlich hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass die Rede von der Bedrohung des christlichen Abendlandes durch einen angeblich aggressiven Islam ein beträchtliches Protest- und Wählerpotential mobilisieren kann – selbst in einem so gründlich säkularisierten Landstrich wie Ostdeutschland. In dieser Region ist übrigens das von Ash diagnostizierte giftige Gefühl des „Abgehängtseins“ am deutlichsten zu beobachten. Viele Ostdeutsche fühlen sich in ihren Biografien nicht gewürdigt und durch aufreibende Kämpfe um Arbeit und Teilhabe in der neuen Gesellschaft der Bundesrepublik entwertet. Anerkennung und Respekt sind ihnen zur Mangelware geworden. „Die Älteren haben schon vieles verloren und ringen jetzt um ihre Würde, verbunden mit der Angst, das mühsam Gerettete und neu Erworbene auch noch zu verlieren“, diagnostiziert der Hallenser Psychotherapeut Hans-Joachim Maaz. 3Insofern ist durchaus eine Situation eingetreten, in der Anerkennungsverhältnisse nicht mehr ohne weiteres gewährleistet sind, sondern vielmehr als fragil, bedroht und umkämpft erlebt werden.
Dabei erscheint die rechtspopulistische Inszenierung eines Kulturkampfes als ein höchst wirksames Instrument, um die von vielen erlebte prekäre Anerkennungslage in politisches Kapital umzuwandeln. Im letzten Jahr wurde hierzulande die meiste Stimmung erzeugt und wurden die meisten Stimmen gefangen mit der Rede von einer Bedrohung durch den Islam. Die eingeredete Gefahr durch die Burka verfing bei vielen Wählern–gleichgültig ob damit irgendein Realitätsgehalt verbunden war. Auf die von Rechtspopulisten angebotene Deutung der gesellschaftlichen Krise als Kulturkampf ließen sich viele Menschen ein – als sei endlich ein Ventil für den aufgestauten Druck gefunden. Dabei ist allzu offensichtlich, dass es nicht eigentlich um eine reale Bedrohung durch eine andere Kultur oder Religion geht. Der Ausländeranteil in Sachsen, dem Bundesland mit dem größten rechtspopulistischen Wahlerfolg, liegt unter vier Prozent. Doch die plötzliche Gegenüberstellung verfeindeter Kollektive – hier die Deutschen und dort die lauernden Muslime – scheint eine derartige Entlastung und Aufwertung zu bringen, dass sie von vielen übernommen wurde. Den Rechtspopulisten sei es gelungen, schrieb der Berliner Soziologe Sérgio Costa vor Kurzem, Menschen, die sich existenziell und politisch bedeutungslos wahrscheinlich auch deutungslos – fühlen, einen Diskurs anzubieten, der sie in der symbolischen Machthierarchie aufsteigen lasse. Und zwar ohne dass sie dafür Großes leisten müssten. Allein die deutsche Abstammung reiche nun aus, um höher- und bessergestellt zu sein gegenüber einem konstruierten Anderen. Costa vermutet, dass es beim Migrantenhass eigentlich um das Gefühl eigener
Читать дальше