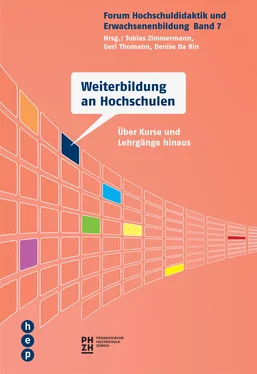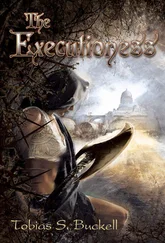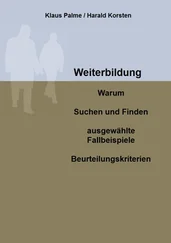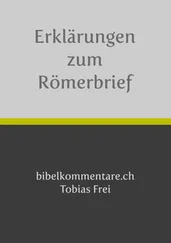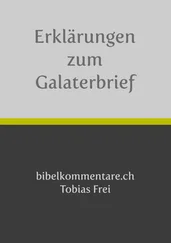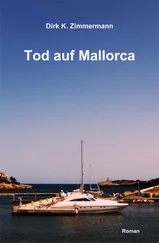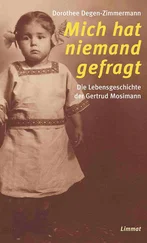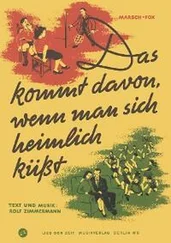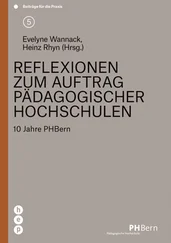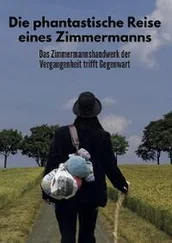In den nächsten Jahren stehen der Weiterbildung weitere entscheidende Entwicklungen bevor. Einige davon werden hier kurz skizziert:
Bei Diskussionen um aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen – beispielsweise die demografische Alterung, Migration, Armut oder Fachkräftemangel – dürften die Akteure der Weiterbildung künftig stärker einbezogen werden. Die Einführung des WeBiG trägt dazu bei, dass diese meist unter volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten geführten Diskussionen künftig vermehrt auch als bildungspolitische Themen wahrgenommen werden. Dabei geht es beispielsweise um die Frage, was Erwachsenenbildung beitragen kann, um den Mangel an Fachkräften zu beheben. Der Weiterbildungsbereich wird sich künftig vermehrt mit Fragen des beruflichen Wiedereinstiegs, der Integration, der Umschulung oder der Nachholbildung für alle Altersklassen beschäftigen.
Die WeBiG-Grundsätze werden sich als selbstverständliche Orientierungspunkte in der Planung der Weiterbildung etablieren – unabhängig davon, ob ein Anbieter öffentliche Gelder bezieht oder nicht. Leitend dürften dabei die Themen Qualität, Markttransparenz, Chancengleichheit und Anrechnung von informell erworbenen Kompetenzen sein.
In verschiedenen Berufen wird das Thema Weiterbildungspflicht zur Diskussion stehen. Diese Entwicklung beobachten wir speziell in akademischen Berufen, so beim medizinischen Personal, insbesondere bei den Ärzten, aber auch bei Psychologen, Lehrerinnen und Lehrern oder bei Führungspersonen in der Verwaltung. Ihnen werden zunehmend obligatorische Weiterbildungen verordnet.
Das nach wie vor ungelöste Problem der Intransparenz im dynamischen Weiterbildungssystem dürfte in den nächsten Jahren besonders virulent werden. Wenn das System in Fragen der Qualität, bei der Anrechnung von Bildungsleistungen oder bei der Anerkennung non-formaler Abschlüsse weiterkommen will, müssen Angebote und Abschlüsse transparenter gestaltet und besser aufeinander abgestimmt werden. In diesem Zusammenhang gewinnen die Themen Kompetenzorientierung und Modularisierung sowie der Aufbau modularer »Baukästen« an Bedeutung (siehe die Beiträge von Kraus & Schmid, Buff Keller & Zimmermannsowie das Praxisbeispiel von Förster und Grau in diesem Band).
Die öffentliche Finanzierung bleibt ein wichtiges Thema, obwohl das System auch weiterhin größtenteils privat finanziert sein wird. Während viele Erwachsene von ihren Arbeitgebern bei der Weiterbildung unterstützt werden, müssen andere tief in die eigene Tasche greifen, um die – speziell bei der Hochschulweiterbildung – enormen Kosten von oft mehreren Zehntausend Franken aufzubringen. Zur Unterstützung von Personen, die diese Kosten nicht selbst tragen können, sollten Möglichkeiten, wie beispielsweise Fonds oder Darlehenssysteme, geschaffen werden. Gemäß der aktuellen Regelung können Weiterbildungskosten von jährlich bis zu 12 000 Franken von den Steuern abgezogen werden. Eine solche Maßnahme reicht aber nicht aus, um die Finanzierung zu gewährleisten, insbesondere nicht bei Personen mit einem Teilzeitpensum. An der Reflexion dieser Problematik sollten sich auch die Hochschulen beteiligen.
Das Parlament hat bezüglich Finanzierung noch weitere Entscheide gefällt. So gelten die zwar freiwilligen, faktisch aber meist unverzichtbaren Vorbereitungskurse zu den formalen eidgenössischen Prüfungen als non-formale Weiterbildung. Diese Kurse sind ein wesentlicher Bestandteil der höheren Berufsbildung, werden aber nicht vom Bund geregelt und gehören bildungssystematisch gemäß WeBiG deshalb zur Weiterbildung. Ab 2018 werden diese Kurse mit bis zu 50 Prozent der Kosten staatlich finanziert. Dafür hat das Parlament innerhalb der aktuellen Botschaft für Bildung, Forschung und Innovation (Schweizerischer Bundesrat 2016) über 200 Millionen Franken bewilligt. Entsprechend dem WeBiG gilt für die Weiterbildung generell, also auch für die Vorbereitungskurse, der Grundsatz der nachfrageorientierten Finanzierung. Einen solchen Eingriff in das schweizerische Weiterbildungssystem hat es bisher nicht gegeben. Die Auswirkungen auf die Teilnehmenden sowie auf die Anbieter und die Organisationen der Weiterbildung sollten genau beobachtet und wissenschaftlich untersucht werden.
Ausblick und Desiderate
Was können Hochschulen und nicht-universitäre Weiterbildungslandschaft voneinander lernen?
Mit dem WeBiG liegen die gesetzlichen Rahmenbedingungen vor, um die Weiterbildungsforschung künftig stärker zu fördern. Das Weiterbildungssystem ist für eine Entwicklung und Professionalisierung auf Forschung und auf theoretische Reflexion angewiesen.
Die Erwachsenenbildung hat aber auch den Hochschulen etwas zu bieten. Diese Diskussion wurde in der Schweiz bisher nicht geführt. Reflexionen zum Verhältnis zwischen Universitäten und der Erwachsenenbildung in anderen Ländern zeigen, welche Impulse die Erwachsenenbildung den Hochschulen geben kann, wenn beide Akteure zu einem Dialog über das Verhältnis von Wissenschaft und Praxis bereit sind (vgl. Egger 2016). Wie Egger festhält, haben sich die Hochschulen bisher noch gar nicht mit der Frage befasst, inwiefern wissenschaftliche Weiterbildung spezifische, die hochschuldidaktische Qualifikation ergänzende Kompetenzen erfordert, um erwachsenengerechte und lebensbegleitende Weiterbildung anzubieten. Wie der Autor weiter anmerkt, gehen Hochschullehrerinnen und -lehrer in der Regel davon aus, dass sie die spezifischen Kompetenzen für die Erwachsenenbildung bereits besitzen, obwohl ihnen oft weiterbildungsrelevante Kompetenzen fehlen. Egger nennt hier insbesondere die »weiterbildungsaktiven Momente, die oft jenseits von Standardsituationen liegen, wie Wissen an lebens- und berufsspezifische Kontexte anschlussfähig gemacht wird, welche Widersprüchlichkeiten biografisch bedeutsames Lernen durchziehen oder welch große Rolle die Lernatmosphäre spielt – alles Elemente, die in der Erwachsenenbildung wesentlich sind« (Egger 2016, S. 05-4).
Aufgrund dieser Reflexion zieht Egger den Schluss, dass die Organisation berufsbegleitender Studiengänge an Hochschulen eine »prinzipiell andere methodische Planung und ein teilnehmerInnenorientiertes Lernverständnis [erfordert], das der grundständigen Lehre auch nicht abträglich wäre, in der Weiterbildung aber unbedingt gefordert ist. Eine schlichte Ausdehnung universitärer ›Beschulung‹ ohne eine gleichzeitige Veränderung der Rahmenbedingungen und der Qualität der Lehr- und Lernprozesse kann den Prinzipien lebensbegleitender Weiterbildungsprozesse nicht entsprechen« (Egger 2016).
Die Hochschulen könnten bei ihren Weiterbildungsangeboten (aber auch im grundständigen Studium, vgl. das Interview mit Arnold und Hanft in diesem Band sowie Zimmermann & Zellweger 2012) also durchaus von methodisch-didaktischen Ansätzen und Erfahrungen der Erwachsenenbildung profitieren, insbesondere von der im Weiterbildungsbereich wichtigen Teilnehmerorientierung.
Ein weiterer Ansatz für die stärkere Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und nicht-universitärem Weiterbildungsbereich wären Verbundprojekte. Mit gemeinsamen Programmen für unterschiedliche Zielgruppen könnte das lebensbegleitende Lernen dynamischer und erwachsenengerechter gestaltet werden, zum Beispiel auf Gebieten wie der Klimaforschung.
Der Nutzen einer verstärkten Zusammenarbeit ist selbstverständlich gegenseitig. Aufseiten der Weiterbildungsanbieter mangelt es oft an theoretischen Bezügen und an spezifischem Wissen, das mit bestehenden teilnehmerorientierten Programmen verbunden werden könnte. In Zürich findet dies beispielsweise durch die intensive Zusammenarbeit zwischen Universität und Volkshochschule statt. Diese Form der Kooperation ist im Weiterbildungsbereich jedoch selten.
Zusammenarbeit und Transparenz
Читать дальше