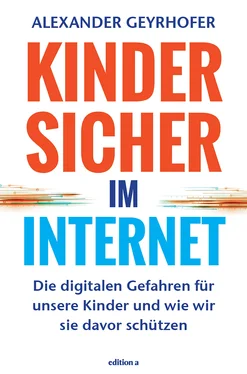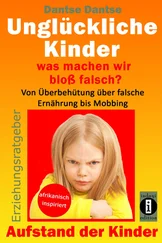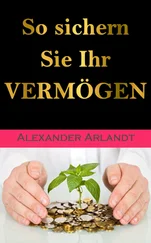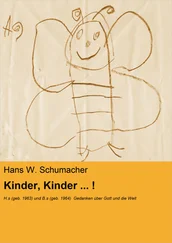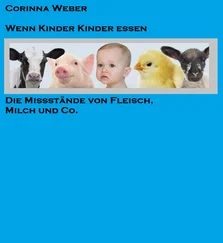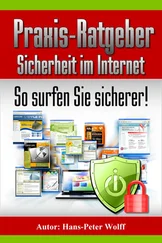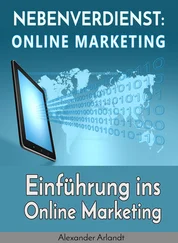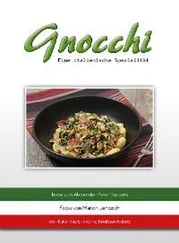Beispiel Nummer 2: Ein Gymnasium in Tirol. Auch hier eine Alltagsszene: Der elfjährige Kevin geht auf die Toilette. Große Notdurft. Kevin ist nicht überaus beliebt im Klassenverband, eher der Außenseitertyp. Zwei Mitschüler schleichen unbemerkt in die Nebenkabine, filmen über die Klowand hinweg. Auch sie teilen ihre Trophäe augenblicklich über WhatsApp. Auch hier ist Geschehenes nicht mehr rückgängig zu machen. Auch Kevin wurde aufs Übelste gemobbt. Allerdings hatte er noch Glück im Unglück, denn aufgrund sofortiger Intervention durch alarmierte Erwachsene konnte verhindert werden, dass der Film die WhatsApp-Gruppe verließ und in der ganzen Schule reihum ging.
Natürlich ist die Frage berechtigt: Hätte ein Handyverbot oder eine anderweitige, jedenfalls klare Regelung diese beiden Mobbingattacken verhindert? Nicht zwingend. Doch das Risiko wäre bestimmt minimiert gewesen – allein schon, weil klare Regeln in den Köpfen der Kinder präsent sind, sie bei Verstoß jederzeit mit Konsequenzen (Handyentzug et cetera) rechnen müssen und das auch ganz genau wissen.
 |
Tipp Der Umgang mit dem Smartphone mag von früh auf gelernt sein. Bringen Sie Ihren Kindern das Recht auf das eigene Bild näher. Natürlich mit kindgerechten Worten. Doch es muss ihnen klar sein, was das Urhebergesetz im Wesentlichen sagt, nämlich: Es gibt Situationen, wo Fotos (samt Begleittext) nicht veröffentlicht werden dürfen. Das Gesetz spricht hier von »berechtigten Interessen«, die es zu schützen gilt. |
Im Allgemeinen gilt dabei: Aufnahmen an öffentlichen Plätzen sind üblicherweise unbedenklich und können auch nicht ohne weiteres untersagt werden. Aber: Sobald der Abgebildete nachteilig abgebildet ist (zum Beispiel Oben-ohne-Fotos am Strand), ist das Foto in jedem Fall schützenswert, darf also keinesfalls veröffentlicht werden.
Das Recht aufs eigene Bild betrifft immer nur die ungewollte Veröffentlichung eines Fotos, nicht das Fotografieren an sich. 4
Im privaten Bereich setzt der Schutz des eigenen Bildes sehr viel früher ein. Das gilt zum Beispiel auch für private Veranstaltungen (Partys bei Freunden et cetera). Öffentlich gemachte Fotos dürfen die Abgebildeten auf keinen Fall wie auch immer bloßstellen oder herabsetzen. Ein persönliches Empfinden von Bloßstellung – nur weil der Fotograf nicht die eigene Schokoladenseite getroffen hat, weil man sich hässlich findet – reicht hingegen nicht aus. Die Bloßstellung muss möglichst objektiv nachvollziehbar sein (runtergelassene Hose im Vollrausch et cetera). Außerdem muss der Betreffende klar erkennbar sein. Ein Bild vom Hinterkopf wird also kaum ausreichen, um dagegen vorzugehen.
 |
Tipp Fragen Sie abgebildete Personen immer um Erlaubnis vor einer Veröffentlichung! Für die Schulen heißt das: Am Beginn eines Schuljahres sollte am besten von den Eltern eine allgemeine Zustimmung dafür eingeholt werden, dass ihre Kinder zum Beispiel im Rahmen des Unterrichts oder bei Schulveranstaltungen fotografiert und die Bilder etwa auf die schuleigene Homepage gestellt werden dürfen. Achtung: Die Erlaubnis kann auch stillschweigend erteilt werden, und zwar dann, wenn sich jemand offensichtlich bewusst fotografieren lässt. Dabei gilt jedoch: Die Veröffentlichung darf nur »im üblichen Rahmen« stattfinden, wie zum Beispiel auf der Website des Veranstalters et cetera. Auf anderen Plattformen, die nichts damit zu tun haben, dürfen sie nicht veröffentlicht werden. |
School-Shooting: Handy als Todesfalle
Besonders dramatische Folgen, ohne gleich den Teufel an die Wand malen zu wollen, haben Smartphones in Schulen bereits nach sich gezogen, wenn es (vor allem aus den USA bekannt) zu sogenannten School-Shootings kam. Sie werden fälschlicherweise immer wieder als Amokläufe bezeichnet, haben jedoch mit Amok nichts zu tun. Das Wort steht nämlich für einen »plötzlichen und blindwütigen Angriff«. Was bei dem typischerweise sorgsam geplanten Amoklauf nicht der Fall ist.
Warum sind Handys in solchen Extremsituationen eine Gefahr? Dienen sie nicht im Gegenteil der Sicherheit?
Die Erfahrung hat gezeigt: In derartigen Krisensituationen herrscht nach einer ersten Angriffswelle des Täters gespenstische Stille im Schulgebäude. Schüler und Lehrer suchen nach Verstecken, verbarrikadieren sich, verhalten sich mucksmäuschenstill, um nicht gefunden zu werden. Auch leise Geräusche, wie etwa das Vibrieren eines auf Lautlos gestellten Handys, haben dazu geführt, dass Menschen gefunden und erschossen worden sind. Also gilt für solche Fälle die klare Empfehlung: Alle Handys ausschalten und nicht bloß auf Lautlos stellen.
WENN DAS HANDY ZUR SPIELKONSOLE WIRD
Gewaltverherrlichende Spiele gibt es auch fürs Handy zuhauf und gratis. Das kann für alle Beteiligten empfindliche Folgen haben. Wie Jung und Alt gemeinsam zu einem sinnvollen Umgang mit dem Handy finden – eine Schule zeigt es vor.
Man möchte meinen, alle wüssten das längst – doch die Praxis zeigt mir immer wieder: Das Gegenteil ist der Fall. Immer noch ist vielen Eltern nicht bewusst, wie bedenklich manche Spiele sind, die es als freie Downloads für Mobiltelefone gibt. Eines davon ist dieses:
Whack your teacher 18+. Schlag deinen Lehrer also. Geben Sie den Titel einfach auf Google ein. Und schon sind Sie dabei. Box10.com heißt der Hersteller, der das etwas andere Spiel anbietet. Kostenlos, versteht sich. Einziges Ziel: die Lehrer ermorden. Eine durch und durch gewalttätige Sache also, die im Mantel eines Zeichentrickspiels daherkommt.

Gewaltspiele – Was sagt das Gesetz?
Ob als Elternteil, Erzieher oder Lehrer – hier gelten natürlich die Jugendschutzgesetze der jeweiligen Bundesländer, worin es übereinstimmend heißt:
Die Aufsichtspersonen haben dafür zu sorgen, dass die ihrer Aufsicht unterstehenden Jugendlichen die Jugendschutzbestimmungen einhalten. Die Erziehungsberechtigten haben bei der Übertragung der Aufsicht sorgfältig und verantwortungsbewusst vorzugehen.
Erwachsene dürfen Jugendlichen die Übertretung der Jugendschutzbestimmungen nicht ermöglichen oder erleichtern. Sie haben sich so zu verhalten, dass Jugendliche in ihrer körperlichen, geistigen, sittlichen, seelischen und sozialen Entwicklung nicht geschädigt werden. Sie haben dafür Sorge zu tragen, dass den in ihrem Einflussbereich befindlichen Jugendlichen keine jugendgefährdenden Informationen, Unterhaltungen, Darbietungen oder Darstellungen, insbesondere über elektronische Medien zugänglich werden.
Doch worum handelt es sich im Konkreten bei Medien oder Datenträgern, Gegenständen oder Dienstleistungen, die unserer Jugend gefährlich werden können? Dazu weiter im Gesetzestext:
1. Inhalte von Medien im Sinn des § 1 Abs. 1 Z1 des Mediengesetzes und Datenträgern sowie Gegenstände und Dienstleistungen, die Jugendliche in ihrer Entwicklung gefährden könne, dürfen diesen nicht angeboten, vorgeführt, an dies weitergegeben oder sonst zugänglich gemacht werden. Eine Gefährdung ist insbesondere anzunehmen, wenn sie:
2. kriminelle Handlungen von menschenverachtender Brutalität oder Gewaltdarstellungen verherrlichen oder
3. Menschen aus Gründen der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion, der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters, der sexuellen Orientierung oder des Geschlechts diskriminieren oder
4. pornographische Darstellungen beinhalten.
Читать дальше