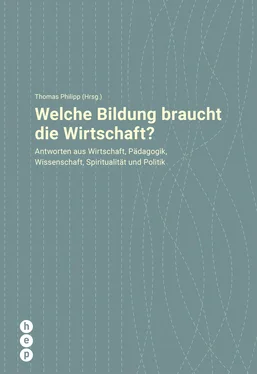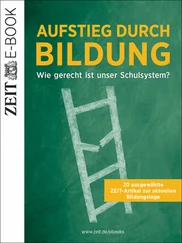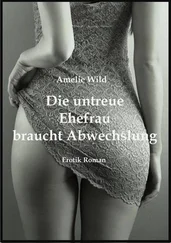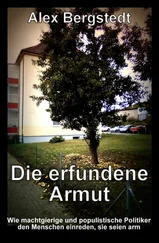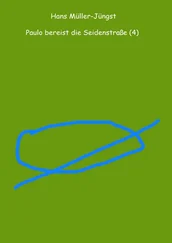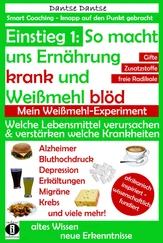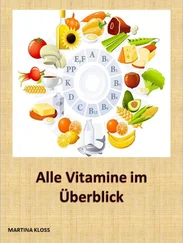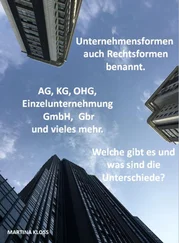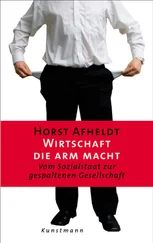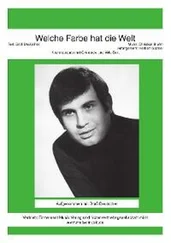Für Klaus Mertes macht das Mehr als Messbare den Kern des Bildungsprozesses aus. Aber warum verschwindet dieses Mehr im politischen Diskurs über Bildung? Seine These: Die Sprache der Zentralinstitutionen überrolle die untere und mittlere Ebene derart, dass die Sprache der bildenden Begegnung verstumme. Mertes fordert Subsidiarität: Die Ebene der Bildungsplanung müsse anerkennen, dass Bildung auf der Mikroebene stattfinde; die Zentrale habe der persönlichen Bildungs- und Beziehungsarbeit zu dienen und sich vor ihrer Erfahrung zu rechtfertigen. Die Begründungspflicht für Eingriffe liege bei der je höheren Ebene.
Carl Bossard konfrontiert die Anziehungskraft der Casting-Shows mit dem Verschwinden der Lehrperson im pädagogischen und bildungspolitischen Mainstream. Die Jugend suche die lebendige Beziehung zum Vorbild, während Pädagogik und Bildungspolitik das selbstgesteuerte Lernen propagierten. Sodass die Lehrperson mehr organisiere und auf Fragen hin berate denn als Gegenüber da sei. So gerate das Entscheidende in den Schatten: die Beziehung, in der sich Resonanz ereigne und die eine Auseinandersetzung aushalte.
Der Herausgeber entwickelt aus Kants kategorischem Imperativ den Grundriss einer Bildungsethik, die das Werden des Menschen vor Instrumentalisierung, vor Verzweckung schützt – durch andere und auch durch sich selbst.
Was sehen Verantwortliche des Schweizer Bildungssystems?
Michael Hengartner, Rektor der Universität Zürich und Präsident der swissuniversities, und Anna Däppen-Fellmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Stab des Generalsekretariats der Universität Zürich, entwickeln die Aufgabe der Universität aus ihrem mittelalterlichen Ursprung. Sie habe neben der sprachlichen und naturwissenschaftlichen Allgemeinbildung, den sieben artes liberales, immer schon der Berufsbildung von Juristen, Priestern und Ärzten gedient. Bologna passe das Studium der Realität der Massenuniversität an. Die Reform habe sich in ihren beiden Grundelementen – Zweiteilung des Studiums, europaweit vergleichbare Punkte – bewährt: Sie fördere die Mobilität, belebe den Wettbewerb, strukturiere das Studium besser und gebe früher Rückmeldung über die erzielten Leistungen. Einzuräumen sei, dass die kleinteiligen Prüfungen zur Verzettelung und zum Verlust des großen Zusammenhangs führen könnten. Die Lösung liege in einer besseren Vernetzung der Module. Das lasse sich durch Anpassung des Systems bewerkstelligen, ein grundsätzliches Überdenken der Reform sei nicht angezeigt.
Aus der Sicht des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation SBFI umreißt Josef Widmer das Verhältnis von Wirtschaft und Bildung aus systemischer Sicht und präsentiert Schwerpunkte und Ziele der nationalen Bildungspolitik. Der politische Text macht deutlich, wie die Steuerung des Bildungssystems sehr viele verschiedene Interessen vermittelt. Das Bildungssystem sei ein Abbild der gesellschaftlichen Entwicklung, nicht umgekehrt: Bildungspolitische Entscheide seien in der Schweiz aufgrund des demokratischen und partizipativen Prozesses breit abgestützt. Das lasse auf der Systemebene erst gar keinen fundamentalen Änderungs- oder Handlungsbedarf entstehen. Wo dennoch Steuerung angemahnt werde, sei sie evidenzbasiert zu begründen.
Eine besondere Chance bietet das Interview mit Hans Ambühl, der die Bildungspolitik der Kantone als Generalsekretär koordiniert. Er stellt sich der Kritik, erklärt, verteidigt Positionen – und anerkennt Schwierigkeiten und wunde Punkte. Er führt den Dialog der Tagung weiter, vertieft ihn, präzisiert die Positionen. Der Tonfall zeigt Anerkennung und Wertschätzung.
Ein Bottom-up-Projekt wie dieses Buch beginnt als Outlaw. Umso dankbarer ist es für die Anerkennung der Verantwortlichen. Die Geschichte der Christen war immer dann besonders fruchtbar, wenn Macht und Prophet miteinander sprachen und aufeinander hörten. Innozenz III., auf dem Höhepunkt der weltlichen Macht der Päpste, sprach mit Franz von Assisi, hielt seine radikale Kritik an der reichen Kirche aus, gab ihm Raum. Er anerkannte die Bettelorden. Das Neue durfte im Alten wachsen und führte die abendländische Kirche zu ihrer höchsten Blüte. Nicht ohne sich mit dem linken Flügel der Franziskaner zähe Probleme einzuhandeln, nicht ohne furchtbare Schatten wie die Katharerkreuzzüge – aber man war im Gespräch, und man war glaubwürdig für die Jugend. Mit Luther hingegen sprach niemand. Schon seinen ersten Brief beantwortete sein Bischof nicht. Stattdessen strengte er sofort einen Ketzerprozess an: weil er sich gegenüber den Fuggern, die den Ablasshandel organisierten, in wirtschaftliche Abhängigkeit begeben hatte. Er war ökonomisch nicht frei.
Reibungen
Fokussiert ein Fotograf ein Detail, tritt es scharf hervor; der Hintergrund verschwimmt. Will er aber das Ganze im Blick halten, bleiben interessante Details klein, gehen unter. Jeder Fokus hat Grenzen. Jede Sprache nimmt manche Verhältnisse deutlich wahr, andere bleiben unscharf oder finden sich ausgeblendet. Einer Sprache ihre Begrenztheit als solche zum Vorwurf zu machen, wäre wenig durchdacht. Allen Sprachen stellt sich die Aufgabe, neben der sorgfältigen Pflege des eigenen Fokus auch auf die der anderen zu hören, die eigene Position auch von außen wahrzunehmen und sich von ihr in Frage stellen zu lassen. Auch wenn das etwas unbequem ist und Arbeit verspricht. Am Dialog über Interessen- und Sprachgrenzen hinweg führt, zumal in komplexem Gelände, kein Weg vorbei. Treten wir also in die verschiedenen Sichtweisen ein, begegnen wir Spannungen zwischen den Interessen und den Sprachen der Beteiligten! Das sorgfältige Hören auf die Differenzen ist der erste Schritt zu ihrer Versöhnung.
Die wichtigste Reibung liegt in der Unmöglichkeit, den sich bildenden Menschen und die Tätigkeit der Bildungsinstitution ganz oder auch nur überwiegend in ökonomischer Sprache zu beschreiben. Dieser Versuch liegt, in den meisten Leitbildern und in allen Strategien der Deutschschweizer Universitäten vor. Diese Verkürzung und Vereinnahmung des werdenden Menschen ist mit Aufklärung, Demokratie und Liberalität unvereinbar.
Eine zweite Spannung ergibt sich aus dem Verhältnis zwischen der Begegnung sich bildender Menschen an der Basis und steuernder Großinstitutionen, die verschiedene Sprachen sprechen müssen. Nach Klaus Mertes überrollt die Sprache der Zentralinstitutionen diejenige der bildenden Begegnung. Dieser Analyse scheint zu entsprechen, dass Josef Widmer sich auf eine systemische Sprache beschränkt, und Michael Hengartner von institutionellen Notwendigkeiten – der Führung einer Massenuniversität, der Integration Europas – her argumentiert.
Ein dritter Punkt betrifft die Offenheit der ökonomischen Sprache für die Logik anderer Sprachen. Die wirtschaftliche Sprache kann Worte aus anderen Sprachen übernehmen und ins Zentrum stellen, etwa den »guten Lehrer« bei Ulrich Looser, die »Persönlichkeitsentwicklung« oder den »Widerspruchsgeist« bei Mara Häusler. Aber damit tritt sie noch nicht in das betreffende Phänomen und seine innere Logik ein. In der betriebswirtschaftlichen Sprache, die das zugreifende Handeln und Kontrollieren fokussiert, bleibt die Eigendynamik des geforderten Phänomens verdeckt: ihr Ereignischarakter und der Kontrollverlust, den man zulassen muss, damit die gewünschte Bildung – eintritt? Eben nicht. Nur: eintreten kann. Den guten Lehrer kann kein System effizient herstellen. Und niemand kann die Reife seiner Persönlichkeit gezielt ansteuern. Am Tor dieser Prozesse steht eine Erfahrung der Ohnmacht, eine Öffnung, ein Loslassen. Man kann nur die Bedingungen verbessern, Räume öffnen für Auseinandersetzung, Selbstzweifel, für Lebensphasen ohne sichtbaren Erfolg – möglicherweise ineffizient, horribile dictu, aber tatsächlich: Ohne Hören des Fremden auch in sich selbst, ohne Infragestellen eigener Werte, ohne Konflikt ereignet sich die bildende Beziehung nicht. In die Logik des guten Lehrers tritt die pädagogische Sprache Carl Bossards ein. Leserin und Leser spüren, wie sie sich nicht bruchlos in den Gedankengang Loosers einfügt: denn hier steht die Gegenseitigkeit der Beziehung, nicht mehr die gezielte Intervention eines organisierenden Ichs im Zentrum. Wie die geforderten guten Lehrer zu der Begeisterung kommen, derer sie zwingend bedürfen, um sie vermitteln zu können – ob stark verschulte und verplante Studiengänge mit wenig Raum und Förderung für Distanz und Selbstreflexion diese Fähigkeiten fördern: Darüber kann die ökonomische Sprache nichts sagen, davon versteht sie nichts. Sie handelt vom sinnvollen Umgang mit äußeren Ressourcen, mit Dingen. Der Mensch aber, der Jemand, das Wesen der Gegenseitigkeit steht in einer ganz anderen Logik. Aber – sind nicht Marktbeziehungen genau solche Gegenseitigkeiten? Dieser Einwand würde noch einmal zeigen, wie eine tragfähige Lehrer-Schüler-Beziehung dem ökonomischen Blick entgeht. Sie lebt genau nicht vom berechenbaren Nutzen, sondern vom Vertrauen.
Читать дальше