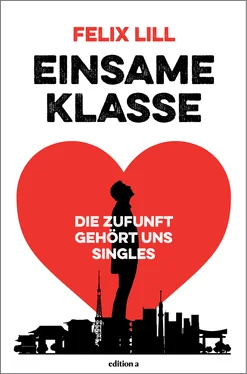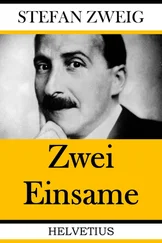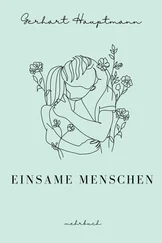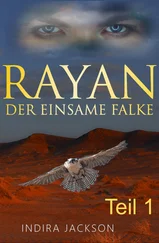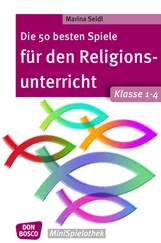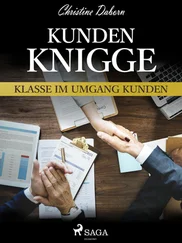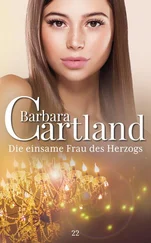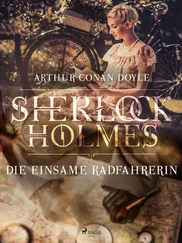Felix Lill - Einsame Klasse
Здесь есть возможность читать онлайн «Felix Lill - Einsame Klasse» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Einsame Klasse
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Einsame Klasse: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Einsame Klasse»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Einsame Klasse — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Einsame Klasse», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Und nun, da ich mich in meinem neuen, fremden Umfeld so umsah, fand ich so etwas wie zaghaften Trost. Denn mir kam vor, dass es Viele gab von meiner Sorte.
Einerseits hätte ich mich nicht wundern dürfen. Weltweit berichteten Zeitungen, Magazine und TV-Dokus seit Jahren davon, fast immer im selben Ton: Tokio, die Stadt der Singles. In der größten Stadt der Welt, mit einer Bevölkerung so groß wie der von ganz Kanada, seien Menschen zunehmend »einsam in der Masse.« (Wall Street Journal) Denn »die Japaner« seien draufgekommen, »Beziehungen seien ihnen zu umständlich.« (Süddeutsche Zeitung) Das ganze Land erlebe gerade »eine neue Eiszeit.« (Die Zeit) Im Herbst 2011 lieferte das Nationale Institut für Bevölkerungsforschung wieder Zahlenmaterial für solche Diagnosen. 61 Prozent der unverheirateten Männer und 49 Prozent der unverheirateten Frauen zwischen 18 und 34 Jahren sind in keiner Liebesbeziehung. Fast die Hälfte von ihnen will auch gar keine. Fast 40 Prozent aller Ledigen sind in diesem Alter Jungfrau, mit steigender Tendenz. Auch der Anteil der Unverheirateten nimmt zu, das zeigten Umfragen des Kondomherstellers Sagami vom Januar 2013. Ein Drittel der Männer in ihren Dreißigern und ein Viertel der Frauen sind unverheiratet. Unter 30 Jahren sind es sogar fast 80 Prozent der Männer und über 50 Prozent der Frauen.
Das Bild der Eiszeit begegnete mir noch anderswo. Charlotte, eine frischgebackene Collegeabgängerin, die ihren ebenfalls jungen Ehemann, einen Fotografen, für eine Woche nach Tokio begleitet, erlebt die Stadt in voller Kälte. In Sofia Coppolas Film »Lost in Translation«, den ich an einem Wochenende morgens im Bett ansah, spielt Scarlett Johansson Charlotte, eine Person, die verloren ist. Verloren vor Fragen über die Beziehung zu ihrem Freund, in dessen geschäftigem Leben sie sich wie bloße Dekoration fühlt. »Everyone wants to be found«, jeder will gefunden werden, prangt unterm Titel der englischen Originalversion dieses Films, der für sein Drehbuch einen Oscar gewann und als Meisterwerk gilt. Der Kulturschock, den Charlotte in dieser dicht bevölkerten Stadt erleidet, drückt sich deshalb nicht wie für viele andere Reisende in den grellen Lichtern im Techviertel Akihabara aus, oder in den leuchtend gekleideten Mädchen mit rosa Zöpfen in Harajuku, sondern im scheinbar absurden Kontrast, den Charlotte zwischen dieser visuellen Aufdringlichkeit und einer sozialen Distanz erlebt. In Tokio findet Charlotte sich selbst nicht, und während dieser einen Woche in der Stadt merkt sie, dass ihr Partner sie auch nicht findet. Charlotte ist unverstanden, aber mitten drin, erlebt das Getümmel und die klaustrophob vollen U-Bahnen. Zwischen ihr und den Anderen, ihrem Mann und den Tokiotern, deren Gestik und Worte sie einfach nicht versteht, scheint eine unüberwindbare Glasscheibe zu stehen, durch die sie zwar alles von dieser Gesellschaft sehen, aber fast nichts von ihr fühlen, mit jemandem gemeinsam fühlen kann. Für Charlotte ist Tokios Sound getragen von der Monotonie warnender Elektrostimmen auf Rolltreppen und dem Piepsen von Jingles in den Shoppingvierteln, aber auch einer plötzlichen und scheinbar seelenlosen Stille der Wohnblocks. Fast nichts am Leben in dieser Stadt ergibt Sinn. Soweit das Drehbuch. Noch weniger Sinn scheint zu ergeben, dass im größten Ballungsraum der Welt, zwischen eng an eng lebenden Menschen, das Alleinsein auch in Wirklichkeit ein großes Problem sein soll. Nur, wie zutreffend ist so eine Diagnose?
Lost in Translation war deshalb ein so beeindruckender Film, weil er ein Gefühl anspricht, das jeder kennt, fast jedem Angst bereitet und für dessen Vermeidung jeder seine eigene Strategie hat. Jeder kennt Einsamkeit. Manche stürzen sich nach einer verflossenen Liebschaft möglichst bald in die nächste, andere tun alles dafür, damit die Brüche einer Beziehung bloß nicht erst zu bedrohlich werden, wieder andere üben sich in Enthaltsamkeit, damit beim nächsten Mal alles noch besonderer und wirklicher wird. In Japan, wo die fremde Charlotte aus Lost in Translation mit ihren Sorgen allein ist, schien bei genauerem Hinsehen ein vierter Typ des Alleinseins besonders häufig zu sein. Menschen, die sich mit der Welt abfinden, so wie sie ist. Die der Liebe nicht hinterherrennen, die auf Entzug leben, oder vielleicht gar nichts mehr davon brauchen. Wahrscheinlich lebten so die Gäste in der Bar Nocturne, die allein kamen, dort allein ihre Zeit verbrachten und allein davongingen. Aber das schien mir unglaublich. Leben wir am Ende nicht alle für die Liebe? Gab es diese Typen wirklich? Die Traurigkeit der westlichen Protagonistin aus Lost in Translation konnte ich im Film gut nachvollziehen. Sie hatte niemanden zum Reden, zum Kuscheln, zum Sich-Ausheulen. Aber im nicht-fiktiven Tokio kam mir die Einsamkeit, wie ich sie in der Bar Nocturne erlebt und beim Joggen beobachtet hatte, auch wie ein Für-sich-Sein vor, eine harmonische Art des Alleinseins.
Als Kind habe ich gelernt, dass Alleinsein nichts Gutes sein kann. Ein Zeichen von Scheitern. Mir hat das niemand ausdrücklich erklärt. Das war aber auch nicht nötig. Kinderbücher machten das deutlich, TV-Berichte und Filme zeigten es immer wieder. Wer allein eine Kneipe besucht, ist ein Trunkenbold, wer im Alter keine Kinder hat, konnte wohl niemanden von sich überzeugen, und wer Single ist, kann entweder nicht mit Menschen umgehen oder ist zu feige für echte Intimität. Wo immer ich in den vergangenen Jahren dauerhaft lebte, ob in Wien, London oder Berlin, war diese Botschaft zwischen den Zeilen zu lesen und in der Luft zu hören. Wer dieses Maß an Japan anlegt, kann in dieser Zeit nicht bloß gescheiterte kleine Revolutionen beobachten, wie es zwischen Lena und mir geschah, als unsere Träume von Ewigkeit verpufften. Hier lässt sich mehr als das beobachten. Japan erlebt eine gesamtgesellschaftliche Revolution des Scheiterns.
Ich gehörte also dazu. Zu diesen einsamen Hunden, wie sie hier manchmal genannt werden, die durch die Stadt streunen und vielleicht gar nicht wissen, wonach sie suchen. Ich wusste es tatsächlich nicht, soviel war mir klar. Immerhin redete ich mir ein, dass ich ja eigentlich schon lange ein kompromissloses Leben hatte führen wollen, auch wenn ich Lena jeden Tag vermisste. Vielleicht ähnelte ich jenen Leuten in diesem Land, für die Beziehungen anscheinend zu umständlich waren. Wir hatten uns nicht auseinandergelebt, im Gegenteil, aber unsere Vorstellungen vom Leben waren so lange immer wieder aneinandergeprallt, bis wir durch große Dellen entstellt waren. Das typische Problem, das ich aus meinen verschiedenen Freundeskreisen schon kannte, und von dem ich auch schon in soziologischen Studien gelesen hatte. Im Wesentlichen ist es ein Koordinationsproblem, das sich schneller oder langsamer in fast allen sozialen Milieus ausbreiten dürfte, ob bodenständig oder kosmopolitisch, wohlhabend oder klamm. Weil es schnell entsteht in einer Zeit, in der Selbstverwirklichung als eines der obersten persönlichen Güter angesehen wird, egal welchem Geschlecht man angehört. Unsere Zeit ist nicht mehr geprägt von klar definierten Rollenbildern, Frau und Mann können und sollen finanziell unabhängig sein. Das ist eine Errungenschaft der Emanzipation, aber sie rüttelt das traditionelle Liebesleben durcheinander.
Vor gut 25 Jahren, als diese Entwicklung noch eine kleine Minderheit betraf, formulierte das Soziologenpaar Ulrich Beck und Elisabeth Beck-Gernsheim schon ein wissenschaftliches Konzept darüber. In ihrem Buch »Das ganz normale Chaos der Liebe« skizzierten sie eine neue Ära, in der alles Intime und Zwischenmenschliche zu einer Sache eigener Entscheidungen geworden sei. Weil die Bedeutung und die Glaubwürdigkeit alter, einst für unstrittig gehaltener Normen schwinde, werde in der Liebe alles ein Ding der Absprache, sogar Verhandlungssache. Wo leben wir, wie leben wir, was tun wir gemeinsam, wer ist für was zuständig, wo ziehen wir die Grenzen der Privatsphäre, was nehmen wir uns vor und wie erreichen wir das? So kompliziert wie heutzutage sei die Liebe noch nie gewesen. Denn sie kollidiere mit den Sphären der Familie und der persönlichen Freiheit, beides Bereiche, in denen wir alle gern unsere eigenen, individuellen Vorstellungen pflegen und verteidigen. Als verantwortlich für diesen Wandel, der Scheidungsraten in die Höhe schießen und neue Lebensmodelle häufiger werden lässt, die nicht dem Nuklearhaushalt mit Eltern und Kindern entsprechen, erklärten Beck und Beck-Gernsheim den Arbeitsmarkt. Sobald Frauen ihren eigenen Job haben, müssen sie ihrem Partner nicht mehr überall hin folgen. Und häufig tun sie es auch nicht. Der Zeitgeist zwinge junge Menschen nämlich förmlich dazu, »ihr eigenes Ding« zu machen, und auch wenn das Leben überhaupt nicht nach Plan laufe, überblendeten sie die Realität mit ihren Idealvorstellungen, die in einer nahen oder fernen Zukunft ja noch Wirklichkeit werden könnten. Im Jahr 1990 beschrieben Ulrich Beck und Elisabeth Beck-Gernsheim eine Generation junger Menschen, die ein Maß an Individualisierung erreicht hatte wie keine vor ihr. Diese Menschen fänden sich an einem einsamen Ort wieder, wo sie selbst die Verantwortung übernehmen, ihre eigenen Entscheidungen treffen müssen, obwohl sie in ihrer Kindheit kaum darauf vorbereitet worden waren. Und was sei das Ergebnis dieses unumkehrbaren Verschwimmens von Normen, Normalitäten und Individualitäten, in der die Familie keine klar definierte Einheit mehr ist? Für die beiden Soziologen war die Antwort offensichtlich: »Die Familie natürlich!« Es werde bloß mehr Spielarten von ihr geben, weil nun jeder etwas zu sagen habe. Patchworkfamilien, Wochenendfamilien, und alle möglichen anderen Konstellationen. Zwischen den autonomer gewordenen Familienmitgliedern werde dabei Liebe sogar wichtiger als je zuvor, weil sie wie Klebstoff zusammenhalte.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Einsame Klasse»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Einsame Klasse» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Einsame Klasse» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.