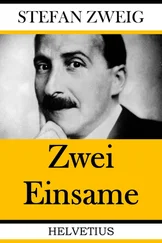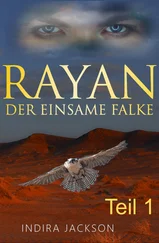»Kannst du mir nicht sagen, wo du in einem Jahr mit mir sein willst?«
Darauf konnte ich antworten, und ich fand meine Antwort viel bedingungsloser als alles Konkrete, was in einem Fünfjahresplan stehen könnte: »Ich will mit dir sein, Lena. Wo, das weiß ich nicht. Wie, weiß ich auch nicht. Ist das wichtig? Das Wichtigste ist für mich, dass es uns beide gibt, so wie in den letzten Jahren. Wir haben nie gewusst, wie es weitergehen wird. Irgendwie könnten wir überall auf der Welt sein. Wir sind nicht reich, aber leben ohne finanzielle Sorgen. Wir haben keinen konkreten Plan, aber viel Spaß und machen unbezahlbare Erfahrungen. Wir sind beweglich. Was ist daran schlecht? Andere beneiden uns darum.«
Lena nickte, sie war aber nicht einverstanden. Dem Stück Makrelensushi, das auf dem Zugsystem über den Tischen an ihren Augen vorbeifuhr, schmiss sie einen abschätzigen Blick zu. Ich liebte Japans Küche mit all ihren Variationen und Zubereitungsformen. Sie hasste Fisch, genau wie Fleisch. »Ich finde nur, dass es nicht ewig so weitergehen kann. Das wilde Leben will ich nicht für immer. Irgendwann muss man sesshaft werden.«
Der Satz klingelte in meinen Ohren. Mindestens bei der Hälfte aller Paare, die sich auseinandergelebt hatten, hatte ich in den Gesprächen darüber so einen Begriff wie Sesshaftwerden gehört. Bestimmt wollten das in einigen Fällen beide nicht, mindestens einer aber hatte dann das Gefühl, es wollen zu sollen. Geordnete Bahnen sind wichtig, heißt es so oft, und es gilt wohl auch hier. Sonst würde Liebe zu Anarchie. Dabei ist das Wichtigste nach der Revolution doch die neue Ordnung.
Einige Tage später umarmten wir uns am Flughafen. Unsere Körper legten sich wieder perfekt ineinander, wie in einem Guss. So etwas find ich nie wieder, dachte ich. Ihre weichen, vollen Lippen berührten meine, ihr Flüstern kitzelte in meinem Ohr, meine Zweifel waren schon wieder weggeliebt. Diesmal war Lena diejenige, die ging und ich blieb zurück. Sie sollte bald wiederkommen. Nach einem halben Jahr in Japan war es nun mal an der Zeit, die Heimat zu sehen.
Die unterschiedlichen Zeitzonen trieben uns noch weiter auseinander als die Entfernung. Wenn ich ins Bett ging, war bei ihr Nachmittag. Ich stand auf, wenn sie schlafen ging. Wir schrieben einander Nachrichten, telefonierten nur alle paar Tage. Wäre da nicht das Bewusstsein gewesen, dass das alles so nicht sein sollte, weil eine normale Beziehung enger getaktet ist, hätte es mich kaum gestört. Aber auch da waren wir unterschiedlich. Eines Tages sagte sie mir, dass sie sich nach dem Praktikum keinen Job in Tokio suchen wolle. Kurz darauf schrieb Lena per Handy an einem Nachmittag, der ihr Morgen war: »Können wir später bitte reden?«
Bis spät saß ich am Laptop, klickte schließlich auf »Anruf annehmen«.
»Felix …«
Nur ihre Stimme musste ich hören, um zu wissen, dass es ernst war. Über den Bildschirm sah ich das auch in ihrem Gesicht, aber ihre Sommersprossen lenkten mich ab, ich dachte wieder an schöne Tage mit ihr, damals in Wien, oder später in Mexiko.
»Wir haben doch keine Zukunft, oder?«
Ihre Worte trafen mich wie ein Schlag in den Magen.
»Keine gemeinsame Zukunft, meine ich. Du willst dich nicht binden.«
»Ich bin doch seit Jahren gebunden, Lena. Und mir geht’s gut damit.«
»Aber du kannst mir nicht sagen, wo du in fünf oder zehn Jahren mit mir sein willst. Mir geht’s so nicht gut.«
Ich schwieg.
»Felix, sag was.«
»Keiner weiß, wie die Zukunft genau aussieht«, brachte ich heraus. »Können wir uns nicht erstmal hier einleben? Wo wir leben wollen, können wir doch sowieso nur teilweise selbst entscheiden. Das hängt von so vielem ab. Warum lassen wir das nicht auf uns zukommen?«
»Wir sind einfach zu verschieden. Ich will das nicht mehr.«
So ging es weiter, vielleicht eine Stunde, vielleicht zwei. In Beziehungen gibt es viele Schlüsselmomente, einige stellen sich erst im Nachhinein als solche heraus, aber andere fühlen sich an wie ein Showdown. In diesem Gespräch ging es um alles. Und es schien nicht alles verloren, denn die Gravitation zwischen uns hatte nie nachgelassen. Wir drehten uns im Kreis, hörten uns das Lebensmodell des Gegenüber an, behaupteten zu verstehen, widerlegten einander dennoch mit immer neuen Beispielen, die mit »weißt du noch, als« anfingen und mit »ja, aber« demontiert wurden. So wie sie wohl mit sich haderte, tat ich es auch, kannte ihre Antworten, wollte sie jedoch nicht hören. Ich wollte mit ihr zusammen sein, aber diese Frage nach der konkreten Schrittfolge im Leben kam mir blödsinnig vor. Gleichzeitig war ich wahrscheinlich selbst zu blöd, sie zu verstehen. Ihren Wunsch nach der Stabilität, die ihr vorschwebte, konnte ich nachvollziehen, aber nicht begreifen. Vielleicht würden wir irgendwann genau sagen können, wie lange wir hier bleiben, wie es weitergeht.
Irgendwann weinten wir, dann lachten wir, dann sprachen wir über ihre Eltern, über meine, über ihre Geschwister, über meine, über die Heimat und die Ferne und waren ganz vom Thema abgekommen.
»Du fehlst mir«, sagte ich.
»Du fehlst mir auch«, sagte sie.
»Wann kommst du wieder nachhause?«, fragte ich, als sich Lenas Stimmlage nach den nostalgischen Gesprächsinhalten ins Ernste, Desillusionierte kehrte. Jetzt schwieg sie.
Ich hörte nur ihr Ausatmen, wie sie es öfter von mir gehört haben musste, und spürte, wie quälend diese Reaktion sein kann.
Noch quälender war ihr anhaltendes Schweigen. »Mach’s gut«, flüsterte Lena schließlich durch die Telefonleitung in mein Ohr.
In Tokio, wo wir gemeinsam angekommen waren, sollte ich’s gut machen, allein? Das klang nach einem letzten schlechten Witz.
Mir war es schon wie der Naturzustand vorgekommen. So wohlig hatte ich mich in dieser Welt der Zweisamkeit eingerichtet, dass ich mich an das andere Leben nur dunkel erinnern mochte. Aber war es nicht immer nur eine Frage der Zeit gewesen, bis ich wieder allein war? Das sagte ich mir jetzt jedenfalls. Vielleicht wollte ich bloß Recht haben, vor mir behaupten können, dass ich den Ausgang dieser Story von Anfang an gekannt hatte. Falls das wirklich zutraf, hatte ich das für einen langen Zeitraum vergessen, bis die Fallhöhe ganz unbemerkt ziemlich schwindelerregend geworden war. Nach fünf Jahren, unzähligen Diskussionen, Versöhnungen, Vertrauensbrüchen, Neuanfängen, Enttäuschungen und Überraschungen hatte sie die Schnauze voll. Dass ich jetzt endlich das Haus verlassen und allem fernbleiben konnte, ohne mich rechtfertigen zu müssen, hätte mich beflügeln können. Aber es zog mich runter.
Ins Kellergeschoss eines unauffälligen Gebäudes im Büroviertel Yotsuya, in die Bar Nocturne. Unter meinen Ellenbogen ein glattpolierter Tresen aus Holz, über meinem Kopf Boxen, aus denen bluesiger Pianojazz spielte, gegenüber ein Mann in weißem Hemd, schwarzer Weste und Fliege, wahrscheinlich kurz vorm Midlife-Crisis-Alter. Mit einem kräftigen Schwung im Arm wirbelte er ein kleines Glas durch die Luft, ehe er dem Typen zwei Sitze neben mir vorsichtig einen 17-jährigen Hibiki einschenkte.
Der Gast zog das Glas vor seine Brust an die Barkante und hielt sich einige Minuten daran fest. Er war alleine hier, wie ich, aber einen Tick älter, Mitte dreißig wahrscheinlich, und angesichts seiner Reglosigkeit schien es ihm lieber zu sein, wenn sich seine Blicke mit niemandem kreuzten. Parallel schauten wir an die Flaschenwand hinterm Barkeeper. Whisky aus Schottland, Irland, Kanada, Japan, Zehnjährige, Zwölfjährige, Siebzehnjährige. Im rechten Augenwinkel sah ich, wie seine Hand das Glas hob. Ein Viertel des Getränks machte einen Abgang. 17 Jahre voller Hingabe, akribischen Brennens und strenger Lagerungsregeln flossen nun ins Verdauungssystem dieses stillen Typen.
Читать дальше