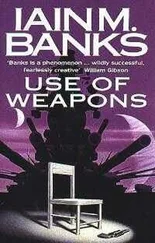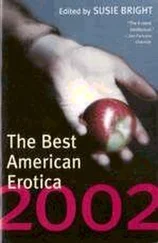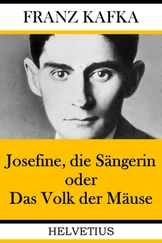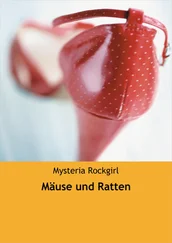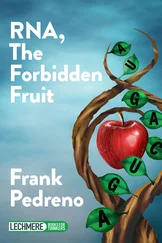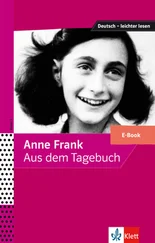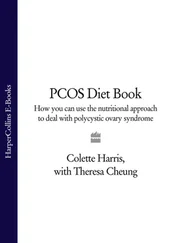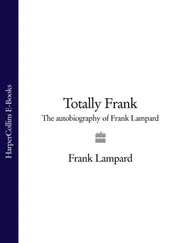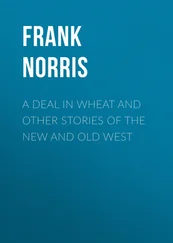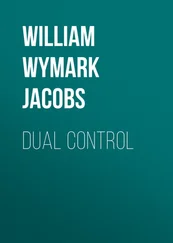2.4.3 Grundrechtliche Fragezeichen von Exportkontrollregelungen
39
Das vorliegende Werk soll in erster Linie praktisches Wissen zur Güterkontrollgesetzgebung vermitteln. Dennoch soll an dieser Stelle die grundrechtliche Problematik zumindest kurz skizziert werden. Diese Skizzierung soll dem Anwender lediglich als gedanklicher Anstoss dienen, die grundrechtliche Thematik nicht vollständig aus dem Blick zu verlieren. Für die allermeisten Fälle wird der grundrechtliche Gesichtspunkt wohl nicht zum Tragen kommen. Wenn doch, dann lohnt es sich, sowohl die hier aufgeworfenen wie nicht aufgeworfenen Fragen mit grosser Sorgfalt und Akribie zu behandeln.
40
Die Regelungen der Exportkontrolle vermögen nicht in allen Bereichen zu überzeugen.[52] Zunächst einmal stellen sich Fragen nach der Effektivität der getroffenen Massnahmen, d.h., ob diese überhaupt in der Lage und geeignet sind, die genannten Ziele der Exportkontrolle (Non-Proliferation, Verhinderung der unkontrollierten Verbreitung konventioneller Rüstungsgüter und neu auch Terrorismusprävention) zu gewährleisten.[53] Diese Fragen ziehen quasi automatisch die Frage nach dem Verhältnismässigkeitsprinzip nach sich. Auch wenn davon auszugehen ist, dass die Frage nach der Verhältnismässigkeit auf einer generell-abstrakten Ebene in Bezug auf die Güterkontrollgesetzgebung wohl bejaht werden dürfte, heisst das noch lange nicht, dass deren Prüfung auf einer individuell-konkreten Ebene, sprich auf eine Verfügung oder ein Urteil hin, zum gleichen Resultat kommen muss.
41
Als besonderer Mangel, welcher zwar grundrechtlich betrachtet eher von marginaler Bedeutung ist, dafür aber gesetzgebungstechnisch betrachtet umso schwerer wiegt, erscheint die Tatsache, dass aus den Materialien des Gesetzes nicht ersichtlich ist, ob vor deren Ausarbeitung überhaupt irgendeine Form von Rechtstatsachenforschung betrieben wurde. Damit weist das Gesetz per se bereits eine grosse Unzulänglichkeit auf, weshalb es allenfalls lohnenswert wäre, dieses Manko (zusammen mit anderen Punkten) einem Gericht zur Prüfung zu unterbreiten.[54]
42
Eine weitere Unzulänglichkeit aus der grundrechtlichen Betrachtungsweise ist, dass die Nennung der vier genannten Kontrollregime, die faktisch für die Schweiz mitbestimmen, welche Güter als Dual-Use Güter anzusehen sind, erst auf Verordnungsstufe erfolgt (Art. 1 Abs. 2 GKV). Es muss daher an dieser Stelle die Frage aufgeworfen werden, ob dies mit dem Erfordernis der Gesetzesform (Gesetzesvorbehalt i.e.S.) in Einklang zu bringen ist. Zwar verlangt Art. 5 Abs. 1 BV nicht grundsätzlich, dass sich eine rechtliche Grundlage immer in einem Gesetz im formellen Sinn zu finden habe. Wenn aber Grundrechte schwerwiegend eingeschränkt werden, und dies ist hier gleich in mehrerer Hinsicht der Fall (Wirtschaftsfreiheit gem. Art. 27 BV und Schutz der Privatsphäre gem. Art. 13 BV), so besteht nach Art. 36 Abs. 1 BV das Erfordernis einer gesetzlichen Grundlage im formellen Sinn.[55]
43
Des Weiteren muss auch die Frage der Rechtsgleichheit zumindest aufgeworfen werden. Im schweizerischen Verfassungsrecht ist diese in Art. 8 BV geregelt, und der Schutz vor Willkür und die Wahrung von Treu und Glauben in Art. 9 BV.[56] Man spricht von «absoluter Gleichbehandlung», wenn das Recht an zwei miteinander vergleichbare Sachverhalte die genau gleichen Rechtsfolgen anknüpft. Durch eine solche absolute Gleichbehandlung entsteht mitunter aber das Paradoxon einer rechtsungleichen Behandlung. Müssen z.B. Spitzenverdiener und Schlechtverdienende den genau gleichen Betrag an Steuern entrichten, so sind zwar die Rechtsfolgen gleich, aber der Schlechtverdiener muss einen viel grösseren Teil seiner finanziellen Mittel aufwenden, um die Steuern zu bezahlen. Früh wurde bereits erkannt, dass in solchen Fällen der Gleichheitsgedanke besser durch eine «relative Gleichbehandlung» verwirklicht wird. Um beim genannten Beispiel zu bleiben, indem unter Berücksichtigung der unterschiedlichen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeiten der Steuerpflichtigen verschieden hohe Steuern erhoben werden, z.B. durch Festsetzung einer entsprechenden Steuerprogression.[57]
44
Absolute Gleichbehandlung wird durch die Bundesverfassung nur in sehr wenigen Fällen verlangt, bspw. bei der Menschenwürde, beim Stimmrecht etc. Grundsätzlich aber wird die Rechtsgleichheit durch eine differenzierende Regelung realisiert. Es gilt diesbzgl. der Gleichheitssatz: Gleiches ist nach Massgabe seiner Gleichheit gleich, Ungleiches nach Massgabe seiner Ungleichheit ungleich zu behandeln. [58]
45
Dem Gesetzgeber kommt dabei zwar eine erhebliche Gestaltungsfreiheit zu, es ist ihm jedoch verboten, Differenzierungen zu treffen, für die keine sachlichen und vernünftigen Gründe vorliegen. Auf der anderen Seite darf er sich aber auch nicht über erhebliche tatsächliche Unterschiede hinwegsetzen. Danach verletzt ein Erlass das Rechtsgleichheitsgebot, «wenn hinsichtlich einer entscheidwesentlichen Tatsache rechtliche Unterscheidungen getroffen werden, für die ein vernünftiger Grund in den zu regelnden Verhältnissen nicht ersichtlich ist, oder wenn Unterscheidungen unterlassen werden, die aufgrund der Verhältnisse hätten getroffen werden müssen».[59]
46
In Bezug auf die Güterkontrollgesetzgebung resp. deren Umsetzung wird, wie noch aufgezeigt wird, die Compliance eine wichtige Rolle spielen. Die Compliance delegiert u.a. komplexe Kontrollaufgaben an die Rechtsunterworfenen. Zwar muss die Tatsache, dass in einer immer komplexer werdenden Welt auch das Recht komplexer wird, als eine unvermeidbare Realität angesehen werden. Im Bereich der Exportkontrolle von Dual-Use Gütern hat diese Komplexität nun aber Formen erreicht, welche einerseits über das Ziel hinausschiessen und andererseits insb. für kleinere Exporteure, welche nicht über eigene spezialisierte Fachpersonen im Hause verfügen, eine Benachteiligung darstellen.[60]
47
Es darf in diesem Zusammenhang auch nicht übersehen werden, dass die von einem Rechtsunterworfenen kaum in vollem Umfang vorhersehbaren Risiken, die ihm aus dem Export von Dual-Use Gütern erwachsen, durchaus zu Konflikten mit Art. 8 Abs. 1 EMRK führen können. Art. 8 Abs. 1 EMRK ist die Grundrechtsnorm, welche anlässlich der Revision der Bundesverfassung ihr Pendant in Art. 13 BV gefunden hat. Art. 8 Abs. 1 EMRK resp. Art. 13 Abs. 1 BV verlangen von den Vertragsstaaten u.a. die Achtung des «Privatlebens». Dazu zählt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte auch die berufliche Tätigkeit eines Menschen. Obwohl aus dem Namen der Konvention nicht direkt ersichtlich, schützt die EMRK nicht nur natürliche, sondern auch juristische Personen. Daher erstreckt sich ihr Schutz ohne Weiteres auch auf die gesamte private wirtschaftliche Tätigkeit.
48
Zwar sind staatliche Eingriffe in dieses Privatleben und damit in die wirtschaftliche Tätigkeit nach Art. 8 Abs. 2 EMRK zulässig, sofern sie «in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig» sind, sie bedürfen jedoch einer gesetzlichen Grundlage. Nach der Strassburger Praxis muss diese zwar nicht zwingend in einem formellen Gesetz stehen; ein «materielles Gesetz», also eine auf einem Gesetz beruhende Verordnung, ja sogar «ungeschriebenes Recht», also bspw. richterliche Rechtsprechung oder gar behördliche Verfügungspraxis,[61] kann bereits ausreichend sein. Allerdings darf dabei nicht übersehen werden, dass nach der Strassburger Praxis einerseits die gesetzliche Grundlage nicht nur hinreichend zugänglich sein muss, so dass sich die Rechtsunterworfenen angemessen über das anwendbare Recht informieren können, sondern es ist auch von zentraler Bedeutung, ob eine ausreichende Vorhersehbarkeit des betreffenden Gesetzes bejaht werden kann. Gerade an dieses Erfordernis der Vorhersehbarkeit stellt die Strassburger Praxis bei schweren Eingriffen höhere Anforderungen.[62]
Читать дальше